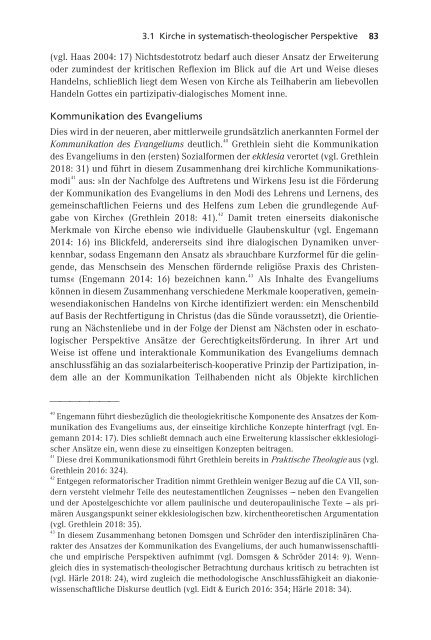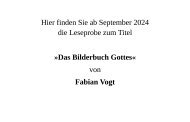Daniel Wegner: Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche (Leseprobe)
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.1 <strong>Kirche</strong> in systematisch-theologischer Perspektive 83<br />
(vgl. Haas 2004: 17) Nichtsdestotrotz bedarf auch dieser Ansatz der Erweiterung<br />
oder zumindest der kritischen Reflexion im Blick auf die Art <strong>und</strong> Weise dieses<br />
Handelns, schließlich liegt dem Wesen von <strong>Kirche</strong> als Teilhaberin am liebevollen<br />
Handeln Gottes ein partizipativ-dialogisches Moment inne.<br />
Kommunikation des Evangeliums<br />
Dies wird in der neueren, aber mittlerweile gr<strong>und</strong>sätzlich anerkannten Formel der<br />
Kommunikation des Evangeliums deutlich. 40<br />
Grethlein sieht die Kommunikation<br />
des Evangeliums in den (ersten) Sozialformen der ekklesia verortet (vgl. Grethlein<br />
2018: 31) <strong>und</strong> führt in diesem Zusammenhang drei kirchliche Kommunikationsmodi<br />
41 aus: »In der Nachfolge des Auftretens <strong>und</strong> Wirkens Jesu ist die Förderung<br />
der Kommunikation des Evangeliums in den Modi des Lehrens <strong>und</strong> Lernens, des<br />
gemeinschaftlichen Feierns <strong>und</strong> des Helfens zum Leben die gr<strong>und</strong>legende Aufgabe<br />
von <strong>Kirche</strong>« (Grethlein 2018: 41). 42<br />
Damit treten einerseits diakonische<br />
Merkmale von <strong>Kirche</strong> ebenso wie individuelle Glaubenskultur (vgl. Engemann<br />
2014: 16) ins Blickfeld, andererseits sind ihre dialogischen Dynamiken unverkennbar,<br />
sodass Engemann den Ansatz als »brauchbare Kurzformel für die gelingende,<br />
das Menschsein des Menschen fördernde religiöse Praxis des Christentums«<br />
(Engemann 2014: 16) bezeichnen kann. 43<br />
Als Inhalte des Evangeliums<br />
können in diesem Zusammenhang verschiedene Merkmale kooperativen, gemeinwesendiakonischen<br />
Handelns von <strong>Kirche</strong> identifiziert werden: ein Menschenbild<br />
auf Basis der Rechtfertigung in Christus (das die Sünde voraussetzt), die Orientierung<br />
an Nächstenliebe <strong>und</strong> in der Folge der Dienst am Nächsten oder in eschatologischer<br />
Perspektive Ansätze der Gerechtigkeitsförderung. In ihrer Art <strong>und</strong><br />
Weise ist offene <strong>und</strong> interaktionale Kommunikation des Evangeliums demnach<br />
anschlussfähig an das sozialarbeiterisch-kooperative Prinzip der Partizipation, indem<br />
alle an der Kommunikation Teilhabenden nicht als Objekte kirchlichen<br />
<br />
40<br />
Engemann führt diesbezüglich die theologiekritische Komponente des Ansatzes der Kommunikation<br />
des Evangeliums aus, der einseitige kirchliche Konzepte hinterfragt (vgl. Engemann<br />
2014: 17). Dies schließt demnach auch eine Erweiterung klassischer ekklesiologischer<br />
Ansätze ein, wenn diese zu einseitigen Konzepten beitragen.<br />
41<br />
Diese drei Kommunikationsmodi führt Grethlein bereits in Praktische Theologie aus (vgl.<br />
Grethlein 2016: 324).<br />
42<br />
Entgegen reformatorischer Tradition nimmt Grethlein weniger Bezug auf die CA VII, sondern<br />
versteht vielmehr Teile des neutestamentlichen Zeugnisses --- neben den Evangelien<br />
<strong>und</strong> der Apostelgeschichte vor allem paulinische <strong>und</strong> deuteropaulinische Texte --- als primären<br />
Ausgangspunkt seiner ekklesiologischen bzw. kirchentheoretischen Argumentation<br />
(vgl. Grethlein 2018: 35).<br />
43<br />
In diesem Zusammenhang betonen Domsgen <strong>und</strong> Schröder den interdisziplinären Charakter<br />
des Ansatzes der Kommunikation des Evangeliums, der auch humanwissenschaftliche<br />
<strong>und</strong> empirische Perspektiven aufnimmt (vgl. Domsgen & Schröder 2014: 9). Wenngleich<br />
dies in systematisch-theologischer Betrachtung durchaus kritisch zu betrachten ist<br />
(vgl. Härle 2018: 24), wird zugleich die methodologische Anschlussfähigkeit an diakoniewissenschaftliche<br />
Diskurse deutlich (vgl. Eidt & Eurich 2016: 354; Härle 2018: 34).