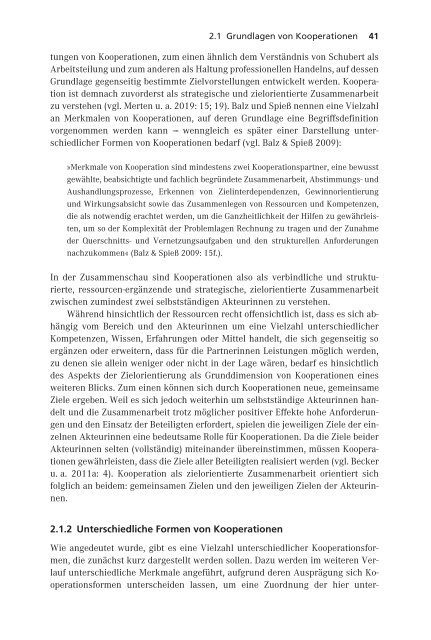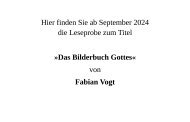Daniel Wegner: Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche (Leseprobe)
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1 Gr<strong>und</strong>lagen von <strong>Kooperationen</strong> 41<br />
tungen von <strong>Kooperationen</strong>, zum einen ähnlich dem Verständnis von Schubert als<br />
Arbeitsteilung <strong>und</strong> zum anderen als Haltung professionellen Handelns, auf dessen<br />
Gr<strong>und</strong>lage gegenseitig bestimmte Zielvorstellungen entwickelt werden. Kooperation<br />
ist demnach zuvorderst als strategische <strong>und</strong> zielorientierte Zusammenarbeit<br />
zu verstehen (vgl. Merten u. a. 2019: 15; 19). Balz <strong>und</strong> Spieß nennen eine Vielzahl<br />
an Merkmalen von <strong>Kooperationen</strong>, auf deren Gr<strong>und</strong>lage eine Begriffsdefinition<br />
vorgenommen werden kann --- wenngleich es später einer Darstellung unterschiedlicher<br />
Formen von <strong>Kooperationen</strong> bedarf (vgl. Balz & Spieß 2009):<br />
»Merkmale von Kooperation sind mindestens zwei Kooperationspartner, eine bewusst<br />
gewählte, beabsichtigte <strong>und</strong> fachlich begründete Zusammenarbeit, Abstimmungs- <strong>und</strong><br />
Aushandlungsprozesse, Erkennen von Zielinterdependenzen, Gewinnorientierung<br />
<strong>und</strong> Wirkungsabsicht sowie das Zusammenlegen von Ressourcen <strong>und</strong> Kompetenzen,<br />
die als notwendig erachtet werden, um die Ganzheitlichkeit der Hilfen zu gewährleisten,<br />
um so der Komplexität der Problemlagen Rechnung zu tragen <strong>und</strong> der Zunahme<br />
der Querschnitts- <strong>und</strong> Vernetzungsaufgaben <strong>und</strong> den strukturellen Anforderungen<br />
nachzukommen« (Balz & Spieß 2009: 15f.).<br />
In der Zusammenschau sind <strong>Kooperationen</strong> also als verbindliche <strong>und</strong> strukturierte,<br />
ressourcen-ergänzende <strong>und</strong> strategische, zielorientierte Zusammenarbeit<br />
<strong>zwischen</strong> zumindest zwei selbstständigen Akteurinnen zu verstehen.<br />
Während hinsichtlich der Ressourcen recht offensichtlich ist, dass es sich abhängig<br />
vom Bereich <strong>und</strong> den Akteurinnen um eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Kompetenzen, Wissen, Erfahrungen oder Mittel handelt, die sich gegenseitig so<br />
ergänzen oder erweitern, dass für die Partnerinnen Leistungen möglich werden,<br />
zu denen sie allein weniger oder nicht in der Lage wären, bedarf es hinsichtlich<br />
des Aspekts der Zielorientierung als Gr<strong>und</strong>dimension von <strong>Kooperationen</strong> eines<br />
weiteren Blicks. Zum einen können sich durch <strong>Kooperationen</strong> neue, gemeinsame<br />
Ziele ergeben. Weil es sich jedoch weiterhin um selbstständige Akteurinnen handelt<br />
<strong>und</strong> die Zusammenarbeit trotz möglicher positiver Effekte hohe Anforderungen<br />
<strong>und</strong> den Einsatz der Beteiligten erfordert, spielen die jeweiligen Ziele der einzelnen<br />
Akteurinnen eine bedeutsame Rolle für <strong>Kooperationen</strong>. Da die Ziele beider<br />
Akteurinnen selten (vollständig) miteinander übereinstimmen, müssen <strong>Kooperationen</strong><br />
gewährleisten, dass die Ziele aller Beteiligten realisiert werden (vgl. Becker<br />
u. a. 2011a: 4). Kooperation als zielorientierte Zusammenarbeit orientiert sich<br />
folglich an beidem: gemeinsamen Zielen <strong>und</strong> den jeweiligen Zielen der Akteurinnen.<br />
2.1.2 Unterschiedliche Formen von <strong>Kooperationen</strong><br />
Wie angedeutet wurde, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationsformen,<br />
die zunächst kurz dargestellt werden sollen. Dazu werden im weiteren Verlauf<br />
unterschiedliche Merkmale angeführt, aufgr<strong>und</strong> deren Ausprägung sich Kooperationsformen<br />
unterscheiden lassen, um eine Zuordnung der hier unter-