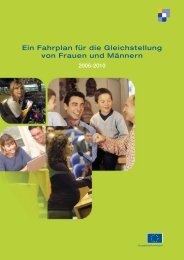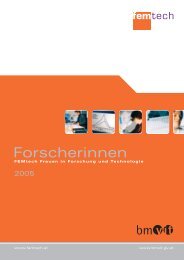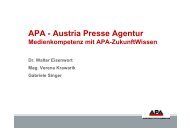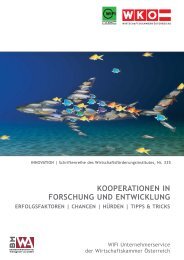karrieretypen im naturwissenschaftlich- technischen ... - w-fFORTE
karrieretypen im naturwissenschaftlich- technischen ... - w-fFORTE
karrieretypen im naturwissenschaftlich- technischen ... - w-fFORTE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
chen’ und ‚dem Weiblichen’ als eine unüberwindbare antagonistische Differenz mit<br />
einer weit reichenden symbolischen Mächtigkeit. Geschlecht in seiner sozialen D<strong>im</strong>ension<br />
bedeutet strenge Zweigeschlechtlichkeit.<br />
Die Differenz zwischen den beiden sozialen Geschlechtern ist aus dem Grund so<br />
wirkmächtig, da sie weit mehr als die Zuordnung der Produktionsarbeit an Männer und<br />
der Reproduktionsarbeit an Frauen umfasst. Die beiden Geschlechter werden vielmehr<br />
zu dichotomen Merkmalsgruppen ausgestaltet – Begriffe bzw. Charakteristika wie Aktivität/Passivität,<br />
Kraft/Schwäche, Öffentlichkeit/Privatheit, Selbstständigkeit/Abhängigkeit,<br />
Ratio/Emotio, … werden dem sozial ‚Männlichen’ bzw. ‚Weiblichen’ zugeordnet<br />
und mehr noch, als Charaktereigenschaft einverleibt. Die gesellschaftliche Konstruktion<br />
von zwei polarisierten Geschlechtercharakteren wird „als eine Kombination von Biologie<br />
und Best<strong>im</strong>mung aus der Natur abgeleitet und zugleich als Wesensmerkmal in das<br />
Innere des Menschen verlegt“ (Hausen 1976:369). Hagemann-White (1984:78ff) bezeichnet<br />
diese Zweigeschlechtlichkeit als kulturelles System.<br />
Diese biologistischen bipolaren Charakterzuschreibungen sind <strong>im</strong> Rahmen dieser Studie<br />
vor allem hinsichtlich der damit verbundenen männlichen Konnotation von Technik<br />
und Wissenschaft interessant. Denn über die internalisierten Geschlechtscharaktere<br />
vermitteltet sich eine Verbindung von ‚männlich’ mit Themen wie Rationalität, geistige<br />
Kraft, Verstand, Logik, Einsicht, produktive Leistungsfähigkeit, Urteilsklarheit etc.,<br />
die gewissermaßen die ‚wissenschaftlichen’ Qualitäten darstellen; ziemlich analog existiert<br />
die Verbindung von ‚männlich‛ und ‚<strong>technischen</strong>’ Qualitäten mit Begriffen von Ordnung,<br />
Sachlichkeit, Nüchternheit, Funktionalität, Kraft, Symmetrie, Maß etc. (vgl. Hausen<br />
1986, Mooraj 2002). Diese Konstellationen werden über Doing-gender-Prozesse<br />
beständig reproduziert – Mädchen wird durch diese Zuordnungen sehr schnell deutlich,<br />
wofür sie qua ihrer Geschlechtsidentität keine Qualifikation besitzen und auch nicht<br />
besitzen dürfen, wollen sie der ‚weiblichen’ Seite angehören.<br />
Das Funktionieren dieser Wirkmechanismen internalisierter Geschlechtercharaktere<br />
zeigt sich in zahlreichen Studien zur Selbst- und Fremdeinschätzung von Mädchen und<br />
Burschen bezüglich Technik. Relativ unabhängig von tatsächlichen Fähigkeiten und<br />
Wissen beurteilen Mädchen die eigenen <strong>technischen</strong> Fähigkeiten als weit geringer als<br />
die gleichaltrigen Burschen, und oft liegt ihre Selbsteinschätzung unterhalb ihres faktischen<br />
Wissens. Diese Geschlechterkonstruktion findet ihre Abstützung in der entsprechenden<br />
Überschätzung männlicher Technikkompetenzen, ebenfalls durch beide Geschlechter<br />
(vgl. bspw. Metz-Göckel et al. 1991).<br />
Wächter (2003) spricht vom „Mythos der weiblichen Technikferne“ (ebd.:45ff). Der<br />
Begriff spricht die dem Mythos eigenen subtilen Wirkungsmechanismen an, die Widersprüche<br />
und Machtverhältnisse verschleiern und in den Status der Unhinterfragbarkeit<br />
heben. Für die Technik existiert in der Alltagswahrnehmung eine Art von „kulturellem<br />
Monopol“, das „nach wie vor und ohne wirkliche Alternative für alle Beteiligten mit<br />
Männlichkeit verknüpft ist“ (Mooraj 2002:111f). Der Ausschluss von Frauen aus dem<br />
Bereich der Technik auf der symbolischen Ebene wird gewissermaßen als ein natürlicher<br />
entworfen. Roloff (1996:44) beschreibt die Funktion solcher Ausgrenzungsmechanismen<br />
gegenüber Frauen mit dem Interesse der herrschenden Gruppe an der Sicherung<br />
bestehender Machtverhältnisse:<br />
16