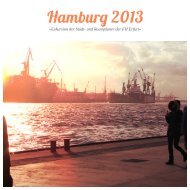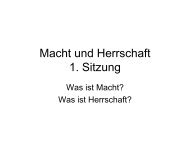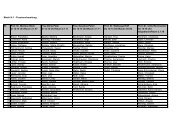Verelendungstheorie – die hilflose Kapitalismuskritik
Verelendungstheorie – die hilflose Kapitalismuskritik
Verelendungstheorie – die hilflose Kapitalismuskritik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erster Teil<br />
Darstellung und Kritik der <strong>Verelendungstheorie</strong><br />
I. Die <strong>Verelendungstheorie</strong> bei Karl Marx und seinen Zeitgenossen<br />
Es ist ungeklärt, wann und von wem erstmals der Begriff ><strong>Verelendungstheorie</strong>< in der Literatur<br />
benutzt wurde. Bei Marx und Engels taucht er jedenfalls nirgendwo auf. 3<br />
Was das Wort benennt, <strong>die</strong> Theorie, daß der sich entwickelnde Kapitalismus trotz des sprunghaf-<br />
ten Wachstums in der Masse der produzierten Güter denjenigen, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Güter produzieren,<br />
keine Verbesserung, sondern im Gegenteil eine Verschlechterung in ihrer Lage bringt, dafür fin-<br />
den sich in ihrem Werk viele Belege. Allerdings sind sie zu ihrer Zeit nicht <strong>die</strong> einzigen und kei-<br />
nesfalls <strong>die</strong> profiliertesten Vertreter einer solchen <strong>Verelendungstheorie</strong>: Schon im 18. Jahrhundert<br />
regte das beobachtete Paradoxon zwischen immens gesteigertem Güterausstoß und gleichzeitiger<br />
Verschlechterung im Einkommen und in der gesamten Lebenslage der Manufakturarbeiter zur<br />
Theoriebildung an. So formulierte Turgot bereits 1766:<br />
»Infolge der gegenseitigen Konkurrenz der Arbeiter untereinander bleibt der Arbeitslohn auf das<br />
Existenzminimum beschränkt. Die Arbeiter müssen ihre Ansprüche um <strong>die</strong> Wette herabsetzen.<br />
So kommt es dann tatsächlich in allen Arbeitszweigen schließlich so weit, daß der Lohn nur ge-<br />
rade hoch genug ist, um dem Arbeiter seine Subsistenzmittel zu beschaffen.« 4 '<br />
Während sich in England und Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine umfang-<br />
reiche Literatur mit vielfältigen Theorien über <strong>die</strong> Gründe und Entwicklungstendenzen des Arbei-<br />
terelends entwickelte, konnte man in Deutschland erst in den siebziger und achtziger Jahren von<br />
einer wissenschaftlichen Literatur zu dem Problem reden, das unter dem Titel >Die soziale Frage<br />
behandelt wurde.<br />
Die schärfsten Versionen der <strong>Verelendungstheorie</strong> finden sich immer dann, wenn <strong>die</strong> Theorie im<br />
Zusammenhang mit der Malthusianischen Bevölkerungslehre konstruiert wurde, wo-<br />
3 Meine Recherchen nach dem Ursprung der Bezeichnung blieben erfolglos. Der einzige Hinweis, den ich gefunden<br />
habe, stammt von Karl Kautsky und ist lediglich negativ: »Ebenso wenig, wie <strong>die</strong> Worte Zusammenbruchstheorie<<br />
und >Katastrophentheorie< stammt das Wort ><strong>Verelendungstheorie</strong>< von Marx oder Engels her, sondern von Kritikern<br />
ihrer Anschauungen (Bernstein und das Sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik; Stuttgart 1899, S.<br />
114). Werner Hofmann, Sozialökonomische Stu<strong>die</strong>ntexte, 3 Bände, Berlin 1965, 2. Bd., S. 150, datiert das Wort<br />
direkt auf Bernstein,<br />
4 Zit. nach dem übersetzten Zitat in: Robert Michels, Die <strong>Verelendungstheorie</strong>. Stu<strong>die</strong>n und Untersuchungen zur<br />
internationalen Dogmengeschichte der Volkswirtschaft, Leipzig 1928, S. 15.<br />
13