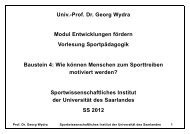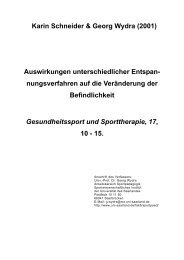Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sportunterricht <strong>zwischen</strong> <strong>schulischer</strong> <strong>Pflicht</strong> und freizeitlicher Spaßorientierung 42<br />
Grössing (1997a) liefert drei Begründungen für sein Konzept der Bewegungskultur:<br />
♦ Gründe, die in der veränderten Lebenswelt der Kinder zu suchen sind<br />
und eine andere Form der Bewegungserziehung erfordern,<br />
♦ Anthropologische Gründe, die aufzeigen, dass der Mensch als kulturell<br />
geprägtes und kulturschaffendes Lebewesen auch den Kulturbezirk<br />
Bewegungskultur sich nur über Erziehung zu eigen machen kann,<br />
♦ Fachwissenschaftliche Gründe, die für eine Ablösung des zu schmalen<br />
Sportbegriffes und Zuwendung zum zentralen Phänomen Bewegung<br />
sprechen.<br />
Die Lebenswelt von Kindern hat sich in den letzten Jahrzehnten vollkommen<br />
verändert. Kinder wachsen relativ behütet in einem nie gekannten<br />
Wohlstand auf. Auf der anderen Seite werden Kinder aber auch mit<br />
zahlreichen Belastungen konfrontiert: Gewalt, Drogen, Bewegungsarmut,<br />
Reizüberflutung etc. Kinder erleben ihre Kindheit heute vorwiegend aus<br />
zweiter Hand über den Konsum. Selbst in ländlichen Bereichen leben die<br />
Kinder heute nicht anders als in den Städten. Authentische Naturerlebnisse<br />
werden kaum noch gesammelt. Sinneseindrücke werden reduziert<br />
auf optische und akustische Wahrnehmungen, während Geschmacks-,<br />
Tast-, Muskel-, Tiefen-, Geruchs- und Hautsinn kaum noch gefordert<br />
werden. „Kindern wird viel erlaubt und wenig untersagt, viel in die Eigenentscheidung<br />
übertragen und wenig aufgetragen“ (Grössing, 1997a, S.<br />
41). Ein Zuviel an Freiheit kann auch zu Überforderungen führen, wodurch<br />
Aggressivität entstehen kann. Die Zeit der Kinder ist verplant. Neben<br />
dem Schulstress ist bei vielen Kindern am Nachmittag der Freizeitstress<br />
zu beobachten. Das Leben der Kinder spielt sich an verschiedenen<br />
räumlich voneinander zum Teil weit entfernten Orten ab. Kinder erobern<br />
ihre Umwelt nicht mehr mit eigener Kraft und den eigenen Sinnen (vgl.<br />
Hurrelmann, 1994).<br />
Aus dieser Analyse der Lebenswelt ergeben sich vier Prinzipien für die<br />
Gestaltung des Unterrichts (Grössing 1997a, S. 42 - 43):<br />
♦ Prinzip der Vielseitigkeit: Die Vielfalt der menschlichen Bewegungskultur<br />
hat sich im Unterricht zu spiegeln, wobei die Sinn-, Situations-<br />
und Sozialvielfalt menschlicher Bewegungstätigkeiten in exemplarischer<br />
und didaktischer Auswahl an den Schüler heranzubringen<br />
sind. „Vielseitige Bewegungserziehung soll verhindern, daß Bewegungskarrieren<br />
nicht so verlaufen, daß aus der Vielfalt des bewegungskulturellen<br />
Handelns im Kindesalter die Einseitigkeit des Alterssports<br />
wird“ (Grössing 1997a, S. 43).