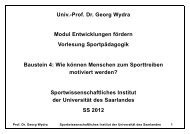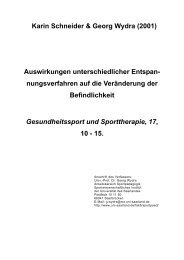Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Georg Wydra Sportpädagogik zwischen schulischer Pflicht ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sportunterricht <strong>zwischen</strong> <strong>schulischer</strong> <strong>Pflicht</strong> und freizeitlicher Spaßorientierung 50<br />
visuelle Wahrnehmung, bieten aber keinerlei authentische Erfahrungen:<br />
Sie sind nicht zu riechen, zu schmecken, zu tasten oder zu fühlen.<br />
Doch für die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt braucht das<br />
Kind Körper- und Bewegungserfahrungen. Dieser Mangel an elementaren<br />
Erfahrungen kann zu Störungen in der Wahrnehmung, zu Verhaltensauffälligkeiten<br />
und zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Was Kindern<br />
heute fehlt, ist weniger die organisierte Spiel- und Bewegungsstunde,<br />
als vielmehr der Freiraum für eigenverantwortliches Handeln, freies<br />
Entdecken und Erkunden, sowie das selbständige Gestalten und Verändern<br />
vorgegebener Zustände (vgl. Zimmer, 1993).<br />
Schwerpunkte der psychomotorischen Arbeit sind die Wahrnehmung (optisch,<br />
akustisch, taktil, kinästhetisch), die Körperkontrolle (Gleichgewicht,<br />
Entspannung), die Differenzierung und Erweiterung von Bewegungsmustern,<br />
der Umgang mit Materialien, die Verminderung von aggressiven<br />
Verhaltenstendenzen, die soziale Kommunikation und Interaktion.<br />
Die für den Außenstehenden verwirrende Vielzahl psychomotorischer<br />
Ziele kann in drei elementare Kompetenzbereiche strukturiert werden:<br />
Ich-, Sach- und Sozialkompetenz.<br />
♦ Unter Ich-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, sich selbst als Bestandteil<br />
der Welt bewusst wahrnehmen zu können. Ich-Kompetenz<br />
bedeutet, dass Kinder einen Zugang zu sich selbst, zu ihrem eigenen<br />
Körper, zu ihrem eigenen Verhalten und damit auch einen Zugang zur<br />
Umwelt erlangen. Die Kinder lernen über Rückmeldungen sich selbst<br />
realistisch einzuschätzen und bilden ihr Selbst-Konzept aus. Die Ich-<br />
Kompetenz stellt die Grundlage für die anderen Kompetenzen dar.<br />
Dem Aspekt der Ich-Kompetenz kommt in den folgenden Betrachtungen<br />
eine besondere Bedeutung zu.<br />
♦ Unter Sach-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, sich mit den<br />
dinglichen Aspekten der Umwelt auseinanderzusetzen. Das Sammeln<br />
von Materialerfahrungen über Beobachtung, Ausprobieren und das<br />
Verändern der Umwelt stellt eine Grundlage für die kognitive Entwicklung<br />
dar. Denken vollzieht sich nach Zimmer und Cicurs (1987,<br />
S. 91) zunächst in Form des aktiven Handelns. Über das praktische<br />
Lösen von Problemen kommt das Kind zum Verstehen. Erst in einem<br />
nächsten Schritt sind Abstraktionen möglich. Diese wiederum stellen<br />
die Grundlage für die Antizipation von Problemlösestrategien dar. Intelligentes<br />
Verhalten basiert in hohem Maße auf praktisch gewonnenen<br />
Erkenntnissen.<br />
♦ Unter Sozial-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, mit anderen<br />
Menschen in Kontakt treten zu können, mit ihnen kommunizieren, interagieren<br />
und kooperieren zu können. Gerade in der heutigen Zeit, in