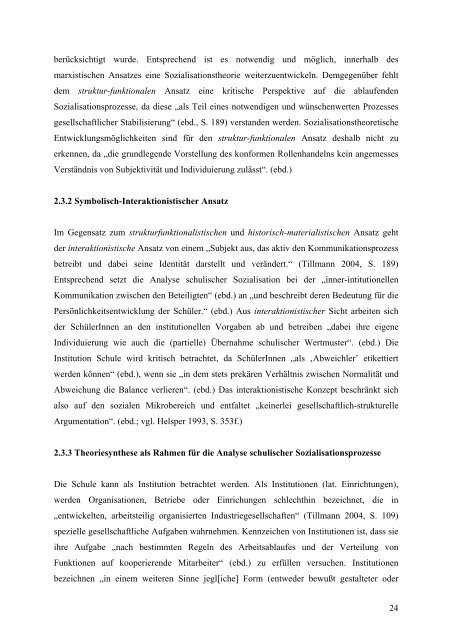Demokratische Sozialisation in der Schule - Initiative Bildung in ...
Demokratische Sozialisation in der Schule - Initiative Bildung in ...
Demokratische Sozialisation in der Schule - Initiative Bildung in ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
erücksichtigt wurde. Entsprechend ist es notwendig und möglich, <strong>in</strong>nerhalb des<br />
marxistischen Ansatzes e<strong>in</strong>e <strong>Sozialisation</strong>stheorie weiterzuentwickeln. Demgegenüber fehlt<br />
dem struktur-funktionalen Ansatz e<strong>in</strong>e kritische Perspektive auf die ablaufenden<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesse, da diese „als Teil e<strong>in</strong>es notwendigen und wünschenwerten Prozesses<br />
gesellschaftlicher Stabilisierung“ (ebd., S. 189) verstanden werden. <strong>Sozialisation</strong>stheoretische<br />
Entwicklungsmöglichkeiten s<strong>in</strong>d für den struktur-funktionalen Ansatz deshalb nicht zu<br />
erkennen, da „die grundlegende Vorstellung des konformen Rollenhandelns ke<strong>in</strong> angemesses<br />
Verständnis von Subjektivität und Individuierung zulässt“. (ebd.)<br />
2.3.2 Symbolisch-Interaktionistischer Ansatz<br />
Im Gegensatz zum strukturfunktionalistischen und historisch-materialistischen Ansatz geht<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>teraktionistische Ansatz von e<strong>in</strong>em „Subjekt aus, das aktiv den Kommunikationsprozess<br />
betreibt und dabei se<strong>in</strong>e Identität darstellt und verän<strong>der</strong>t.“ (Tillmann 2004, S. 189)<br />
Entsprechend setzt die Analyse schulischer <strong>Sozialisation</strong> bei <strong>der</strong> „<strong>in</strong>ner-<strong>in</strong>titutionellen<br />
Kommunikation zwischen den Beteiligten“ (ebd.) an „und beschreibt <strong>der</strong>en Bedeutung für die<br />
Persönlichkeitsentwicklung <strong>der</strong> Schüler.“ (ebd.) Aus <strong>in</strong>teraktionistischer Sicht arbeiten sich<br />
<strong>der</strong> SchülerInnen an den <strong>in</strong>stitutionellen Vorgaben ab und betreiben „dabei ihre eigene<br />
Individuierung wie auch die (partielle) Übernahme schulischer Wertmuster“. (ebd.) Die<br />
Institution <strong>Schule</strong> wird kritisch betrachtet, da SchülerInnen „als ‚Abweichler’ etikettiert<br />
werden können“ (ebd.), wenn sie „<strong>in</strong> dem stets prekären Verhältnis zwischen Normalität und<br />
Abweichung die Balance verlieren“. (ebd.) Das <strong>in</strong>teraktionistische Konzept beschränkt sich<br />
also auf den sozialen Mikrobereich und entfaltet „ke<strong>in</strong>erlei gesellschaftlich-strukturelle<br />
Argumentation“. (ebd.; vgl. Helsper 1993, S. 353f.)<br />
2.3.3 Theoriesynthese als Rahmen für die Analyse schulischer <strong>Sozialisation</strong>sprozesse<br />
Die <strong>Schule</strong> kann als Institution betrachtet werden. Als Institutionen (lat. E<strong>in</strong>richtungen),<br />
werden Organisationen, Betriebe o<strong>der</strong> E<strong>in</strong>richungen schlechth<strong>in</strong> bezeichnet, die <strong>in</strong><br />
„entwickelten, arbeitsteilig organisierten Industriegesellschaften“ (Tillmann 2004, S. 109)<br />
spezielle gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen. Kennzeichen von Institutionen ist, dass sie<br />
ihre Aufgabe „nach bestimmten Regeln des Arbeitsablaufes und <strong>der</strong> Verteilung von<br />
Funktionen auf kooperierende Mitarbeiter“ (ebd.) zu erfüllen versuchen. Institutionen<br />
bezeichnen „<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren S<strong>in</strong>ne jegl[iche] Form (entwe<strong>der</strong> bewußt gestalteter o<strong>der</strong><br />
24