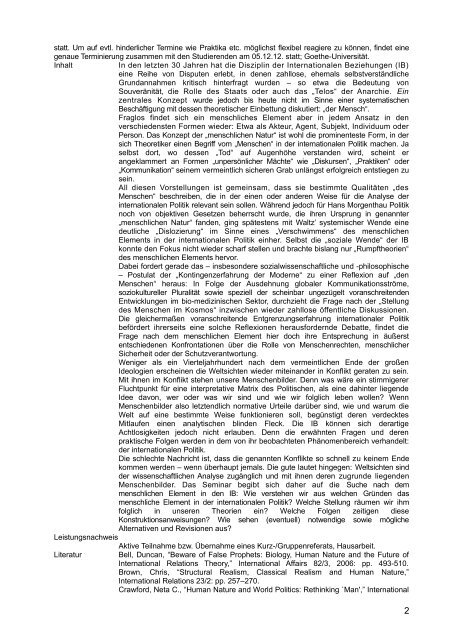Komm. Vorlesungsverzeichnis M.A. ISFK WS 2012/13 - Goethe ...
Komm. Vorlesungsverzeichnis M.A. ISFK WS 2012/13 - Goethe ...
Komm. Vorlesungsverzeichnis M.A. ISFK WS 2012/13 - Goethe ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
statt. Um auf evtl. hinderlicher Termine wie Praktika etc. möglichst flexibel reagiere zu können, findet eine<br />
genaue Terminierung zusammen mit den Studierenden am 05.12.12. statt; <strong>Goethe</strong>-Universität.<br />
Inhalt In den letzten 30 Jahren hat die Disziplin der Internationalen Beziehungen (IB)<br />
eine Reihe von Disputen erlebt, in denen zahllose, ehemals selbstverständliche<br />
Grundannahmen kritisch hinterfragt wurden – so etwa die Bedeutung von<br />
Souveränität, die Rolle des Staats oder auch das „Telos“ der Anarchie. Ein<br />
zentrales Konzept wurde jedoch bis heute nicht im Sinne einer systematischen<br />
Beschäftigung mit dessen theoretischer Einbettung diskutiert: „der Mensch“.<br />
Fraglos findet sich ein menschliches Element aber in jedem Ansatz in den<br />
verschiedensten Formen wieder: Etwa als Akteur, Agent, Subjekt, Individuum oder<br />
Person. Das Konzept der „menschlichen Natur“ ist wohl die prominenteste Form, in der<br />
sich Theoretiker einen Begriff vom „Menschen“ in der internationalen Politik machen. Ja<br />
selbst dort, wo dessen „Tod“ auf Augenhöhe verstanden wird, scheint er<br />
angeklammert an Formen „unpersönlicher Mächte“ wie „Diskursen“, „Praktiken“ oder<br />
„<strong>Komm</strong>unikation“ seinem vermeintlich sicheren Grab unlängst erfolgreich entstiegen zu<br />
sein.<br />
All diesen Vorstellungen ist gemeinsam, dass sie bestimmte Qualitäten „des<br />
Menschen“ beschreiben, die in der einen oder anderen Weise für die Analyse der<br />
internationalen Politik relevant sein sollen. Während jedoch für Hans Morgenthau Politik<br />
noch von objektiven Gesetzen beherrscht wurde, die ihren Ursprung in genannter<br />
„menschlichen Natur“ fanden, ging spätestens mit Waltz’ systemischer Wende eine<br />
deutliche „Dislozierung“ im Sinne eines „Verschwimmens“ des menschlichen<br />
Elements in der internationalen Politik einher. Selbst die „soziale Wende“ der IB<br />
konnte den Fokus nicht wieder scharf stellen und brachte bislang nur „Rumpftheorien“<br />
des menschlichen Elements hervor.<br />
Dabei fordert gerade das – insbesondere sozialwissenschaftliche und -philosophische<br />
– Postulat der „Kontingenzerfahrung der Moderne“ zu einer Reflexion auf „den<br />
Menschen“ heraus: In Folge der Ausdehnung globaler <strong>Komm</strong>unikationsströme,<br />
soziokultureller Pluralität sowie speziell der scheinbar ungezügelt voranschreitenden<br />
Entwicklungen im bio-medizinischen Sektor, durchzieht die Frage nach der „Stellung<br />
des Menschen im Kosmos“ inzwischen wieder zahllose öffentliche Diskussionen.<br />
Die gleichermaßen voranschreitende Entgrenzungserfahrung internationaler Politik<br />
befördert ihrerseits eine solche Reflexionen herausfordernde Debatte, findet die<br />
Frage nach dem menschlichen Element hier doch ihre Entsprechung in äußerst<br />
entschiedenen Konfrontationen über die Rolle von Menschenrechten, menschlicher<br />
Sicherheit oder der Schutzverantwortung.<br />
Weniger als ein Vierteljahrhundert nach dem vermeintlichen Еnde der großen<br />
Ideologien erscheinen die Weltsichten wieder miteinander in Konflikt geraten zu sein.<br />
Mit ihnen im Konflikt stehen unsere Мenschenbilder. Denn was wäre ein stimmigerer<br />
Fluchtpunkt für eine interpretative Matrix des Politischen, als eine dahinter liegende<br />
Idee davon, wer oder was wir sind und wie wir folglich leben wollen? Wenn<br />
Мenschenbilder also letztendlich normative Urteile darüber sind, wie und warum die<br />
Welt auf eine bestimmte Weise funktionieren soll, begünstigt deren verdecktes<br />
Mitlaufen einen analytischen blinden Fleck. Die IB können sich derartige<br />
Achtlosigkeiten jedoch nicht erlauben. Denn die erwähnten Fragen und deren<br />
praktische Folgen werden in dem von ihr beobachteten Phänomenbereich verhandelt:<br />
der internationalen Politik.<br />
Die schlechte Nachricht ist, dass die genannten Konflikte so schnell zu keinem Ende<br />
kommen werden – wenn überhaupt jemals. Die gute lautet hingegen: Weltsichten sind<br />
der wissenschaftlichen Analyse zugänglich und mit ihnen deren zugrunde liegenden<br />
Мenschenbilder. Das Seminar begibt sich daher auf die Suche nach dem<br />
menschlichen Element in den IB: Wie verstehen wir aus welchen Gründen das<br />
menschliche Element in der internationalen Politik? Welche Stellung räumen wir ihm<br />
folglich in unseren Theorien ein? Welche Folgen zeitigen diese<br />
Konstruktionsanweisungen? Wie sehen (eventuell) notwendige sowie mögliche<br />
Alternativen und Revisionen aus?<br />
Leistungsnachweis<br />
Aktive Teilnahme bzw. Übernahme eines Kurz-/Gruppenreferats, Hausarbeit.<br />
Literatur Bell, Duncan, “Beware of False Prophets: Biology, Human Nature and the Future of<br />
International Relations Theory,” International Affairs 82/3, 2006: pp. 493-510.<br />
Brown, Chris, “Structural Realism, Classical Realism and Human Nature,”<br />
International Relations 23/2: pp. 257–270.<br />
Crawford, Neta C., “Human Nature and World Politics: Rethinking `Man',” International<br />
2