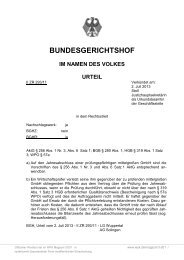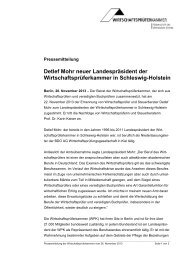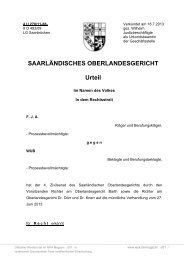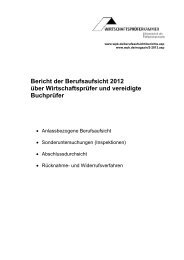WPK Mag 1-08 - Wirtschaftsprüferkammer
WPK Mag 1-08 - Wirtschaftsprüferkammer
WPK Mag 1-08 - Wirtschaftsprüferkammer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
52 Aus der Rechtsprechung <strong>WPK</strong> <strong>Mag</strong>azin 1/20<strong>08</strong><br />
Sachverhalt<br />
Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH. Die Beklagte war<br />
seit Mitte der 80er Jahre für die GmbH als Abschlussprüferin<br />
und Steuerberaterin tätig. Ende 1989 beschlossen der Kläger<br />
und sein Mitgeschäftsführer, die Anteilsmehrheit an der GmbH<br />
zu übernehmen. Der Kläger erwarb Geschäftsanteile, die einer<br />
Beteiligung von 15,5% entsprachen. 1996 wurde die GmbH auf<br />
eine neue GmbH als übernehmender Rechtsträger verschmolzen,<br />
die neue GmbH sodann umfirmiert. 2001 veräußerte der<br />
Kläger seine Geschäftsanteile an ein US-Unternehmen. 2004<br />
erließ das Finanzamt gegenüber dem Kläger einen Einkommensteuerbescheid<br />
für 2001, wonach der Kläger Einkommensteuer<br />
nachzuzahlen hatte. Der Einspruch gegen den Steuerbescheid<br />
blieb ohne Erfolg. Der Kläger meint, die Beklagte habe<br />
ihn im Zusammenhang mit der Veräußerung der Geschäftsanteile<br />
dahingehend falsch beraten, dass Gewinne aus dem Verkauf<br />
der Anteile nicht zu versteuern seien. Das Landgericht hat<br />
die Klage abgewiesen.<br />
Wesentliche Entscheidungsgründe<br />
Die Berufung des Klägers bleibt ohne Erfolg.<br />
1. Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass<br />
das Zustandekommen eines (Steuerberatungs-)Vertrages<br />
vom Kläger nicht bewiesen worden ist.<br />
Unstreitig ist ein schriftlicher Vertrag nicht geschlossen<br />
worden. Ein Steuerberatungsvertrag kann aber auch durch<br />
schlüssiges Verhalten der Vertragsparteien geschlossen werden.<br />
Dies setzt voraus, dass aufgrund einer umfassenden Gesamtwürdigung<br />
aller Umstände des Einzelfalls das Verhalten<br />
des Auftraggebers vom Steuerberater nach Treu und<br />
Glauben als entsprechendes Vertragsangebot zu werten ist<br />
und sein eigenes nachfolgendes Verhalten als dessen Annahme<br />
gedeutet werden darf. Insoweit sind im Interesse der<br />
Rechtssicherheit strenge Anforderungen zu stellen.<br />
Im Vortrag des Klägers fehlen schon Angaben dazu, durch<br />
welche Erklärungen oder welches tatsächliches Tun Angebot<br />
und Annahme erklärt worden sein sollen. Die vom Kläger<br />
bezeichneten Indizien rechtfertigen keinesfalls den<br />
Abschluss eines Steuerberatungsvertrages zwischen den<br />
Parteien.<br />
Aus an die GmbH gerichteten Rechnungen und beigefügten<br />
Stundennachweisen, die nur stichwortartig die erfasste<br />
Tätigkeit der Beklagten bezeichnen, ergibt sich nicht,<br />
dass die Beklagte gerade für den Kläger und nicht für die<br />
GmbH tätig geworden ist. Nichts anderes gilt für das<br />
Schreiben der Beklagten an die Rechtsanwälte im Zuge der<br />
Veräußerung der GmbH-Geschäftsanteile. Es liegt auf der<br />
Hand, dass die Veräußerung sowohl die Interessen des<br />
Klägers als auch der GmbH berührten.<br />
2. Der Vertrag zwischen der GmbH und der Beklagten stellt<br />
auch weder einen Vertrag zugunsten des Klägers noch einen<br />
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Klägers dar.<br />
Von vornherein kommt die Annahme eines echten, berechtigenden<br />
Vertrages zugunsten Dritter nicht in Be-<br />
tracht. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Kläger als<br />
Dritter (und nicht in seiner Funktion als für die GmbH<br />
handelnder Geschäftsführer) nach dem übereinstimmenden<br />
Willen der Vertragsparteien einen eigenen Anspruch<br />
gegen die Beklagte „unmittelbar“ (§ 328 Abs. 1 BGB) hätte<br />
erwerben sollen. Der Vertrag zwischen der Beklagten und<br />
der GmbH stellt aber auch keinen Vertrag mit Schutzwirkung<br />
zugunsten Dritter – hier des Klägers – dar.<br />
Die Praxis hat mehrere Kriterien entwickelt, die den<br />
Zweck verfolgen, eine angemessene Begrenzung des Drittschutzes<br />
auf bestimmte Personenkreise zu erreichen, nämlich<br />
Leistungsnähe, Gläubigernähe und Erkennbarkeit. Der<br />
Dritte muss der Leistung des Schuldners so nahe stehen,<br />
dass er mehr oder minder zwangsläufig mit ihr in Berührung<br />
kommt, was vorliegend allenfalls für einen Teilbereich<br />
der Leistung der Beklagten gelten kann. Außerdem<br />
muss der Dritte dem Gläubiger so nahe stehen, dass dem<br />
Gläubiger eine ordnungsgemäße Erfüllung aller Hauptund<br />
Nebenpflichten gegenüber dem Dritten so wichtig ist<br />
wie gegenüber sich selbst, insbesondere, weil der Gläubiger<br />
für das „Wohl und Wehe“ des Dritten mitverantwortlich<br />
ist und diesem Schutz und Fürsorge schuldet.<br />
Schließlich muss diese besondere Nähe für den Schuldner<br />
erkennbar sein.<br />
Die „Wohl und Wehe“-Rechtsprechung des BGH passt auf<br />
das Verhältnis von Kapitalgesellschaft und Gesellschafter<br />
von vornherein nicht. Es müsste nämlich die GmbH sozusagen<br />
für das Wohl und Wehe des Dritten mitverantwortlich<br />
sein, weil deren Schädigung auch ihn trifft, indem sie ihm<br />
gegenüber zu Schutz und Fürsorge verpflichtet ist (vgl.<br />
BGHZ 51, 91, 96), was am ehesten für die familienrechtliche<br />
Unterhalts- und Fürsorgepflicht gilt, nicht aber für das Verhältnis<br />
der GmbH zu ihren Gesellschaftern und Geschäftsführern.<br />
Der Bundesgerichtshof hat nicht nur darauf hingewiesen,<br />
dass die Ausweitung vertraglicher Sorgfaltspflichten<br />
über den Kreis der Vertragsparteien hinaus von<br />
vornherein nur in engen Grenzen in Betracht kommen kann.<br />
er hat darüber hinausgehend betont, dass bei bloßen Sachund<br />
Vermögensschäden ein besonders strenger Maßstab zu<br />
gelten hat (BGH, NJW 1968, 1929, 1931).<br />
Der BGH ist in letzter Zeit zunehmend zurückhaltend damit,<br />
Dritte in den Schutzbereich eines Vertrages einzubeziehen,<br />
insbesondere dort, wo es lediglich um Vermögensschäden<br />
geht. In einem Urteil vom 6.4.2006 - III ZR 256/04 (<strong>WPK</strong><br />
<strong>Mag</strong>. 3/2007, Seite 41) spricht er im Zusammenhang mit der<br />
Dritthaftung von Wirtschaftsprüfern für falsche Testate ausdrücklich<br />
von einer „restriktiven“ Anwendung der Grundsätze<br />
der vertraglichen Dritthaftung. Hohe Anforderungen<br />
an eine Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich eines<br />
Vertrages finden sich auch in einem weiteren Urteil vom<br />
15.12.2005 - III ZR 424/04 (<strong>WPK</strong> <strong>Mag</strong>. 3/2007, Seite 40).<br />
Die Entscheidung wurde redaktionell überarbeitet.<br />
Den offiziellen Wortlaut finden Sie unter ➛ www.wpk.de/magazin/1-20<strong>08</strong>/