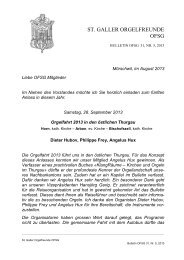ST. GALLER ORGELFREUNDE OFSG
ST. GALLER ORGELFREUNDE OFSG
ST. GALLER ORGELFREUNDE OFSG
- TAGS
- galler
- orgelfreunde
- ofsg
- ofsg.org
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
47<br />
Entsprechend seiner elsässischen Herkunft fühlte sich Bergöntzle der französischen<br />
Orgelbautradition verpflichtet mit französischem Gehäuse und französisch beeinflussten<br />
Dispositionen: im Hauptwerk 16', Cornet décomposé und Cornet 5-fach, Zungen 8' und 4'<br />
im Pedal. Auch die Bauart der Metallpfeifen und die starken Wandungen aus niedrig<br />
legiertem, gehämmertem Orgelmetall entsprechen der französischen Bauweise. 9<br />
Allerdings vertritt Bergöntzle als elsässischer Orgelbauer weniger die vornehmere<br />
Silbermann-Linie, sondern eher die rustikale Variante von Valtrin-Dubois, was sich in etwas<br />
bescheideneren Dispositionen und in teilweise einfacheren Konstruktionen zeigt. Auch die<br />
Gehäuse sind bei Bergöntzle weniger kühn als bei Johann Andreas Silbermann und<br />
entsprechen in der Form eher dem "älteren Modell" von Vater Andreas Silbermann. Zudem<br />
weist das kurze Pedal auf eine Ähnlichkeit mit Waltrin, Dubois oder Besançon (St.<br />
Ursanne), während Johann Andreas Silbermann meist grosse Pedale baute – für<br />
anspruchsvollere Organisten.<br />
Die Bergöntzle-Orgel von 1803/1804<br />
Über den Auftrag zum Bau einer Orgel, den die Pfarrgemeinde an Bergöntzle erteilte,<br />
sind keine Schriftstücke erhalten. Es bleibt daher offen, ob das Gehäuse nach<br />
Angaben Bergöntzles an Ort geschaffen wurde oder ob es aus einem anlässlich der<br />
Revolution aufgehobenen Kloster im Elsass stammt [4, 2]. Zwar entspräche die<br />
Verwendung von Hartholz (Eichenholz), wie sie hier am Gehäuse erfolgte, nicht nur<br />
der Vorliebe Bergöntzles, sondern wäre auch für die Region typisch. Es fällt aber auf,<br />
dass die Orgel in Bludesch innert kürzester Zeit besorgt und aufgestellt war, dies in<br />
einer Zeit, zu der Bergöntzle alle Hände voll zu tun hatte. So ist eher<br />
unwahrscheinlich, dass das Orgelgehäuse am Ort von Bergöntzle selbst oder nach<br />
dessen Anleitung von einem Schreiner aus der näheren Umgebung gebaut wurde<br />
[Jussel, 2]. Schon Krauss hat in den 1940er Jahren aufgrund des Gehäuses und der<br />
Bauweise von Pfeifen und Windladen das Werk als typische Silbermann-Arbeit aus<br />
der Zeit von 1720–30 10 beurteilt. Anhand von Spuren am Rückpositiv-Gehäuse gilt<br />
heute als gesichert, dass sich die Orgel vorher an einem andern Ort befand und 1803<br />
von Bergöntzle für die Kirche Bludesch angepasst wurde. Vermutlich war sie in den<br />
Jahren 1780–85 erbaut und noch vor der Französischen Revolution aus dem Elsass<br />
als "Gebrauchtinstrument" ins Vorarlberg transportiert worden.<br />
Bis zur Restauration 1997–1999 war man auch der Ansicht, dass zumindest das<br />
Innere der Orgel von Bergöntzle eigens für Bludesch erbaut wurde. Dazu G. Jussel:<br />
Im Zuge des Abbaues der Orgel und insbesonders der Bearbeitung durch Ferdinand<br />
Stemmer hat sich herausgestellt, daß die Bludescher Bergöntzle-Orgel keineswegs ein<br />
Orgelwerk darstellt, welches für Bludesch gearbeitet und 1803/1804 in der Pfarrkirche St.<br />
Jakob eingebaut wurde. Diese Orgel ist [...] unbestritten älter; sie wurde auch nicht „aus<br />
einem Stück in einer Orgelwerkstatt gebaut“, sondern besteht aus mehreren Teilen<br />
unterschiedlicher Herkunft. Dies ist vielleicht auch der Grund, warum kein Werkvertrag, der<br />
an sich schon vor Silbermanns Zeiten zum Orgelbauen gehört, auffindbar ist [2].<br />
9 Die Orgel in Bartholomäberg (Montafon/Vorarlberg) wurde lange Zeit auch Bergöntzle<br />
zugeschrieben. Da Bergöntzle zur Erbauungszeit 1792 noch im heimatlichen Elsass weilte und erst<br />
später vor den Franzosen fliehen musste, kann diese Zuschreibung nicht stimmen, vgl. [1].<br />
Ausserdem besitzt Bartholomäberg nicht die ausgeprägten französischen Merkmale wie Bludesch.<br />
Bartholomäberg stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Erbauer der grossen Orgel von 1779 in<br />
der Klosterkirche Neu St. Johann, nämlich Joh. Michael Grass (vgl. Bulletin <strong>OFSG</strong> 7, Nr. 1, 1989).<br />
10 Es wäre allerdings zu beachten, dass die Waltrin-Dubois-Tradition auch später noch Gehäuse im<br />
älteren Stil baute (F.L.).<br />
Bulletin <strong>OFSG</strong> 21, Nr. 3, 2003