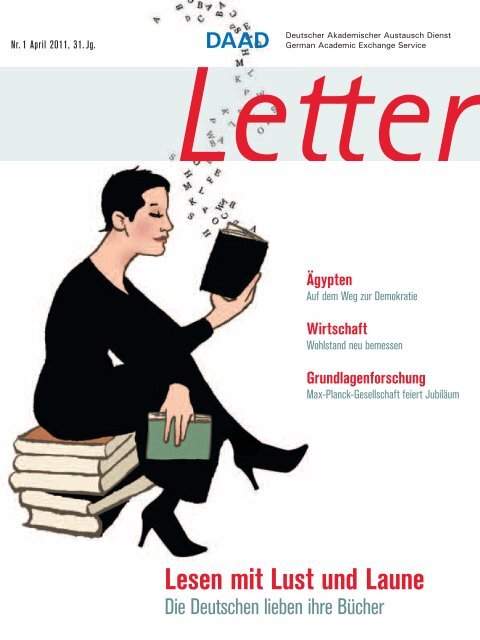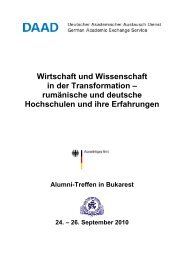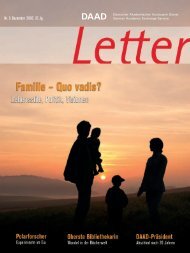Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
- TAGS
- lust
- laune
- www.daad-magazin.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 1 april 2011, 31.Jg.<br />
Ägypten<br />
Auf dem Weg zur Demokratie<br />
Wirtschaft<br />
Wohlstand neu bemessen<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
Max-Planck-Gesellschaft feiert Jubiläum<br />
<strong>Lesen</strong> <strong>mit</strong> <strong>Lust</strong> <strong>und</strong> <strong>Laune</strong><br />
Die Deutschen lieben ihre Bücher
© <strong>DAAD</strong><br />
© axeptDESIGN.de<br />
Gestaltung: axeptDESIGN.de | © <strong>DAAD</strong> Oktober 2010<br />
2<br />
iNhalt<br />
Studienaufenthalte <strong>und</strong><br />
Praktika im Ausland<br />
Plakat_Goout_mal_raus.indd 2 07.04.11 15:39<br />
Gefragte Beobachterin:<br />
Ulrike Freitag leitet das Zentrum<br />
Moderner Orient in Berlin<br />
S.40<br />
titel:<br />
Bücher:<br />
Kulturgut in Deutschland<br />
S.12<br />
Ein Begriff:<br />
Hörforschung in Oldenburg<br />
S.20<br />
Mehr Bedeutung:<br />
Lebensqualität statt grenzenloses<br />
Wachstum<br />
S.24<br />
In Bewegung:<br />
Die Ferne lockt Studierende<br />
S.18<br />
© Daniel Jaeger Vendruscolo<br />
© Oldenburg Tourismus u. Marketing GmbH/Verena Brandt<br />
© David Ausserhofer<br />
<strong>DAAD</strong> Letter – Das Magazin für <strong>DAAD</strong>-Alumni<br />
Dialog Seite 4<br />
Unsere Aufgabe beginnt jetzt<br />
Ägyptische Stipendiaten unterstützen die Demokratie 4<br />
Kleine Schritte zum Wandel<br />
Diskussion über Green Economy 6<br />
<strong>DAAD</strong>-Standpunkt<br />
Umbrüche im Nahen Osten 7<br />
Spektrum Deutschland Seite 8<br />
EinBlick – Deutschland im Bild<br />
Waldspaziergang 8<br />
Nachrichten 10<br />
Titel Seite 12<br />
Heute schon geschmökert?<br />
Deutschland ist immer noch Leseland –<br />
Bücher stehen hoch im Kurs 12<br />
Bibliotheken multimedial<br />
Interview <strong>mit</strong> Ulrich Korwitz, Direktor der Deutschen<br />
Zentralbibliothek für Medizin in Köln <strong>und</strong> Bonn 16<br />
Hochschule Seite 17<br />
Neues vom Campus 17<br />
Internationale Erfahrungen<br />
Ausländer in Deutschland <strong>und</strong> Deutsche im Ausland 18<br />
Ortstermin Seite 20<br />
Oldenburg: Magnet im Nordwesten<br />
Wissenschaft Seite 22<br />
Weltberühmte Denkschmiede<br />
Die Max-Planck-Gesellschaft feiert 100 Jahre<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
Trends Seite 24<br />
Auf der Suche nach dem besseren Maß<br />
Neue Indikatoren für eine lebenswerte<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Zukunft<br />
Europa Seite 26<br />
Aufbruch nach Europa<br />
Georgien auf dem Weg in den<br />
europäischen Hochschulraum<br />
Rätsel Seite 28<br />
Sprachecke Seite 29<br />
<strong>DAAD</strong> Report Seite 30<br />
Kritische Geister<br />
Führungsnachwuchs für Afrika 30<br />
Kleine Pflanze <strong>mit</strong> großer Wirkung<br />
Graslandschaften im Klimawandel 32<br />
Stipendiaten forschen 34<br />
Nachrichten 36<br />
Gestern Stipendiatin – <strong>und</strong> heute ...<br />
Ulrike Freitag 40<br />
Köpfe 41<br />
Impressum 42<br />
Deutsche Chronik Seite 43<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
Seit dem 11. März liest die Welt täglich in<br />
Zeitungen <strong>und</strong> im Internet, was Erdbeben<br />
<strong>und</strong> Tsunami in Japan angerichtet haben,<br />
<strong>und</strong> verfolgt gebannt die Nachrichten über<br />
die Atomkatastrophe. Die <strong>DAAD</strong>-Außenstelle<br />
in Tokio wurde zeitweilig geschlossen, viele<br />
Stipendiaten haben das Land verlassen. „Wir<br />
verfolgen <strong>mit</strong> Trauer <strong>und</strong> Sorge, was in Japan<br />
geschieht“, sagt <strong>DAAD</strong>-Generalsekretärin Dorothea<br />
Rüland. Seit Jahrzehnten fördert der<br />
<strong>DAAD</strong> eine große Zahl an Programmen für<br />
Studierende, Graduierte <strong>und</strong> Wissenschaftler<br />
sowie Hochschulpartnerschaften, die alle im<br />
Zeichen des Austauschs <strong>mit</strong> Japan stehen.<br />
Der <strong>DAAD</strong> unterstützt die Hilfsaktion des Verbandes<br />
Deutsch-Japanischer Gesellschaften:<br />
www.vdjg.de<br />
Am 20. März ging die Leipziger Buchmesse<br />
2011 zu Ende – <strong>mit</strong> einem Besucherrekord.<br />
R<strong>und</strong> 163 000 Bücherfre<strong>und</strong>e kamen<br />
innerhalb von vier Tagen in die Messehallen.<br />
Das waren 6 000 mehr als im Vorjahr. Parallel<br />
zur Messe verwandelt sich Leipzig jedes<br />
Jahr in eine große Vorlesebühne. Ob in der<br />
Zahnarztpraxis, einer Bauwollspinnerei, auf<br />
dem Südfriedhof, im Kinderfrühstückscafé, im<br />
Landgericht oder im Zoo: An über 300 Leseorten<br />
lauschten Besucher in diesem Jahr mehr<br />
als 1500 Autoren, die ihre Werke vorstellten.<br />
Deutschland ist ein Leseland <strong>und</strong> immer noch<br />
greifen die Menschen dabei am liebsten zum<br />
gedruckten Buch. Was hält die Leselust so<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
lebendig? Welchen Ursprung haben die beiden<br />
großen deutschen Buchmessen Leipzig im<br />
Frühjahr <strong>und</strong> Frankfurt am Main im Herbst?<br />
Was bedeutet das E-Book für die Fachliteratur?<br />
(Titelgeschichte Seite 12)<br />
Universitäts-, Stadt- <strong>und</strong> Fachbibliotheken<br />
werden vor allem von Schülern, Studierenden<br />
<strong>und</strong> Menschen <strong>mit</strong> kleinem Budget<br />
frequentiert. Öffentliche Bibliotheken <strong>und</strong><br />
der kostenlose Zugang zu Wissen bedeuten<br />
Lebensqualität. Diese Art von Wohlfühlfaktor<br />
trägt allerdings wenig zum Wirtschaftswachstum<br />
bei. Dafür müssten Bibliotheksnutzer<br />
Bücher kaufen statt leihen. Was sagt also das<br />
Wirtschaftswachstum über den Wohlstand<br />
einer Gesellschaft aus? Nicht genug, meinen<br />
Experten. (Seite 24)<br />
© axeptDESIGN.de<br />
Editorial 3<br />
Von fernen Ländern lesen ist ein erster<br />
Schritt hinaus, ein Urlaub in Gegenden<br />
jenseits gewohnter Grenzen ein zweiter. Bleibende<br />
Erfahrungen vom Eintauchen in eine<br />
andere Sprache <strong>und</strong> eine unbekannte Gesellschaft<br />
stellen sich erst <strong>mit</strong> einem längeren<br />
Auslandsaufenthalt ein. Etwa jeden vierten<br />
deutschen Studierenden zieht es in die Welt,<br />
so mobil wie die Deutschen ist keiner der<br />
Nachbarn. Gleichzeitig sind deutsche Hochschulen<br />
<strong>mit</strong> ihren englischsprachigen Studiengängen<br />
<strong>und</strong> der immer besser werdenden<br />
Betreuung ein beliebtes Ziel von Ausländern.<br />
Welchen Einfluss die kürzeren Bachelor- <strong>und</strong><br />
Masterstudiengänge auf die <strong>Lust</strong> nach einem<br />
Studium jenseits der Grenzen haben, erfahren<br />
Sie unter der Rubrik „Hochschule“. (Seite 18)<br />
Bücher dienen nicht nur der Unterhaltung.<br />
Juristische Werke oder Gesetzessammlungen<br />
enthalten die Gr<strong>und</strong>lagen für<br />
menschliches Zusammenleben. Doch sie<br />
nutzen wenig, wenn es an qualifizierten Juristen<br />
mangelt, die Verstöße gegen diese Gesetze<br />
strafrechtlich verfolgen. Juristischen<br />
Nachwuchs auszubilden <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> die künftige<br />
Führungselite seines Landes, ist das Ziel<br />
von Professor Lovell Fernandez. Er ist einer<br />
der Direktoren am Südafrikanisch-Deutschen<br />
Fachzentrum für Entwicklungsforschung <strong>und</strong><br />
Strafjustiz in Kapstadt, das der <strong>DAAD</strong> seit<br />
2008 fördert. Insgesamt fünf solcher Zentren<br />
gibt es in Afrika. Sie wollen künftig enger inhaltlich<br />
zusammenarbeiten. (Seite 30)<br />
Letter modernisiert sein Aussehen. In dieser<br />
Ausgabe haben wir <strong>mit</strong> den Veränderungen begonnen.<br />
Die Letter-Redaktion freut sich über<br />
Ihre Anregungen, Kommentare <strong>und</strong> Kritik. Sie<br />
erreichen uns per E-Mail unter:<br />
spross@trio-medien.de
4 dialog<br />
„Unsere aufgabe beginnt jetzt“<br />
Ägyptische <strong>DAAD</strong>-Stipendiaten unterstützen den Weg zur Demokratie in ihrer Heimat<br />
Sie suchen Freiheit, Demokratie <strong>und</strong> Menschenrechte. Seit der 18-Tage-<br />
Revolution auf dem Tahrir-Platz in Kairo scheint die Zeit einer jungen,<br />
sehr gut ausgebildeten <strong>und</strong> akademisch geprägten Generation anzubrechen.<br />
Zu ihr gehören die Medien- <strong>und</strong> Kommunikationswissenschaftlerin<br />
Hanan Badr, die Molekulare Biotechnologin Yasmine Aguib <strong>und</strong><br />
der Zahnmediziner Karim Fawzy. Als die Menschen in Ägypten auf die<br />
Straße gingen, promovierten oder arbeiteten sie als <strong>DAAD</strong>-Stipendiaten<br />
an deutschen Universitäten, ebenso wie Sherry Basta <strong>und</strong> Yasser Kosper,<br />
die zur Zeit im <strong>DAAD</strong>-Programm „Public Policy and Good Governance“<br />
gefördert werden.<br />
Was können Sie derzeit von Deutschland<br />
aus tun?<br />
Hanan Badr: Die Ägypter im Ausland<br />
haben in den Tagen der Internetsperre eine<br />
sehr große Rolle gespielt. Die Intention des<br />
Regimes war es, einen „media black out“<br />
zu konstruieren, aber von hier aus wurde<br />
trotz der Sperre über Twitter <strong>und</strong> Facebook<br />
der Welt <strong>mit</strong>geteilt: Die Revolution ist nicht<br />
gestorben.<br />
Sherry Basta: Wir sind jetzt die Ver<strong>mit</strong>tler.<br />
Die Menschen in Deutschland interessieren<br />
sich sehr dafür, was in der arabischen Welt<br />
passiert. Häufig werde ich auf der Straße angesprochen.<br />
Uns alle verbindet der Wunsch<br />
nach Freiheit <strong>und</strong> es tut gut, davon zu<br />
erzählen: Wir suchen Freiheit, wir suchen<br />
Demokratie, wir suchen Menschenrechte.<br />
Diese Themen werden wir jetzt in unsere<br />
deutschen Universitäten tragen <strong>und</strong> Studierende<br />
zu Veranstaltungen einladen.<br />
Yasmine Aguib: Auf Einladung des <strong>DAAD</strong><br />
haben wir in Berlin ausführlich <strong>mit</strong> deutschen<br />
Parlamentariern gesprochen, die viele<br />
Fragen an uns hatten. Wie schätzen wir die<br />
Lage ein? Wie kann man den Demokratisierungsprozess<br />
unterstützen? Das war für uns<br />
eine große Chance <strong>und</strong> ist ein Modell dafür,<br />
was wir von hier aus leisten können.<br />
Wie sehen Sie die Rolle Ihrer Generation?<br />
Hanan Badr: Die Generation der 30- <strong>und</strong><br />
40-Jährigen hat die Aufgabe, zum Bindeglied<br />
der ägyptischen Gesellschaft zu werden.<br />
Viele Ägypter in diesem Alter haben wie<br />
wir im Ausland studiert, insbesondere Politikwissenschaft.<br />
Sie sind wissenschaftlich<br />
ausgebildet <strong>und</strong> zugleich politisch sehr aktiv.<br />
Es wäre hilfreich, sie im Rahmen von Hochschulkooperationen<br />
zu Konferenzen zu bitten<br />
<strong>und</strong> sie nach ihren Konzepten für den Wandel<br />
in Ägypten zu fragen: Wie stellen sie sich die<br />
Demokratisierung vor?<br />
Yasser Kosper: Es ist wichtig, dass Ägypter<br />
aller Generationen <strong>mit</strong>einander kommunizieren.<br />
Die Revolutionsbewegung ging von jüngeren<br />
Menschen aus. Jugend bedeutet Kraft.<br />
Aber die Jugend in Ägypten hat keine Übung<br />
auf dem Feld der Politik <strong>und</strong> die Probleme<br />
sind komplex. Da ist zum Beispiel die Frage<br />
der Wasserverteilung in der Region. Für Verhandlungen<br />
<strong>mit</strong> den Nachbarländern braucht<br />
man jemanden, der nicht nur Kraft, sondern<br />
auch sehr viel Erfahrung <strong>mit</strong>bringt.<br />
Wie wollen Sie helfen, den Menschen<br />
demokratisches Verhalten nahezubringen?<br />
Sherry Basta: Demokratische Kultur fehlt<br />
uns seit langer Zeit. Ägyptische Kinder lernen,<br />
dass es unhöflich ist, Fragen zu stellen.<br />
Ein Umdenken muss schon in der Schule<br />
anfangen. Dort muss wieder gelehrt werden,<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
kritisch zu denken, nachzufragen <strong>und</strong> zu<br />
analysieren.<br />
Yasser Kosper: Ägyptische Schulkinder<br />
waren <strong>mit</strong> ihren Eltern auf den Demonstrationen.<br />
Sie haben erlebt, wie ihre Eltern „nein“<br />
gesagt haben: Nein, ich akzeptiere das nicht.<br />
Der große Gewinn der Revolution ist es, den<br />
Angst-Staat gebrochen zu haben. Auch das<br />
Militär oder die Muslimbruderschaft oder die<br />
Liberalen haben gesehen, dass es möglich ist,<br />
nein zu sagen. Diese Erfahrung wird jetzt in<br />
die Schulen getragen.<br />
Hanan Badr: In den staatlichen Schulen<br />
sitzen allerdings derzeit bis zu 80 Kinder in<br />
einem Klassenzimmer. Unter diesen Bedingungen<br />
ist es schwierig, Raum für Diskussionen<br />
zu geben. Trotzdem muss der Unterricht<br />
weniger autoritär werden. Dafür brauchen<br />
wir eine Förderung <strong>und</strong> Weiterbildung der<br />
Fachkräfte in den Fakultäten für Erziehungswissenschaften.<br />
Die Lehrerausbildung muss<br />
reformiert werden. Auch hier kann die Zusammenarbeit<br />
<strong>mit</strong> Hochschulen im Ausland<br />
helfen.<br />
Yasmine Aguib: Demokratisieren bedeutet<br />
aufklären <strong>und</strong> informieren, aber auch eine<br />
gewisse Übung in Debatten <strong>und</strong> Diskussionen.<br />
Es wäre klug, bereits vor den Wahlen<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
im Herbst kurzfristig dafür zu sorgen, dass<br />
einfache ägyptische Bürger erfahren, welche<br />
Wahlmöglichkeiten ihnen die Freiheit bietet.<br />
Sie sollen auch erfahren, zwischen welchen<br />
Parteien sich Bürger in Frankreich, Deutschland<br />
oder den USA entscheiden können<br />
<strong>und</strong> welche politischen Richtungen es im<br />
Vergleich dazu in Ägypten gibt. Für neutrale<br />
Information kann man sorgen, noch bevor<br />
man das Bildungswesen reformiert – zum<br />
Beispiel, indem ägyptische staatliche Universitäten<br />
<strong>und</strong> die Deutsche Universität in Kairo<br />
regelmäßig öffentliche Informationsabende<br />
organisieren. Hilfreich wäre es, ägyptische<br />
Akademiker <strong>und</strong> Fachexperten dazu einzuladen,<br />
die im Ausland gelebt haben <strong>und</strong> die<br />
Strukturen anderer Länder gut kennen.<br />
Karim Fawzy: Informationsveranstaltungen<br />
an Hochschulen haben den Vorteil, dass<br />
sich die Inhalte schnell verbreiten lassen. Wir<br />
haben einen riesigen Universitätsapparat. Jeder<br />
Lehrende kann Informationen an 500 bis<br />
1000 Studenten weitergeben.<br />
Yasmine Aguib: Aber auch im ägyptischen<br />
Hochschulwesen selbst muss sich etwas<br />
ändern. In den letzten Jahren konnte man<br />
beobachten, dass Wissenschaftler, die eine<br />
wichtige Position anstrebten, Parteiabzeichen<br />
© Jacek Ruta<br />
Wollen von Deutschland aus am<br />
Aufbau demokratischer Strukturen<br />
in ihrem Land <strong>mit</strong>arbeiten:<br />
Yasser Kosper, Karim Fawzy,<br />
Sherry Basta, Hanan Badr,<br />
Yasmine Aguib (von links)<br />
dialog<br />
trugen. Man braucht sicherlich Schnittstellen<br />
von Wissenschaft <strong>und</strong> Politik, aber Parteizugehörigkeit<br />
darf keine Voraussetzung für eine<br />
wissenschaftliche Karriere sein.<br />
Karim Fawzy: Unsere Aufgabe fängt jetzt<br />
erst richtig an. Wenn wir zurückgehen, werden<br />
wir uns die Positionen erkämpfen müssen,<br />
aus denen heraus wir Strukturen ändern<br />
können. Hosni Mubarak hat zwar abgedankt,<br />
aber das Regime kämpft weiter. Es wird noch<br />
viele kleine Revolutionen geben, bis die richtigen<br />
Leute an die richtigen Stellen kommen<br />
<strong>und</strong> das neue Gesicht Ägyptens entsteht.<br />
Wie kann man arme Menschen dazu<br />
bewegen, auf dem Weg demokratischer<br />
Reformen fortzuschreiten?<br />
Sherry Basta: Der erste Schritt ist die<br />
soziale Sicherung. Es gibt viele Studien über<br />
Reformen, die in kurzer Zeit erfolgreich sind.<br />
Man kann zum Beispiel die Brotsubvention<br />
reformieren – eine wichtige Hilfe für Arme.<br />
Yasmine Aguib: Allerdings besteht die<br />
Gefahr, dass die Menschen schnell zufrieden<br />
<strong>und</strong> nicht mehr an Demokratisierung interessiert<br />
sind. Auch deshalb muss die Information<br />
an erster Stelle stehen. Die Menschen in<br />
Ägypten müssen Perspektiven erkennen. Es<br />
geht nicht um billiges Brot für ein Jahr. Es ist<br />
entscheidend zu wissen, wie andere leben,<br />
was für Freiheiten sie genießen, was die eigenen<br />
Rechte sind, da<strong>mit</strong> man niemanden <strong>mit</strong><br />
ein bisschen Essen <strong>und</strong> ein bisschen Geld betrügen<br />
kann. Es ist für uns alle eine Lebensmission,<br />
zu dieser Aufklärung beizutragen.<br />
Sherry Basta: Eine starke Ausgangsposition<br />
ist wichtig, um etwas zu bewirken. Daran<br />
arbeiten wir von hier aus. Bettina Mittelstraß<br />
5
6 dialog<br />
kleine Schritte zum Wandel<br />
<strong>DAAD</strong>-Stipendiaten diskutierten über Green Economy<br />
Sie kommen aus Schwellen- <strong>und</strong> Entwicklungsländern<br />
<strong>und</strong> bilden sich im <strong>DAAD</strong>-<br />
Programm „Entwicklungsländerbezogene<br />
Aufbaustudiengänge“ in Deutschland weiter:<br />
Seit 25 Jahren fördert der <strong>DAAD</strong> erfolgreich<br />
junge Führungskräfte in 40 Masterprogrammen.<br />
Der Geburtstag ist Anlass,<br />
den Millennium-Express aufs Gleis zu setzen<br />
– eine Workshop-Reihe an deutschen<br />
Hochschulen, die auch die UN-Millenniumsziele<br />
wie nachhaltigen Umgang <strong>mit</strong><br />
Ressourcen im Blick hat. Gestartet in Dresden<br />
hat der Millennium-Express inzwischen<br />
in Freiburg Station gemacht: Hier<br />
diskutierten die Stipendiaten die Chancen<br />
von Green Economy, einem ökologisch<br />
ausgerichteten Wirtschaftssystem. Über<br />
ihre Eindrücke berichten Kwame Ababio<br />
aus Ghana <strong>und</strong> Khan Mehedi Hasan aus<br />
Bangladesh.<br />
Khan Mehedi Hasan (28) aus Bangladesch<br />
war Dozent für Wirtschaft<br />
an der Universität von Khulna.<br />
Zurzeit studiert er im Masterstudiengang<br />
International and Development<br />
Economics an der Hochschule für<br />
Technik <strong>und</strong> Wirtschaft Berlin, gefördert<br />
vom <strong>DAAD</strong><br />
Welche Rolle spielt die Diskussion über<br />
Nachhaltigkeit in Ihrer Heimat?<br />
Khan Mehedi Hasan: Der Klimawandel<br />
hat Bangladesch zu einem sehr verw<strong>und</strong>baren<br />
Land gemacht. Überschwemmungen <strong>und</strong><br />
Zyklone treten häufiger auf als früher. Mit<br />
diesen bedrohlichen Veränderungen müssen<br />
wir uns auseinandersetzen, deshalb wird das<br />
Thema Green Economy in meiner Heimat<br />
heiß diskutiert.<br />
Kwame Ababio: In der Theorie ist Nachhaltigkeit<br />
auch in Ghana ein Thema. Es gibt<br />
w<strong>und</strong>erbare Gesetze, die das regeln. Aber wir<br />
scheitern bei der Umsetzung, denn wir haben<br />
ganz andere Probleme: Die Landbevölkerung<br />
kann sich nicht selbst ernähren, sie ist auf<br />
Hilfsorganisationen angewiesen <strong>und</strong> wandert<br />
ab in die Städte, wo die Armut noch größer<br />
ist. Ghana versucht, dem entgegenzuwirken.<br />
Kwame Ababio (32) aus<br />
Ghana arbeitete für eine<br />
Nichtregierungsorganisation.<br />
Jetzt studiert er in Freiburg<br />
im <strong>DAAD</strong>-geförderten<br />
Masterstudiengang Environmental<br />
Governance<br />
© Thomas Kunz<br />
Ich habe beispielsweise in einem Projekt<br />
gearbeitet, das Menschen dabei unterstützt,<br />
Produkte wie Honig oder Pilze selbst anzubauen,<br />
anstatt diese im Wald zu sammeln<br />
<strong>und</strong> dabei die Bäume zu fällen. Aber um ein<br />
solch verändertes Wirtschaften im großen Stil<br />
umsetzen zu können, fehlt das Geld.<br />
Welche Chancen hat die Green Economy<br />
in Entwicklungsländern?<br />
Khan Mehedi Hasan: Für mehr Nachhaltigkeit<br />
brauchen wir hochentwickelte<br />
Technologie – <strong>und</strong> die kostet viel. Selbst in<br />
Deutschland haben viele Menschen nicht<br />
das Geld, um zum Beispiel ein Passivhaus<br />
zu bauen. Wie soll das erst in einem Entwicklungsland<br />
gelingen? Oder nehmen wir<br />
das Thema Nahrung: In einem armen Land<br />
denken Menschen nicht darüber nach, wie<br />
ein Produkt entstanden ist. Sie kaufen stets<br />
das günstigste.<br />
Welche neuen Ideen haben Sie durch die<br />
Freiburger Konferenz erhalten?<br />
Kwame Ababio: Ich habe eins gelernt:<br />
Wandel wird durch die einzelnen Menschen<br />
angestoßen <strong>und</strong> vorangetrieben. Den Regierungen<br />
sind meist durch multinationale,<br />
profitorientierte Organisationen die Hände<br />
geb<strong>und</strong>en. Aber eine kleine Gruppe oder eine<br />
Region, die sich nachhaltig organisiert, kann<br />
etwas bewirken. Auch als Einzelner kann ich<br />
Einfluss nehmen.<br />
Khan Mehedi Hasan: Ich sehe das ähnlich.<br />
Vor meinem Studium in Deutschland<br />
habe ich Wirtschaft an der Universität von<br />
Khulna gelehrt. Auf der Freiburger Konferenz<br />
habe ich mich <strong>mit</strong> anderen Wissenschaftlern<br />
ausgetauscht <strong>und</strong> für mich persönlich folgende<br />
Erkenntnis <strong>mit</strong>genommen: Wir in Bangladesch<br />
sehen, dass die Industrienationen für<br />
einen Großteil der Klimaveränderung in unserem<br />
Land verantwortlich sind <strong>und</strong> warten<br />
darauf, dass diese Staaten Schutzmaßnahmen<br />
ergreifen. Aber die Entwicklungsländer können<br />
auch dann etwas tun, wenn die Industriestaaten<br />
sich weigern zu handeln. Das ist mir<br />
jetzt klar. Wenn sich die Welt nicht auf einen<br />
gemeinsamen Kurs einigen kann, muss noch<br />
lange nicht jeder in einen Tiefschlaf fallen.<br />
Die nächsten Stationen des Millennium-<br />
Express sind Dortm<strong>und</strong> <strong>und</strong> Berlin.<br />
Mehr unter:<br />
www.millennium-express.daad.de<br />
Alexandra Straush (sic)<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
© <strong>DAAD</strong>/Eric A. Lichtenscheidt<br />
daad-Standpunkt<br />
Dorothea Rüland ist<br />
Generalsekretärin des <strong>DAAD</strong><br />
Das tunesische wie das ägyptische Volk<br />
haben die Welt beeindruckt, als sie Anfang<br />
2011 <strong>mit</strong> langem Atem <strong>und</strong> friedlichen<br />
Demonstrationen ihre autoritären Führungen<br />
in die Knie zwangen. Vielleicht ist dies das<br />
Signal für einen historischen Umbruch <strong>und</strong><br />
demokratischen Aufbruch in der ganzen arabischen<br />
Welt. Die politische Transformation<br />
hin zu Demokratie, Rechtsstaat <strong>und</strong> sozialer<br />
Gerechtigkeit ist jedoch ein langer, beschwerlicher<br />
Weg <strong>und</strong> nicht vor Rückschlägen gefeit.<br />
Die internationale akademische Zusammenarbeit<br />
spielt dabei eine wichtige Rolle. Der<br />
<strong>DAAD</strong> ist seit langem in der gesamten Region<br />
vom Maghreb über die Kernländer des arabischen<br />
Ostens bis hin zur Arabischen Halbinsel<br />
engagiert. Partnerschaftlich <strong>und</strong> politisch<br />
unabhängig arbeiten deutsche <strong>und</strong> arabische<br />
Wissenschaftlerinnen <strong>und</strong> Wissenschaftler<br />
in zahlreichen Hochschulkooperationen zusammen.<br />
Besonders traditionsreich ist der<br />
deutsch-ägyptische Austausch. Über die Jahre<br />
hinweg waren Tausende von Ägyptern für längere<br />
Studien- <strong>und</strong> Forschungsaufenthalte in<br />
Deutschland, wo sie sich nicht nur Fachwissen<br />
aneignen, sondern auch Wissenschaft als kritisch-differenziertes<br />
Denken erleben konnten.<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Umbrüche im<br />
Nahen osten<br />
Stehen wir vor einer demokratischen Zeitenwende?<br />
Von Dorothea Rüland<br />
Mit vier großen kofinanzierten Stipendienprogrammen<br />
für Ägypter <strong>und</strong> Syrer haben wir<br />
seit 2008 den wissenschaftlichen Austausch<br />
<strong>mit</strong> diesen Ländern quantitativ wie qualitativ<br />
deutlich gesteigert. Die Erfahrung funktionierender<br />
demokratischer Strukturen <strong>und</strong> zivilgesellschaftlichen<br />
Engagements im Gastland<br />
geht an den Stipendiaten nicht spurlos vorüber<br />
<strong>und</strong> füllt das <strong>DAAD</strong>-Motto „Wandel durch<br />
Austausch“ <strong>mit</strong> Leben.<br />
Bei unserer Arbeit suchen wir immer wieder<br />
neue Wege. So studieren seit 2007 in <strong>mit</strong>tlerweile<br />
fünf bikulturellen Masterstudiengängen<br />
deutsche <strong>und</strong> arabische Nachwuchskräfte<br />
praxisbezogen <strong>und</strong> interkulturell in Schwerpunktgebieten<br />
der Entwicklungszusammenarbeit<br />
wie Wassermanagement, Erneuerbare<br />
Energien, Wirtschaft, Bildungsmanagement<br />
<strong>und</strong> ökologisches Stadtmanagement. Standorte<br />
in der arabischen Welt sind Amman, Kairo<br />
<strong>und</strong> Damaskus. „Deutsch als Fremdsprache<br />
im deutsch-arabischen Kontext“ ist Thema eines<br />
weiteren deutsch-arabischen Studienganges<br />
<strong>mit</strong> Sitz in Kairo.<br />
Seit 2009 fördert der <strong>DAAD</strong> im Programm<br />
„Public Policy and Good Governance“ den politischen<br />
Führungsnachwuchs in ausgewählten<br />
Partnerregionen im Süden. Immer wieder gelingt<br />
es auch hier jungen arabischen Bewerbern,<br />
die ihre Gesellschaft nach den Prinzipien<br />
guter Regierungsführung neu gestalten<br />
wollen, eines der heiß umkämpften Stipendien<br />
zu bekommen.<br />
dialog<br />
Mit einem eigenen Programmangebot fördert<br />
der <strong>DAAD</strong> den interkulturellen Dialog durch<br />
fachliche Kooperationen zwischen Wissenschaftlern<br />
<strong>und</strong> Studierenden aus Deutschland,<br />
den arabischen Ländern <strong>und</strong> dem Iran. Die<br />
seit 2002 geförderten r<strong>und</strong> 260 Maßnahmen,<br />
darunter 38 mehrjährige Projekte, verändern<br />
den Blick auf die Anderen wie auf die eigene<br />
Kultur <strong>und</strong> strahlen in die Gesellschaft aus.<br />
Dialog kann jedoch nur gedeihen, wenn er<br />
auf Vertrauen <strong>und</strong> Zuverlässigkeit baut. Daher<br />
ist die Einbeziehung unserer arabischen Partner<br />
bei allen Planungen für die Zukunft von<br />
herausragender Bedeutung. Wir wollen nicht<br />
über die Betroffenen sprechen, sondern <strong>mit</strong><br />
ihnen. So lud der <strong>DAAD</strong> ägyptische Stipendiaten<br />
im Februar 2011 zu einem gemeinsamen<br />
Gespräch <strong>mit</strong> B<strong>und</strong>estagsabgeordneten ein,<br />
um über die Einschätzung der Lage in ihrer<br />
Heimat, vor allem aber über Hoffnungen <strong>und</strong><br />
Perspektiven für die Zukunft ihres Landes zu<br />
sprechen (siehe Seite 4–5). Da<strong>mit</strong> haben wir<br />
rasch <strong>und</strong> un<strong>mit</strong>telbar auf die Herausforderungen<br />
des politischen Umbruchs reagiert.<br />
Die Zukunft des Nahen Ostens liegt heute<br />
mehr denn je in den Händen der jüngeren Generation.<br />
Nur Bildung bietet eine Chance auf<br />
eine bessere Zukunft – der <strong>DAAD</strong> steht bereit,<br />
um seinen Beitrag zur demokratischen Umgestaltung<br />
zu leisten.<br />
7
© Inga Nielsen - Fotolia<br />
Ein EinBlick Blick<br />
Waldspaziergang. Frische Luft, Sonnenstrahlen, das<br />
erste zarte Grün zeigt sich nach dem Winter. Die<br />
Deutschen zieht es hinaus in die Wälder. Schon Johann<br />
Wolfgang von Goethe schätzte diese Art der<br />
Erholung. 1813 dichtete er: „Ich ging im Walde so<br />
vor mich hin, <strong>und</strong> nichts zu suchen, das war mein<br />
Sinn …“. Müßiggang ist heute selten geworden: Fitness-<br />
<strong>und</strong> Freiluftbegeisterte joggen, biken oder walken<br />
durch die Wälder.<br />
Geduld <strong>und</strong> Muße aber sind die Säulen nachhaltiger<br />
Forstwirtschaft. Ein Prinzip aus Deutschland:<br />
Schon vor 300 Jahren wies der Sachse Carl von Carlowitz<br />
darauf hin, dass Abholzung <strong>und</strong> Anpflanzung<br />
im Gleichgewicht sein müssten, nur dann gebe es<br />
eine „nachhaltende Nutzung“. Daran scheinen sich<br />
die Förster hierzulande zu halten. Deutschland ist zu<br />
einem Drittel <strong>mit</strong> Wald bedeckt, Tendenz steigend.<br />
Im „Internationalen Jahr der Wälder“, ausgerufen<br />
von den Vereinten Nationen, lohnt sich der Waldspaziergang<br />
auch, um über sich hinaus zu blicken <strong>und</strong><br />
auf das große Ganze zu achten: den Erhalt der Wälder<br />
weltweit. KS<br />
Die deutsche Kampagne zum<br />
„Internationalen Jahr der Wälder“<br />
www.wald2011.de
10<br />
SpEktrUm dEUtSchlaNd<br />
Berlin/Syrien<br />
Götter aus Tell Halaf sind restauriert<br />
Sie schienen unwiederbringlich verloren: Die<br />
monumentalen Götterstatuen aus dem syrischen<br />
Tell Halaf waren eine Attraktion Berlins<br />
– bis sie bei einem Bombenangriff auf<br />
die deutsche Hauptstadt im November 1943<br />
während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurden.<br />
Eine Restauration der 3 000 Jahre alten<br />
Bildwerke galt lange als unmöglich. Doch eine<br />
kleine Gruppe von Archäologen <strong>und</strong> Restauratoren<br />
hat das Gegenteil bewiesen. Seit Ende<br />
Januar können Besucher 40 wiederhergestellte<br />
Skulpturen <strong>und</strong> Reliefplatten im Berliner<br />
Pergamon-Museum bew<strong>und</strong>ern.<br />
„Ein Juwel der Baugeschichte Mesopotamiens<br />
wurde für die Welt wiedergewonnen“,<br />
sagte Beate Salje, Direktorin des Vorderasiatischen<br />
Museums der Staatlichen Museen zu<br />
Berlin, anlässlich der Ausstellungseröffnung.<br />
Vorausgegangen war eine mühevolle Puzzle-<br />
Arbeit, bei der das Team 27 000 steinerne<br />
Bruchstücke untersuchte, zusammensetzte<br />
<strong>und</strong> in Teilen ergänzte. Neun Jahre dauerten<br />
die beispiellosen Restaurierungsarbeiten des<br />
Vorderasiatischen Museums.<br />
27 000-Teile-Puzzle: Götterstatuen aus Syrien sind wieder zusammengefügt<br />
Den Kulturschatz entdeckte 1899 der Diplomat<br />
<strong>und</strong> Privatgelehrte Max von Oppenheim<br />
(1860–1946) <strong>und</strong> brachte ihn später nach<br />
Deutschland. Erst nach dem Ende seiner Diplomatenkarriere<br />
begann er 1911 <strong>mit</strong> den<br />
Ausgrabungen am Tell Halaf, einem Hügel im<br />
Norden des heutigen Syriens. Bis 1929 legte<br />
von Oppenheim spektakuläre Paläste, Gräber<br />
<strong>und</strong> Grüfte frei. Ab 1930 zeigte er seine F<strong>und</strong>e<br />
in Berlin in einem eigenen Museum, einer<br />
ehemaligen Fabrikhalle.<br />
Die Ausstellung „Die geretteten Götter aus<br />
dem Palast vom Tell Halaf“ ist noch bis 14.<br />
August zu sehen. Kritiker bemängeln allerdings<br />
fehlende Hinweise auf die fragwürdige<br />
Rolle von Oppenheims als Diplomat<br />
im Orient <strong>und</strong> seine Haltung während des<br />
Nationalsozialismus.<br />
www.gerettete-goetter.de<br />
MPI Leipzig<br />
Forscher entdecken neuen Urmenschen<br />
Eigentlich schien es eine Routinerecherche<br />
zu werden. Wissenschaftler des Max-Planck-<br />
Instituts für evolutionäre Anthropologie in<br />
© Staatliche Museen zu Berlin<br />
Leipzig untersuchten russische Knochenf<strong>und</strong>e,<br />
um weitere Informationen über das Erbgut<br />
des Neandertalers zu sammeln. Doch ein<br />
40 000 Jahre alter, nicht einmal kirschkerngroßer<br />
Knochensplitter hatte es in sich. Dessen<br />
DNA stammte weder von einem Neandertaler<br />
noch von einem Vorfahren des modernen<br />
Menschen. „Alles deutete darauf hin, dass<br />
wir eine ganz neue Spezies Mensch gef<strong>und</strong>en<br />
haben“, sagte der Leipziger Anthropologe Johannes<br />
Kaufmann nach den ersten Analysen<br />
gegenüber der Deutschen Welle. Ende Dezember<br />
konnten die Forscher <strong>mit</strong> internationaler<br />
Unterstützung den endgültigen Beweis erbringen:<br />
Sie haben tatsächlich einen bislang unbekannten<br />
Urmenschen entdeckt.<br />
Die Wissenschaftler tauften ihn nach seinem<br />
F<strong>und</strong>ort: Denisova-Mensch. Russische<br />
Wissenschaftler hatten die Überreste in der<br />
Denisova-Höhle im südlichen Sibirien ausgegraben.<br />
Neben dem Knochenstück konnte<br />
das Forscherteam dem neuen Urmenschen<br />
auch einen Backenzahn zuordnen. Die DNA-<br />
Analysen ergaben, dass der Denisova-Mensch<br />
zwar die gleichen Vorfahren wie der Neandertaler<br />
hat, aber im Laufe der Evolution einen<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
anderen Weg einschlug. Erstaunlicherweise<br />
finden sich Merkmale dieses Urmenschen<br />
heute lediglich bei Einwohnern Papua-Neuguineas.<br />
Die Leipziger Forscher hoffen nun<br />
auf weitere Knochenf<strong>und</strong>e, um mehr über den<br />
Denisova-Menschen herauszufinden.<br />
B<strong>und</strong>eswehr<br />
Nur noch Freiwillige<br />
Die Wehrpflicht, die Einberufung junger Männer<br />
zum Militärdienst, war lange Zeit ein fester<br />
Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Zum 1.<br />
Juli 2011 ist da<strong>mit</strong> vorerst Schluss. Die B<strong>und</strong>esregierung<br />
entschied im Dezember 2010,<br />
die Wehrpflicht auszusetzen <strong>und</strong> stattdessen<br />
einen freiwilligen Wehrdienst für Frauen <strong>und</strong><br />
Männer einzuführen. Das hat Folgen, nicht<br />
nur für die B<strong>und</strong>eswehr.<br />
In den letzten Jahren hatten die Streitkräfte<br />
mangels Bedarf immer weniger Männer zum<br />
Wehrdienst eingezogen. Bei den 1982 Geborenen<br />
waren es zuletzt nur zwölf Prozent der<br />
knapp 450 000 potenziellen Rekruten. Künftig<br />
sollen in der B<strong>und</strong>eswehr zusätzlich zu Zeit-<br />
<strong>und</strong> Berufssoldaten nur noch 15 000 Soldaten<br />
einen freiwilligen Wehrdienst ableisten. Ob<br />
sich allerdings ausreichend Freiwillige finden,<br />
ist noch offen. Das Verteidigungsministerium<br />
erwägt unter anderem, auch in Deutschland<br />
lebende Ausländer zu gewinnen.<br />
Mit der Wehrpflicht fällt auch der zivile Ersatzdienst<br />
weg. Er wurde vor 50 Jahren für<br />
Wehrpflichtige eingeführt, die aus Gewissensgründen<br />
den Militärdienst verweigerten. Zivildienstleistende<br />
arbeiten in Krankenhäusern,<br />
betreuen Kinder, Alte <strong>und</strong> Behinderte. 2010<br />
gab es r<strong>und</strong> 78 000 „Zivis“.<br />
Die sich anbahnende Lücke soll zumindest<br />
teilweise der geplante B<strong>und</strong>esfreiwilligendienst<br />
schließen. 35 000 Menschen möchte<br />
die B<strong>und</strong>esregierung für ein soziales Engagement<br />
gewinnen. Geplante Kosten: 350 Millionen<br />
Euro im Jahr. Um den neuen Dienst attraktiver<br />
zu machen, ist etwa die Anrechnung<br />
der Freiwilligenzeit als Wartesemester für das<br />
Studium im Gespräch.<br />
Da viele Abiturienten nun nicht mehr zum<br />
Militär gehen oder Zivildienst leisten müssen,<br />
rechnen die Hochschulen <strong>mit</strong> Rekordzahlen<br />
bei den Studienanfängern. Hinzu kommt, dass<br />
in vielen B<strong>und</strong>esländern zwei Altersjahrgänge<br />
gleichzeitig Abitur machen. Gr<strong>und</strong> ist die<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
B<strong>und</strong>eskanzlerin Merkel stimmt zu:<br />
Vorerst keine Wehrpflicht mehr in Deutschland<br />
Umstellung der Gymnasialausbildung von 13<br />
auf zwölf Jahre. B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder stellen daher<br />
in den nächsten vier Jahren bis zu 1,5 Milliarden<br />
Euro zur Verfügung. Da<strong>mit</strong> sollen bis zu<br />
59 000 zusätzliche Studienplätze entstehen.<br />
Studienanfänger<br />
Ansturm auf die Hochschulen<br />
Noch nie haben sich so viele Studienanfänger<br />
an deutschen Hochschulen eingeschrieben:<br />
2010 waren es r<strong>und</strong> 443 000, teilte das Statistische<br />
B<strong>und</strong>esamt <strong>mit</strong>. Auch die Gesamtzahl<br />
der Studierenden stieg erneut: 2,2 Millionen<br />
im Wintersemester 2010/2011 bedeuten einen<br />
neuen Rekord. Fast jeder Zweite eines Altersjahrgangs<br />
nimmt inzwischen ein Studium auf,<br />
auch das ist eine neue Bestmarke. Den größten<br />
Zuwachs bei den Erstsemestern verzeichneten<br />
die Ingenieurwissenschaften <strong>mit</strong> insgesamt<br />
93 200 Anfängerinnen <strong>und</strong> Anfängern. Im<br />
Vergleich zum Vorjahr sind das acht Prozent<br />
mehr.<br />
200. Geburtstag Robert Bunsens<br />
Ins Gedächtnis eingebrannt<br />
Bunsenbrenner, Mechero Bunsen, Palnik Bunsena<br />
oder Bunsen Burner – in vielen Sprachen<br />
hat der deutsche Forscher Robert Wilhelm<br />
Bunsen seine Spur hinterlassen. Der nach ihm<br />
benannte Gasbrenner hat den am 30. März<br />
1811 in Göttingen geborenen Chemiker weltweit<br />
bekannt gemacht. In den USA feiern die<br />
Menschen am 31. März sogar den „National<br />
Bunsen Burner Day“.<br />
Viele kennen das Gerät noch aus der Schulzeit.<br />
Es kommt nach wie vor häufig im Chemieunterricht<br />
zum Einsatz, um Proben oder<br />
Flüssigkeiten zu erhitzen. Allerdings hat Bunsen<br />
den Brenner gar nicht selbst konstruiert.<br />
© 1. Wikipedia, 2. istockphoto.com<br />
SpEktrUm dEUtSchlaNd<br />
Weltweit<br />
ein Begriff:<br />
der Bunsenbrenner<br />
Das Prinzip stammt ursprünglich vom englischen<br />
Experimentalphysiker Michael Faraday.<br />
Der Heidelberger Mechaniker <strong>und</strong> Laborassistent<br />
Bunsens, Peter Desaga, soll den perfektionierten<br />
Gasbrenner um 1854 in Bunsens<br />
Auftrag gebaut <strong>und</strong> nach seinem Auftraggeber<br />
benannt haben.<br />
Robert Bunsen, dessen Geburtstag sich in<br />
diesem Jahr zum zweih<strong>und</strong>ertsten Mal jährt,<br />
zählt zu den bekanntesten deutschen Chemikern<br />
des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. Zusammen <strong>mit</strong><br />
Gustav Kirchhoff entwickelte er zum Beispiel<br />
die Spektralanalyse chemischer Elemente. Sie<br />
ermöglichte den beiden Wissenschaftlern unter<br />
anderem die Entdeckung der Alkalimetalle<br />
Cäsium <strong>und</strong> Rubidium. Christian Hohlfeld<br />
11<br />
© Presse- <strong>und</strong> Informationsamt der B<strong>und</strong>esregierung/Andrea Bienert
12 titEl<br />
Auch im digitalen Zeitalter ist das „Schmökern“ im gedruckten<br />
Buch für viele Deutsche eine beliebte Freizeitbeschäftigung.<br />
Das Land, in dem Johannes Gutenberg vor r<strong>und</strong> 550 Jahren den<br />
europäischen Buchdruck erf<strong>und</strong>en hat, schätzt Bücher als Kulturträger.<br />
Alljährlich ist die Frankfurter Buchmesse bedeutende<br />
Drehscheibe des internationalen Buchhandels. Die Stadt Leipzig<br />
richtet jedes Frühjahr das größte europäische Lesefest aus.<br />
Bücherwurm“ nennt man in Deutschland<br />
einen Menschen, der seine Nase am liebsten<br />
in bedruckte Papierseiten steckt. Immer<br />
auf der Suche nach anregendem Lesestoff verweilt<br />
ein Bücherwurm gern vor Regalen <strong>und</strong><br />
greift nach den farbigen Buchrücken. Beschäftigt<br />
<strong>mit</strong> dem Blättern von Seiten, „schmökert“<br />
er sich durch die Lektüre, versinkt dabei in<br />
Sesseln oder Kissen, vergisst die Zeit <strong>und</strong><br />
nimmt Nahrung eher beiläufig auf. Bücher<br />
lesende Menschen sind in Deutschland ein<br />
alltägliches Bild. Sie sitzen in U-Bahnen <strong>und</strong><br />
Bussen, Wartezimmern <strong>und</strong> Parks.<br />
R<strong>und</strong> 400 Millionen gedruckte Bücher kauften<br />
die Deutschen im Jahr 2009 <strong>und</strong> da<strong>mit</strong><br />
zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor, analysierte<br />
die Gesellschaft für Konsumforschung<br />
in Nürnberg (GfK). Von dem Geld, das Deutsche<br />
insgesamt für Unterhaltung ausgeben,<br />
fließen seit Jahren r<strong>und</strong> 40 Prozent in den<br />
Kauf von Büchern, berichtet das Marktforschungsunternehmen.<br />
Obwohl etwas über 40<br />
Prozent der Deutschen keine Bücher kaufen<br />
– darunter vor allem Schüler, Studierende <strong>und</strong><br />
24 Prozent Bibliotheksbenutzer –, standen<br />
2005 in jedem vierten deutschen Haushalt<br />
200 bis 500 Bücher zur Verfügung. Neun von<br />
zehn Deutschen haben 2008 mindestens ein<br />
Buch im Jahr gelesen. 50 Prozent aller Leser<br />
„schaffen“ neun bis 18 Bücher <strong>und</strong> mehr im<br />
Jahr. Nur r<strong>und</strong> sieben Prozent aller Deutschen<br />
lesen (<strong>und</strong> kaufen) nie ein Buch.<br />
Inhaltlich steht Unterhaltung im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Haben sich 1999 noch 54 Prozent der<br />
Buchkäufer <strong>mit</strong> Sachinformation versorgt,<br />
waren es 2010 nur noch 38 Prozent. Konkurrent<br />
ist hier das Internet. Zur besonders erfolgreichen<br />
Belletristik gehörten in den letzten<br />
heute schon<br />
Deutschland ist immer noch „Leseland“ –<br />
© picture-alliance/dpa<br />
Jahren auch hierzulande die Weltbestseller:<br />
nach den Harry-Potter-Büchern die Vampirromanzen<br />
von Stephenie Meyer. Sie kurbeln<br />
die Leselust der jüngeren Generationen an.<br />
Vor allem weibliche Teenager gehen regelmäßig<br />
einmal in der Woche in öffentliche Büchereien<br />
<strong>und</strong> versorgen sich <strong>mit</strong> Lesefutter.<br />
Der Roman in Geschenkpapier<br />
In deutschen Bestsellerlisten sind auch<br />
deutschsprachige Romanciers gut vertreten.<br />
Attraktiv sind Titel, die <strong>mit</strong> dem Deutschen<br />
Buchpreis ausgezeichnet wurden, wie etwa<br />
Uwe Tellkamps DDR-Schlüsselroman „Der<br />
Turm“ im Jahr 2008. Die Bandbreite reicht<br />
von ernster Literatur über Unterhaltung bis<br />
zu Autoren, die wie Cornelia Funke für alle<br />
Altersklassen schreiben. Kinder- <strong>und</strong> Jugendbücher<br />
werden von r<strong>und</strong> einem Fünftel aller<br />
Deutschen gekauft – <strong>mit</strong> steigender Tendenz<br />
von Menschen über 50 Jahren, die ihre Enkel<br />
beschenken. Generell überreichen die Deutschen<br />
zu privaten <strong>und</strong> geschäftlichen Anlässen<br />
oft <strong>und</strong> gern Bücher als Geschenk. „Das<br />
Buch wird nicht als Gebrauchsgegenstand aus<br />
Papier betrachtet, sondern als Kulturträger“,<br />
sagt die Erlanger Buchwissenschaftlerin Professor<br />
Ursula Rautenberg.<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
geschmökert?<br />
Bücher hoch im Kurs<br />
Als Kulturereignis gilt deshalb auch die internationale<br />
Buch- <strong>und</strong> Medienmesse in Frankfurt<br />
am Main – die „Mutter aller Buchmessen“.<br />
Über 7 500 Aussteller aus mehr als 110 Ländern,<br />
unzählige Autoren <strong>und</strong> mehr Berichterstatter<br />
als bei Fußballweltmeisterschaften treffen<br />
sich dort jedes Jahr im Herbst. Der deutsche<br />
Buchhandel präsentiert hier alljährlich<br />
Weltliteratur <strong>und</strong> verleiht seinen international<br />
renommierten Friedenspreis.<br />
Die Erfolgsgeschichte der zwei großen deutschen<br />
Buchmessen – in Frankfurt am Main<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
<strong>und</strong> Leipzig – reicht bis ins 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zurück. Unweit der Mainmetropole hatte der<br />
Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg<br />
Mitte des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts die erste Bibel in<br />
gedruckter Form präsentiert. Sein Meisterschüler<br />
Petrus Schoeffer verfeinerte nicht<br />
nur die Kunst der Drucktechnik. Als einer der<br />
ersten Buchhändler <strong>und</strong> Verleger im Zeitalter<br />
des Buchdrucks organisierte er erfolgreich den<br />
Verkauf eigener <strong>und</strong> fremder Drucke über den<br />
gesamten deutschsprachigen Raum. Schon<br />
bald konzentrierte sich der Handel auf zwei<br />
Zentren. „Frankfurt war das Zentrum des katholischen<br />
Buchhandels <strong>und</strong> der lateinischen<br />
Literatur <strong>mit</strong> einer am päpstlichen Index ausgerichteten<br />
Zensur“, erläutert der Leipziger<br />
titEl<br />
Buchwissenschaftler Professor Siegfried Lokatis.<br />
Leipzig entwickelte sich zur Bücherstadt<br />
der protestantischen Gegenposition.<br />
Die strengen Zensurbestimmungen beförderten<br />
die freie Reichsstadt Frankfurt im 18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert ins Abseits. Leipzig hingegen entwickelte<br />
sich zur Bücherstadt. Mit fortschreitender<br />
Industrialisierung wurden schließlich<br />
„90 Prozent aller Bücher, die es überhaupt in<br />
Deutschland gab, über Leipzig ausgeliefert“,<br />
sagt Siegfried Lokatis. Von den mehr als 1700<br />
Verlagen, die heute Mitglied im Börsenverein<br />
des Deutschen Buchhandels sind, hatten viele<br />
große Namen ursprünglich ihren ersten Sitz<br />
in Leipzig: Brockhaus, Meyer, Reclam oder<br />
Teubner produzierten dort im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Kochbücher, Sachbücher, Fachbücher, Lehrbücher,<br />
belletristische <strong>und</strong> wissenschaftliche<br />
Literatur. „Auch 90 Prozent aller Notenbücher<br />
der ganzen Welt wurden in Leipzig gestochen.“<br />
Die Produktionsstätten waren groß wie<br />
Fußballfelder, beschäftigten nicht selten über<br />
1000 Mitarbeiter, <strong>und</strong> ganze Güterbahnhöfe<br />
wurden eigens für den Buchhandel gebaut.<br />
Auf einer um 1900 entstandenen Karte von<br />
Leipzig sind r<strong>und</strong> 2 000 Orte eingezeichnet,<br />
die ausschließlich <strong>mit</strong> dem Buchhandel zu tun<br />
hatten. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete die<br />
Bedeutung Leipzigs als gesamteuropäisches<br />
Buchhandelszentrum. Nach der deutschen<br />
Wiedervereinigung gab es schließlich wieder<br />
die zwei bis heute erfolgreichen deutschen<br />
Buchmessen.<br />
Die Macht des Buchs<br />
„Das Buch vereint viele positive Zuschreibungen<br />
auf sich: Bildung, dauerhaftes Wissen,<br />
Verlässlichkeit <strong>und</strong> Identifikation“, sagt die<br />
Erlanger Buchwissenschaftlerin (<strong>und</strong> <strong>DAAD</strong>-<br />
Alumna) Ursula Rautenberg. „Der Gr<strong>und</strong> dafür<br />
ist die über zwei Jahrtausende gewachsene<br />
Verankerung des Buchs in der Gesellschaft.“<br />
Die Erfolgsgeschichte des Mediums hat in<br />
Deutschland aber auch <strong>mit</strong> der besonderen<br />
Funktion zu tun, die dem Buch zur Zeit der<br />
Aufklärung in Europa zukam. 500 Lesegesellschaften<br />
<strong>mit</strong> mehr als 25 000 Mitgliedern<br />
13
14 titEl<br />
hatten sich um 1800 auf dem Gebiet des Heiligen<br />
Römischen Reiches gegründet. „Lektüre<br />
förderte ein neues Selbstverständnis der Bürger<br />
als einer Gruppe, die sich gegen den Adel<br />
absetzte“, erklärt die Buchwissenschaftlerin.<br />
Der Bürger war zugleich Leser, <strong>und</strong> das Buch<br />
wurde zu einer Macht, weil „über das Medium<br />
des gedruckten Wortes neue literarische<br />
<strong>und</strong> politische Kommunikationsstrukturen<br />
entstanden.“ Politische Parteien des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
gehen im deutschsprachigen Kulturraum<br />
zum Teil auf Lesegesellschaften zurück.<br />
„Mit der kulturellen Sonderstellung wird auch<br />
die wirtschaftliche Sonderbehandlung des<br />
gedruckten Buches begründet“, betont Rautenberg.<br />
Die Bindung an einen festen Ladenpreis,<br />
der den Preis- <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> Wertverfall von<br />
Büchern verhindern soll, ist in Deutschland<br />
gesetzlich verankert.<br />
Die Aufwertung geht Hand in Hand <strong>mit</strong> einer<br />
verbreiteten Abneigung gegenüber der<br />
Entwertung von Büchern. Ganz gleich, wie<br />
schäbig sie aussehen, ob sie gelesen wurden<br />
oder nicht, <strong>und</strong> selbst wenn sie inhaltlich<br />
durchschnittlich sind – in Deutschland werfen<br />
Leipziger Buchmesse 2011: Der deutsche Erfolgsautor<br />
Wolfgang Hohlbein liest seinen Roman als E-Book<br />
viele Menschen höchst ungern ihre privaten<br />
Bücher in den Abfall. „Das hat<br />
<strong>mit</strong> der nationalsozialistischen Bücherzensur<br />
zu tun <strong>und</strong> besonders <strong>mit</strong> den<br />
symbolischen Bücherverbrennungen<br />
am 10. Mai 1933 in über 200 Universitätsstädten“,<br />
erklärt Rautenberg.<br />
Werke von über 200 Autoren, darunter<br />
vieler jüdischer <strong>und</strong> sozialistischer<br />
Schriftsteller, landeten damals auf dem<br />
Scheiterhaufen.<br />
Leselust <strong>und</strong> Hörvergnügen<br />
Lesefeste im öffentlichen Raum haben im<br />
„Leseland“ Deutschland Konjunktur. Die internationalen<br />
Literaturfestivals in Köln, Hamburg,<br />
Berlin oder München sind alljährlich<br />
ausgebucht. Europas größtes Lesefest bietet<br />
Leipzig: Im März 2011 bot die Stadt parallel<br />
zur Buchmesse beim 20. Festival „Leipzig<br />
liest“ dem begeisterten Publikum über 2 000<br />
Leseveranstaltungen <strong>mit</strong> mehr als 1500 Autoren.<br />
Der Erfolg des Lese-Events in der sächsischen<br />
Großstadt stützt sich auch auf die besondere<br />
Lesetradition zur Zeit der DDR. Die<br />
© Leipziger Messe GmbH/Norman Rembarz<br />
Bücherzensur stachelte die Leselust damals<br />
noch an. „Jedes Buch – wenn es denn erschien<br />
– war für die Leser total interessant“, sagt der<br />
Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis. Weltliteratur,<br />
die man lange nicht bekommen konnte,<br />
war häufig bereits am Tag des Erscheinens<br />
vergriffen. West-Literatur, die auf der Leipziger<br />
Buchmesse zum Teil ausgestellt sein durfte,<br />
wurde dort abgeschrieben, auswendig gelernt<br />
oder <strong>mit</strong> stillem Einverständnis der Verleger<br />
gestohlen. „Weil man wusste, dass die Presse<br />
zensiert ist, holte man sich die Welt über das<br />
Buch wieder herein.“<br />
Inszenierte Lesung bietet auch das Hörbuch,<br />
das in Deutschland seit Jahren einen Aufschwung<br />
erlebt. „Das Vorlesen literarischer<br />
Werke in professioneller Rhetorik ist eigentlich<br />
eine Renaissance der antiken Form der<br />
Literaturrezeption“, sagt Ursula Rautenberg.<br />
Das Hörbuch verdrängt das Bücherlesen nicht.<br />
Umfragen bestätigen: Wer Hörmedien nutzt,<br />
greift auch zu anderen Medien. Hörer bleiben<br />
Leser.<br />
Kein Boom für E-Books<br />
Anders als in den USA erlebt das E-Book in<br />
Deutschland <strong>und</strong> den europäischen Nachbarländern<br />
noch keinen vergleichbaren Boom.<br />
Zwar rechnen Verlage bereits <strong>mit</strong> der jüngeren<br />
Generation, für die der Umgang <strong>mit</strong> den<br />
E-Readern eines Tages normal sein wird, aber<br />
noch ist die Nachfrage gering. Am häufigsten<br />
wird das E-Book für die Informationsver<strong>mit</strong>tlung<br />
genutzt. 35 Prozent der deutschen Verlage<br />
führen E-Books <strong>mit</strong> einem Schwerpunkt<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
auf wissenschaftlicher Literatur, Sach- <strong>und</strong><br />
Fachbüchern. Der Umsatz <strong>mit</strong> E-Books machte<br />
2010 nur 0,5 Prozent vom gesamten Umsatz<br />
des deutschen Buchhandels aus. Auch die<br />
jüngste K<strong>und</strong>enbefragung der GfK vom März<br />
2011 belegt: 82 Prozent der Deutschen kaufen<br />
immer noch fast ausschließlich gedruckte Bücher<br />
<strong>und</strong> nur zwei Prozent im Wesentlichen<br />
E-Books. An das sinnliche Leseerlebnis käme<br />
digitales <strong>Lesen</strong> nicht heran, begründen 85 Prozent<br />
aller Befragten. Zudem müsse das E-Book<br />
in Deutschland im Vergleich zu den USA keine<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© Johannssen/photothek.net<br />
Mit Buch in den Park:<br />
<strong>Lesen</strong> ist ein beliebtes<br />
Freizeitvergnügen<br />
Lücken in der Buchversorgung ausgleichen,<br />
betont Ursula Rautenberg. 4 000 stationäre<br />
Buchhandlungen bilden in Deutschland ein<br />
dichtes Netz zum Stöbern vor Ort. Ein bestelltes<br />
Buch kann innerhalb von zwölf St<strong>und</strong>en<br />
geliefert werden, <strong>und</strong> über 10 000 Bibliotheken<br />
stellen Bücher zur kostenlosen Nutzung<br />
zur Verfügung.<br />
Ungebrochene Attraktivität hat für viele<br />
Deutsche die berufliche <strong>und</strong> wissenschaftliche<br />
Beschäftigung <strong>mit</strong> dem Buch. Das Interesse<br />
am Buchhändlerberuf steigt, <strong>und</strong><br />
© picture-alliance / dpa<br />
titEl<br />
Ausbildungsmöglichkeiten passen sich an<br />
moderne Entwicklungen an. Anders als in den<br />
USA kann man Buchwissenschaft in Deutschland<br />
auch an der Universität studieren. Und<br />
während europaweit das Thema Buch in Fächer<br />
wie Geschichte oder Literaturwissenschaft<br />
integriert ist, hat Deutschland in Leipzig,<br />
Mainz, München <strong>und</strong> Erlangen gleich vier<br />
Institute für Buchwissenschaft. „Leipzig ist für<br />
die historische Forschung weltweit attraktiv,<br />
weil das sächsische Staatsarchiv über 50 riesige<br />
Verlagsarchive hat“, erzählt Siegfried Lokatis.<br />
Das Buch als Kommunikationsmedium,<br />
seine Funktionen in der Gesellschaft <strong>und</strong> seine<br />
Stellung im modernen Mediensystem sind<br />
dagegen Schwerpunkte der buchwissenschaftlichen<br />
Ausbildung in Erlangen. Dort hat auch<br />
die Chinesin Li Rui ihr Studium absolviert <strong>und</strong><br />
für ihre Abschlussarbeit Vergleiche gezogen:<br />
„Die Deutschen lesen viel mehr als die Chinesen“,<br />
sagt Li Rui, aber es gäbe auch Ähnlichkeiten.<br />
Kinderbücher werden auch in China<br />
sehr viel gekauft, gelesen <strong>und</strong> verschenkt –<br />
vor allem von den Großeltern.<br />
Bettina Mittelstraß<br />
Good Old Books<br />
Visitors to Germany see people reading everywhere:<br />
in the <strong>und</strong>ergro<strong>und</strong>, in parks, in waiting<br />
rooms, in trains, people have books in their hands.<br />
E-books are not widespread; German readers<br />
remain sceptical. They like their printed books.<br />
In Germany, books are regarded as an important<br />
vehicle of culture, and hence something to be<br />
preserved. Historically, reading books was an<br />
important part of the European Enlightenment,<br />
and of the rise of the German middle class. At<br />
the same time, books have been an important<br />
item of trade in Germany for over 500 years. In<br />
the 15th century, the golds<strong>mit</strong>h Johannes Gutenberg<br />
of Mainz made Europe’s first printed book.<br />
It was not long before Germany had two major<br />
book fairs: one in Frankfurt am Main and one in<br />
Leipzig. Today the Frankfurt Book Fair is the hub<br />
of the international book trade. And every spring,<br />
Europe’s biggest reading festival takes place in<br />
Leipzig. Germany remains the “Land of Reading,”<br />
and reading printed books remains a favourite<br />
leisure time activity here, even in the digital age.<br />
15
16<br />
titEl<br />
Bibliotheken multimedial<br />
Interview <strong>mit</strong> Ulrich Korwitz<br />
Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin in Köln <strong>und</strong> Bonn<br />
(ZB MED), Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft<br />
E-Books werden in Deutschland bisher zögerlich genutzt. Der Umbruch<br />
zum digitalen <strong>Lesen</strong> wird vor allem für die Fachliteratur erwartet.<br />
Für wissenschaftliche Bibliotheken bleibt die Entwicklung<br />
daher spannend. Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin ist die<br />
weltweit größte Informationseinrichtung im Fächerkanon Medizin,<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen, Ernährungs-, Umwelt- <strong>und</strong> Agrarwissenschaften.<br />
Welche Inhalte werden an der<br />
ZB MED elektronisch gelesen?<br />
Wir haben millionenfache<br />
Abrufe von elektronischen Zeitschriftenartikeln<br />
im Internet. Die<br />
Verlage machen ihr Geschäft, indem<br />
sie ihre Pakete als Lizenzen<br />
verkaufen. Im Bereich der Medizin<br />
sind heute über 9 000 Zeitschriften<br />
elektronisch verfügbar.<br />
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
erwirbt seit 2004 für sehr<br />
viel Geld sogenannte Nationallizenzen<br />
für die Archive von einschlägigen<br />
Zeitschriften in allen<br />
Fachbereichen. Die stehen dann<br />
akademischen Einrichtungen in<br />
Deutschland zur Verfügung. Das<br />
ist ein klares Zeichen dafür, dass<br />
Bedarf besteht.<br />
<strong>Lesen</strong> Studierende E-Books?<br />
Die Entwicklung muss man<br />
beobachten. Vielen Studierenden<br />
fehlt im Umgang <strong>mit</strong> dem<br />
E-Book der wörtlich gemeinte<br />
Zugriff auf ein Buch. Sie möchten<br />
gleichzeitig im Index blättern<br />
<strong>und</strong> in den Volltext schauen,<br />
Vergleiche zwischen mehreren<br />
Seiten ziehen oder wichtige Informationen<br />
markieren. Es gibt<br />
da Nachbesserungen bei den<br />
Readern, aber die reichen nicht<br />
aus. Einige Bibliotheken haben<br />
E-Book-Kollektionen gekauft oder<br />
leihen Reader <strong>mit</strong> einer Gr<strong>und</strong>version<br />
von Nachschlagewerken<br />
aus, die dann ständig aktualisiert<br />
wird. Für das Nachschlagen singulärer<br />
Informationen wird das<br />
E-Book genutzt, aber ein ganzes<br />
Lehrbuch der Chirurgie wird eher<br />
noch nicht elektronisch gelesen.<br />
Wie erfolgreich ist die freie<br />
Publikation wissenschaftlicher<br />
Inhalte im Internet?<br />
Zeitschriften im „Open Access“<br />
sind gut etabliert. Wir verlegen<br />
14 Zeitschriften <strong>und</strong> veröffentlichen<br />
etwa 20 Kongressberichte<br />
pro Jahr <strong>mit</strong> je bis zu 1 000 Abstracts<br />
<strong>und</strong> Forschungsberichten.<br />
Da sind wir weit. Fast alle diese<br />
Zeitschriftenartikel existieren<br />
nur digital. Das ist eine klare<br />
Umstellung.<br />
Was bedeutet die elektronische<br />
Publikation für die<br />
Archivierung?<br />
Wir müssen Dateien <strong>mit</strong> Nationallizenzen,<br />
die wir ja für alle<br />
Zeit erworben haben, immer wieder<br />
neu in eine technisch lesbare<br />
Form überführen. Sonst geht das<br />
Material verloren. Zusammen<br />
<strong>mit</strong> der Technischen Informationsbibliothek<br />
Hannover <strong>und</strong><br />
der Deutschen Zentralbibliothek<br />
für Wirtschaftswissenschaften<br />
in Kiel erproben wir derzeit ein<br />
System für die digitale Langzeitarchivierung.<br />
Es gibt noch kein<br />
Standardsystem für die Welt.<br />
Werden Bibliotheken als<br />
Gebäude überflüssig, wenn<br />
sich auch das E-Book<br />
durchsetzt?<br />
Die Studierenden gewöhnen<br />
sich immer stärker an das digitale<br />
<strong>Lesen</strong>, <strong>und</strong> auf Bestände<br />
virtueller Bibliotheken können<br />
sie <strong>mit</strong> entsprechender Lizenz<br />
von überall her zugreifen. Wir<br />
diskutieren dieses Szenario. Aber<br />
wir sehen auch, dass die Bibliothek<br />
eine Funktion als Lernraum<br />
hat. Möglicherweise werden<br />
sich genau da die Angebote von<br />
Bibliotheken erweitern: als ein<br />
Ort, wo Ruhe herrscht, wo die<br />
Studierenden gedruckte <strong>und</strong> elektronische<br />
Bücher, Internet <strong>und</strong><br />
Recherchemöglichkeiten finden<br />
<strong>und</strong> schließlich auch – das ist<br />
vor allem für Mediziner wichtig<br />
– Modelle, Skelette <strong>und</strong> andere<br />
Materialien.<br />
Greifen Sie in Ihrer Freizeit zum<br />
E-Book?<br />
Ich überlege, es auszuprobieren.<br />
Aber ich habe ein schönes<br />
Büchlein gern in der Hand <strong>und</strong><br />
blättere in der Sitzecke, um mich<br />
inspirieren zu lassen. Mal sehen,<br />
ob das E-Book da heranreicht.<br />
Das Gespräch führte<br />
Bettina Mittelstraß<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© zbmed
Zukunftsvision: Das Modell der Leuphana-<br />
Universität Lüneburg von Daniel Libeskind<br />
Lüneburg<br />
Stararchitekt plant<br />
Uni-Hauptgebäude<br />
Das Jüdische Museum in Berlin<br />
oder das Denver Art Museum<br />
stammen vom ihm. Seine Entwürfe<br />
zum Neubau des World Trade<br />
Center in New York erzielten den<br />
ersten Platz im internationalen<br />
Architektenwettbewerb. Nun wird<br />
der amerikanische Stararchitekt<br />
Daniel Libeskind an der Leuphana-Universität<br />
Lüneburg seine<br />
kreativen Spuren hinterlassen.<br />
Das Hauptgebäude der Hochschule<br />
wird nach seinen Plänen gebaut.<br />
Darin sind Seminarräume,<br />
Hörsäle, ein Forschungszentrum<br />
<strong>und</strong> ein Auditorium Maximum<br />
für 1200 Besucher untergebracht.<br />
Libeskind legte bei der Planung<br />
besonderen Wert auf Energieeffizienz:<br />
Der Neubau wird in der<br />
Gesamtbilanz mehr Energie produzieren<br />
als verbrauchen.<br />
Die niedersächsische Universität<br />
ist dem amerikanischen Architekten<br />
vertraut. Dort entwickelte er<br />
2007 als Gastprofessor <strong>mit</strong> Studierenden<br />
den Entwurf für das neue<br />
Gebäude. Geschätzte Kosten: 58<br />
Millionen Euro. Im Frühjahr 2011<br />
wird der Gr<strong>und</strong>stein gelegt, für<br />
2014 ist der Einzug geplant.<br />
Bochum<br />
R<strong>und</strong> ums Mittelmeer<br />
An der Ruhr-Universität Bochum<br />
wurde Anfang März das Zentrum<br />
für Mittelmeerstudien eröffnet. Es<br />
soll die deutsche Forschung in diesem<br />
Bereich stärken <strong>und</strong> beschäftigt<br />
sich <strong>mit</strong> dem Zeitraum von der<br />
Antike bis zur Gegenwart. Zu den<br />
Schwerpunkten gehören Migration<br />
als regionale Ressource, soziale<br />
sowie politische Netzwerke <strong>und</strong><br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
interkulturelle Kommunikation.<br />
Mit Tagungen, Konferenzen <strong>und</strong><br />
Podiumsdiskussionen soll der<br />
Austausch zwischen den Fachkollegen<br />
vorangetrieben werden.<br />
Zudem bietet das neue Zentrum<br />
Veranstaltungsreihen <strong>und</strong> Foren<br />
zu verschiedenen Themen r<strong>und</strong><br />
ums Mittelmeer an.<br />
Ulm<br />
Neues Helmholtz-Institut<br />
Batterien spielen für die Energieversorgung<br />
<strong>und</strong> die Mobilität<br />
eine immer wichtigere Rolle. So<br />
steht die Batterieforschung im<br />
Zentrum des neuen Helmholtz-<br />
Instituts für Elektrochemische<br />
Energiespeicherung. Anfang des<br />
Jahres begann es <strong>mit</strong> seiner Arbeit<br />
auf dem Campus der Universität<br />
Ulm. Gründer <strong>und</strong> Träger ist<br />
das Karlsruher Institut für Technologie<br />
(KIT). Partner sind das<br />
Deutsche Zentrum für Luft- <strong>und</strong><br />
Raumfahrt <strong>und</strong> das Zentrum für<br />
Sonnenenergie- <strong>und</strong> Wasserstoff-<br />
Forschung Baden-Württemberg.<br />
Sie alle gehören zur Helmholtz-<br />
Gemeinschaft. Sie ist <strong>mit</strong> über<br />
31000 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeitern in 17 Forschungszentren<br />
<strong>und</strong> einem Jahresbudget<br />
von r<strong>und</strong> 3,3 Milliarden Euro die<br />
größte Wissenschaftsorganisation<br />
Deutschlands.<br />
in kürze<br />
Die International Mathematical<br />
Union (IMU), Weltorganisation<br />
der Mathematik, hat seit Anfang<br />
Februar 2011 ihren ständigen Sitz<br />
in Berlin. So<strong>mit</strong> konnte sich die<br />
deutsche Hauptstadt als Standort<br />
gegen Rio de Janeiro <strong>und</strong> Toronto<br />
durchsetzen. Zuvor war die<br />
© Leuphana<br />
Organisation stets am Wohnort<br />
des jeweiligen Generalsekretärs<br />
angesiedelt. Die IMU fördert die<br />
internationale Zusammenarbeit,<br />
veranstaltet Weltkongresse für<br />
die mathematische Fachwelt <strong>und</strong><br />
verleiht unter anderem die Fields-<br />
Medaille, die höchste Auszeichnung<br />
für Mathematiker.<br />
Die Hochschulperle 2010 ging<br />
an die Studentenstiftung der<br />
Technischen Universität Dresden.<br />
Der Stifterverband für die<br />
Deutsche Wissenschaft zeichnet<br />
jeden Monat kleine, innovative<br />
Projekte an Hochschulen aus.<br />
Join the Best<br />
Master of Science<br />
(MSc) in Management<br />
Neues vom campus hochSchUlE<br />
Excellence in Research and Teaching<br />
Integrated Study Abroad / Double Degrees<br />
Specializations across all Fields of Management<br />
Renowned Academics<br />
Our Network:<br />
160 Partner Universities<br />
150 Partner Companies<br />
Alumni Association with more than 2,100 Members<br />
For Details on Information Days,<br />
please visit www.whu.edu/msc<br />
WHU – Otto Beisheim School of Management<br />
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany<br />
Tel. +49 261 6509-521/-522<br />
E-mail: master@whu.edu<br />
www.master.whu.edu<br />
Die Hochschulperle 2010 wurde<br />
unter den prämierten Perlen<br />
des ganzen Jahres durch Online-<br />
Abstimmung ausgewählt. Seit der<br />
Gründung 2005 hat die Dresdner<br />
Stiftung zahlreiche Projekte ins<br />
Leben gerufen – stets unter dem<br />
Motto „Studierende fördern Studierende“:<br />
So engagierte sie sich<br />
für längere Öffnungszeiten der<br />
Bibliothek während der Prüfungsphasen.<br />
Außerdem richtete die<br />
Stiftung die Nightline Dresden ein<br />
– ein studentisches Zuhörtelefon<br />
für jegliche Art von Problemen.<br />
Die Technische Universität München<br />
(TUM) gründete im Juni 2010<br />
die TUM Universitätsstiftung <strong>mit</strong><br />
dem Ziel, weltweit zu den besten<br />
Universitäten aufzuschließen. Mit<br />
einem Budget von 16 Millionen<br />
Euro können künftig mehr Projekte<br />
<strong>und</strong> Stipendien für Studierende<br />
oder Dozenten finanziert werden.<br />
Dies gibt der Universität auch die<br />
Möglichkeit, unabhängiger von<br />
staatlichen Geldern zu handeln.<br />
Natalie Zündorf<br />
Highly-ranked among<br />
Masters Programs worldwide<br />
e.g. Financial Times 2010<br />
Excellence in<br />
Management<br />
Education<br />
Msc_<strong>DAAD</strong> Letter_90,5x118.indd 1 03.01.11 10:07<br />
Anzeige<br />
17
18<br />
hochSchUlE<br />
internationale Erfahrungen<br />
Ausländische Studierende schätzen deutsche Hochschulen, Deutsche zieht es nach draußen –<br />
die Bilanz ist ausgeglichen<br />
Weltweit gehört Deutschland zu den beliebtesten<br />
Studienorten. Es ist zugleich<br />
unter den westlichen Industriestaaten das<br />
Land <strong>mit</strong> den mobilsten Studierenden.<br />
Auslandsaufenthalte während des Studiums<br />
haben für junge Deutsche einen hohen<br />
Stellenwert <strong>und</strong> machen Eindruck bei<br />
künftigen Arbeitgebern.<br />
Für Judith Adarkwah stand fest: zwei Semester<br />
im Ausland müssen sein. An ihrer<br />
Heimatuniversität Köln studiert die 21-Jährige<br />
Latein <strong>und</strong> Englisch auf Lehramt. Derzeit ist<br />
die <strong>DAAD</strong>-Stipendiatin am King’s College in<br />
London. Die selbstbewusst wirkende junge<br />
Frau bringt auf den Punkt, was viele bewegt –<br />
nämlich die Neugier auf Erfahrungen jenseits<br />
der eigenen Campus-Tore: „Als Anglistin finde<br />
ich es unbedingt notwendig, für einen längeren<br />
Zeitraum in einem englischsprachigen<br />
Land gelebt zu haben. Außerdem ist es eine<br />
w<strong>und</strong>erbare Möglichkeit, interessante Erfahrungen<br />
zu sammeln, erwachsen zu werden,<br />
eine andere Gesellschaft <strong>und</strong> andere Lebensweisen<br />
kennen zu lernen, <strong>und</strong> internationale<br />
Kontakte <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaften zu knüpfen.“<br />
Deutsche Unternehmen jedenfalls zeigen<br />
sich zufrieden <strong>mit</strong> der Auslandsmobilität der<br />
Bewerber aus dem eigenen Land. Die Siemens<br />
AG beispielsweise bietet ein internationales<br />
„Graduate Program“ für junge Führungskräfte<br />
an, das auch einen achtmonatigen Auslandsaufenthalt<br />
einschließt. Kerstin Wagner, Leiterin<br />
der internationalen Nachwuchskräfte-<br />
Akquise bei Siemens, lobt: „Für die meisten<br />
ist dies nicht der erste Aufenthalt. Viele der<br />
Kandidaten haben bereits während des Studiums<br />
Erfahrungen im Ausland gesammelt.“<br />
Exakte Daten über die Mobilität deutscher<br />
Studierender sind schwer zu er<strong>mit</strong>teln. Aus<br />
Studien des <strong>DAAD</strong>, der Hochschul-Informations-System<br />
GmbH (HIS), des Deutschen Studentenwerkes<br />
(DSW) <strong>und</strong> aus Absolventenbefragungen<br />
lässt sich der Schluss ziehen, dass<br />
etwa jeder Vierte aller Studierenden (Stand:<br />
Wintersemester 2008/2009) für Studium,<br />
Praktikum, Sprachkurs oder Exkursion im<br />
Ausland war.<br />
Kürzer ins Ausland<br />
Statistiken belegen allerdings auch, dass die<br />
Zahl der Studierenden <strong>mit</strong> Auslandsaufenthalten<br />
seit 2000 sehr viel weniger stark gestiegen<br />
ist als in den 1980er- <strong>und</strong> 1990er-Jahren. Und<br />
wer über die Grenzen schaut, bleibt kürzer,<br />
wie eine aktuelle Studie des <strong>DAAD</strong> <strong>und</strong> der<br />
HIS belegt: Der Anteil der Studierenden, die<br />
sieben bis zwölf Monate an einer ausländischen<br />
Hochschule immatrikuliert sind, ist<br />
zwischen 2003 <strong>und</strong> 2009 um 16 Prozent gesunken;<br />
der Anteil derjenigen, die bis zu sechs<br />
Monate im Ausland studierten, stieg dagegen<br />
im gleichen Zeitraum um 18 Prozent. „Eine Ursache<br />
ist sicherlich die Umstellung auf Bachelor-<br />
<strong>und</strong> Masterstudiengänge“, sagt Claudius<br />
Habbich, Leiter des <strong>DAAD</strong>-Referats „Information<br />
für Deutsche über Studium <strong>und</strong> Forschung<br />
im Ausland“.<br />
Tatsächlich ist die Auslandsquote bei den<br />
Bachelorstudierenden niedriger als in den<br />
alten Diplom- <strong>und</strong> Magisterstudiengängen.<br />
„Weil im Bachelor der Leistungsdruck durch<br />
mehr Lernstoff <strong>und</strong> mehr Prüfungen in kürzerer<br />
Studienzeit gestiegen ist, machen sich die<br />
angehenden Akademiker heute viel stärker<br />
Gedanken darüber, ob ihre Studienleistungen<br />
im Ausland anerkannt werden“, erläutert Habbich.<br />
Diese Anerkennung funktioniere jedoch<br />
nicht immer, durchweg aber in speziellen Partnerprogrammen<br />
<strong>mit</strong> einzelnen ausländischen<br />
Hochschulen. Habbichs Kollegin Simone<br />
Burkhart, Leiterin des <strong>DAAD</strong>-Referats Evaluation<br />
<strong>und</strong> Statistik, bestätigt: „Das Mobilitätsverhalten<br />
ändert sich. Bachelor gehen seltener<br />
während des Studiums, dafür häufiger nach<br />
dem Abschluss ins Ausland.“ Außerdem nehmen<br />
zeitlich kürzere Sprachkurse, Exkursionen<br />
<strong>und</strong> Praktika an Bedeutung zu.<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© <strong>DAAD</strong>
© <strong>DAAD</strong><br />
Studienaufenthalte<br />
im Ausland<br />
verändern die<br />
Persönlichkeit ...<br />
Die Marburger Psychologiestudentin Lena<br />
Rupp, derzeit als <strong>DAAD</strong>-Stipendiatin an der<br />
Clarks University im US-B<strong>und</strong>esstaat Massachusetts,<br />
sagt: „Ich schätze, nur die Hälfte<br />
der amerikanischen Kurse wird zu Hause anerkannt.<br />
Das ist zwar schade, aber hinderte<br />
mich nicht daran, mich für ein Auslandsstudium<br />
zu bewerben.“ Sie vermutet, dass etwa<br />
zehn bis 15 Prozent ihres Studienjahrgangs<br />
ähnlich denken.<br />
Immer mehr Hochschulen wird bewusst,<br />
wie wichtig es ist, einen Auslandsaufenthalt<br />
im Curriculum einzuplanen. Die Hochschule<br />
Reutlingen beispielsweise hat dafür 2010 vom<br />
<strong>DAAD</strong> <strong>und</strong> dem Stifterverband für die Deutsche<br />
Wissenschaft das Prädikat „Internationale<br />
Hochschule“ erhalten. In der Fakultät<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
www.go-out .de<br />
. Infos zum Auslandsstudium<br />
. Erfahrungsberichte<br />
. Veranstaltungen, Messen<br />
<strong>und</strong> Infobörsen<br />
. Blog: <strong>DAAD</strong>-Stipendiaten<br />
erzählen<br />
OPEN<br />
YOUR<br />
MIND!<br />
<strong>DAAD</strong>_A4 Anz_Hochschulstart.indd 1 23.09.10 12:32<br />
Business ist ein Auslandssemester Pflicht.<br />
„Wir wollen möglichst alle Absolventen auf den<br />
globalisierten Arbeitsmarkt vorbereiten. Deshalb<br />
ist es Aufgabe der Hochschulleitung, Mobilitätsfenster<br />
zu schaffen“, sagt Baldur Veit,<br />
Leiter des Reutlingen International Office. In<br />
der Fakultät Technik verbringen mindestens<br />
40 Prozent der Studierenden ein Semester im<br />
Ausland – meistens für ihr Praktikum.<br />
Die Reutlinger sehen sich selbst als Trendsetter<br />
– auch was die Attraktivität für ausländische<br />
Studierende anbelangt. „22 Prozent unserer<br />
Studenten kommen aus dem Ausland“,<br />
sagt Veit. Seit 1979 bietet die Hochschule<br />
in der Fakultät Business Doppelabschlüsse<br />
zusammen <strong>mit</strong> Partnerhochschulen in<br />
neun anderen Ländern an. Dass am Standort<br />
Studieren weltweit: www.go-out.de<br />
Sozialerhebung des DSW: www.sozialerhebung.de/pdfs/Soz19_Internationalisierung_Internet.pdf<br />
<strong>DAAD</strong>/HIS-Studie „Internationale Mobilität im Studium“: www.go-out.de/de/14799<br />
erbach-com / Foto: © Eric Isselée, fotolia.com<br />
Studienaufenthalte<br />
<strong>und</strong> Praktika im Ausland!<br />
Gestaltung: | Druck: ditges print+more | Auflage: 2.000 | Dezember 2010 | © <strong>DAAD</strong><br />
<strong>Lust</strong> auf Neues: <strong>DAAD</strong> wirbt im Ausland<br />
<strong>und</strong> in Deutschland für Mobilität<br />
hochSchUlE 19<br />
Reutlingen viele Lehrveranstaltungen auf<br />
Englisch abgehalten werden, senkt die Sprachbarrieren.<br />
Auch wegen solcher Bemühungen<br />
platziert der British Council Deutschland auf<br />
der Spitzenposition: In der aktuellen Erhebung<br />
des Councils zur Internationalisierung<br />
der Hochschulen steht Deutschland noch vor<br />
Australien, Großbritannien <strong>und</strong> China.<br />
Partnerprogramme gern gesehen<br />
Viele der großen Universitäten wie etwa die<br />
Freie Universität Berlin bemühen sich ebenfalls<br />
<strong>mit</strong> Partnerprogrammen um junge Ausländer.<br />
Der US-Student Howard Fisher ist<br />
einer von ihnen. „Vieles von dem, was Deutsche<br />
denken <strong>und</strong> äußern, trifft auch mein<br />
Lebensgefühl“, begründet der heute 23-jährige<br />
Germanistikstudent aus Boston seinen<br />
Entschluss, für ein Jahr nach Berlin zu gehen.<br />
Der <strong>DAAD</strong>-Stipendiat kam <strong>mit</strong> dem Programm<br />
„Berlin Consortium for German Studies“. Um<br />
daran teilnehmen zu können, hatte er sich eigens<br />
in Boston exmatrikuliert <strong>und</strong> vorübergehend<br />
an der New Yorker Columbia University<br />
eingeschrieben – weil sie der Freien Universität<br />
partnerschaftlich verb<strong>und</strong>en ist.<br />
Nur wenige US-Studierende nehmen solche<br />
Mühen auf sich. Während Deutschland eine<br />
recht ausgeglichene Bilanz von „In-Comings“<br />
<strong>und</strong> „Out-Goings“ vorweisen kann, ist für<br />
Amerikaner ein Auslandssemester vor allem<br />
aus finanziellen Gründen eher unüblich.<br />
Howard Fisher ist einer von knapp 9 000 US-<br />
Studierenden, die im Studienjahr 2008/2009<br />
(Quelle: Open Doors, Institute of International<br />
Education) nach Deutschland kamen. Weit<br />
vorn liegen junge Chinesen <strong>mit</strong> gut 22 000<br />
(Stand: Wintersemester 2009/2010). Knapp<br />
dahinter: Inder, Koreaner <strong>und</strong> Osteuropäer. Im<br />
Wintersemester 2009/2010 kamen 181 249 sogenannte<br />
Bildungsausländer (Studierende, die<br />
ihre Hochschulreife im Ausland erworben haben)<br />
nach Deutschland. Nach einer Phase der<br />
Stagnation zeigt diese Kurve seit 2009 wieder<br />
nach oben – Tendenz steigend: Laut einer Erhebung<br />
des DSW <strong>mit</strong> der HIS will knapp die<br />
Hälfte der jungen Ausländer, die (noch) nicht<br />
im Ausland war, am liebsten in Deutschland<br />
studieren. Mareike Knoke
© Uni Oldenburg<br />
20<br />
ortStErmiN<br />
Oldenburg<br />
magnet im Nordwesten<br />
Der blaue Himmel, die schnell dahinziehenden<br />
Wolken <strong>und</strong> der kräftige Wind<br />
lassen es schon erahnen: Das Meer ist nicht<br />
weit. Zwar liegt Oldenburg nicht direkt an<br />
der Nordsee, doch diese hat großen Einfluss<br />
auf das städtische Leben, auf Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Wissenschaft.<br />
162 000 Einwohner zählt Oldenburg – <strong>und</strong> es<br />
werden mehr. Die Zeitschrift „Capital“ spricht<br />
von einem neuen Magneten im Nordwesten,<br />
im Städteranking 2009 der Zeitschrift „WirtschaftsWoche“<br />
kürten die befragten Unternehmer<br />
Oldenburg zur „wirtschaftsfre<strong>und</strong>lichsten<br />
Stadt“. Das Technologie- <strong>und</strong> Gründerzentrum<br />
– inzwischen das größte in Niedersachsen –<br />
wurde mehrfach <strong>mit</strong> internationalen Preisen<br />
ausgezeichnet. Trotz der beachtlichen Entwicklung<br />
ist Oldenburg ein überschaubarer<br />
Ort im Grünen: Beliebtestes Fortbewegungs<strong>mit</strong>tel<br />
ist – <strong>und</strong> zwar nicht nur bei den insgesamt<br />
etwa 20 000 Studierenden – das Fahrrad.<br />
Stadt der Wissenschaft<br />
2009 überzeugte Oldenburg im b<strong>und</strong>esweiten<br />
jährlichen Wettbewerb „Stadt der Wissenschaft“<br />
<strong>und</strong> durfte sich <strong>mit</strong> diesem Titel<br />
Modern, lebenswert <strong>und</strong> offen – Oldenburg gehört<br />
zu den wenigen Großstädten in Deutschland, deren<br />
Einwohnerzahl wächst. Die ehemalige Residenzstadt<br />
blickt auf über 900 Jahre Geschichte zurück; als „Übermorgenstadt“<br />
stellt sie sich den Herausforderungen<br />
der Zukunft.<br />
© Stadt Oldenburg<br />
schmücken. Die „Übermorgenstadt“ will auch<br />
künftig <strong>mit</strong> ihren Forschungseinrichtungen<br />
„Antworten auf die brennenden Fragen der<br />
Zukunft“ geben – beispielsweise im „Schlauen<br />
Haus“, das im Frühjahr 2012 seine Türen<br />
für Bürger <strong>und</strong> Wissenschaftler öffnet. Dort<br />
werden Oldenburgs wissenschaftliche Kernkompetenzen<br />
zu den Themen Energie <strong>und</strong><br />
Klimaschutz sowie zu künftigen Wohn- <strong>und</strong><br />
Lebensformen präsentiert. Und das alles auf<br />
unterhaltsame Weise. So entsteht <strong>mit</strong>ten in<br />
der Innenstadt ein Ort, an dem Besucher Forschung<br />
hautnah erleben können.<br />
1973 gegründet, gehört Oldenburgs Universität<br />
zu den jungen Hochschulen der B<strong>und</strong>esrepublik.<br />
Namensgeber ist der Friedensnobelpreisträger<br />
Carl von Ossietzky, einer der profiliertesten<br />
Publizisten der Weimarer Republik.<br />
Der Pazifist starb 1938 an den Folgen seiner<br />
Haft in einem Konzentrationslager nahe bei<br />
Oldenburg. Seit der Gründung trägt die Universität<br />
kontinuierlich dazu bei, der Nordwestregion<br />
wirtschaftliche <strong>und</strong> kulturelle Impulse<br />
zu geben. Enge Kooperationen <strong>mit</strong> Wirtschaft,<br />
Verbänden, staatlichen Institutionen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Einrichtungen sind heute selbstverständlich.<br />
So hat das B<strong>und</strong>esinstitut für Kultur<br />
<strong>und</strong> Geschichte der Deutschen im östlichen<br />
Europa (BKGE) seinen Sitz in Oldenburg. Es<br />
berät <strong>und</strong> unterstützt die B<strong>und</strong>esregierung<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Amer Sports Too Uni Oldenburg
ei der Erforschung, Darstellung <strong>und</strong> Weiterentwicklung<br />
von Kultur <strong>und</strong> Geschichte der<br />
Deutschen im östlichen Europa. Als Institut an<br />
die Universität angegliedert ist das BKGE auch<br />
in die universitäre Lehre eingeb<strong>und</strong>en.<br />
Meeresforschung im Verb<strong>und</strong><br />
Mit dem interdisziplinären Institut für Chemie<br />
<strong>und</strong> Biologie des Meeres verfügt die<br />
Universität Oldenburg über Niedersachsens<br />
einziges universitäres Meeres- <strong>und</strong> Küstenforschungszentrum.<br />
Dort arbeiten seit 2008<br />
zwei Max-Planck-Nachwuchsgruppen für Marine<br />
Geochemie, die die Meeresforschung in<br />
Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven sowie in Oldenburg<br />
<strong>und</strong> Wilhelmshaven noch besser <strong>mit</strong>einander<br />
verbinden. Interdisziplinarität charakterisiert<br />
die gesamte Forschung an der Universität: In<br />
der Neurosensorik, Energie-, Halbleiter- <strong>und</strong><br />
Materialforschung sowie in der Wirtschaftsinformatik<br />
<strong>und</strong> der Umweltforschung arbeiten<br />
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen<br />
eng zusammen.<br />
Auch die Jade Hochschule <strong>mit</strong> ihren drei<br />
Standorten in Wilhelmshaven, Elsfleth <strong>und</strong> Oldenburg<br />
versteht sich als moderne Hochschule<br />
<strong>mit</strong> einem maritimen Schwerpunkt. Sie bietet<br />
r<strong>und</strong> 35 Studiengänge in sechs Fachbereichen.<br />
Alle drei Studienorte haben eine lange Lehrtradition.<br />
So geht die nautische Ausbildung in<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© dpa/Ingo Wagner<br />
Kleinstadt in Küstennähe:<br />
Meereswissenschaftler sind an der jungen<br />
Universität in Oldenburg ebenso zu Hause<br />
wie Hörforscher<br />
Elsfleth bis auf das Jahr 1832 zurück. Inzwischen<br />
befindet sich dort die größte nautische<br />
Ausbildungsstätte in Deutschland.<br />
In der Hörforschung Weltspitze<br />
Klangvoller ist Oldenburgs Name vor allem<br />
durch die Hörforscher geworden: In etwa 80<br />
Prozent aller weltweit vertriebenen Hörgeräte<br />
steckt ein Stück Oldenburger Know-how. Seit<br />
Jahren zählt der Fachbereich der Universität<br />
Oldenburg zu den international führenden<br />
Forschungseinrichtungen. Eine ganze Reihe<br />
erfolgreich arbeitender Strukturen wurde<br />
geschaffen, darunter das Oldenburger Kompetenzzentrum<br />
„HörTech“ <strong>und</strong> das „Hörzentrum“.<br />
Seit 2008 verstärkt die Fraunhofer- Projektgruppe<br />
für Hör-, Sprach- <strong>und</strong> Audiotechnologie<br />
aus Ilmenau in Thüringen die Wissenschaftler<br />
in Niedersachsen. Ein gemeinsames<br />
Dach finden alle Hörforscher im „Haus des<br />
Hörens“. Dort steht der b<strong>und</strong>esweit einzige<br />
Kommunikationsakustik-Simulator seiner<br />
Art: Ob Kölner Dom, Klassenraum oder Bahnhofshalle<br />
– jeder beliebige Klangraum kann<br />
akustisch simuliert werden.<br />
Die „Hörsensible Universität“ konnte auch<br />
beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft<br />
punkten. Sie wird <strong>mit</strong> sieben weiteren<br />
Hochschulen in einem Benchmarking-Club<br />
gefördert. In dem Programm „Ungleich besser!<br />
Verschiedenheit als Chance“ geht es unter<br />
anderem darum, eine leise Lernumgebung<br />
zum Vorteil für Studierende <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne<br />
Hörbeeinträchtigung zu bieten. In Oldenburg<br />
berät bereits eine Clearingstelle Studierende,<br />
die Probleme <strong>mit</strong> dem Hörverstehen haben.<br />
Künftig soll die Beratung ausländischer Studierender<br />
verstärkt werden.<br />
Wissenschaftliche Spitzenleistungen <strong>und</strong><br />
herausragende Lehre – beides zu vereinbaren<br />
<strong>und</strong> auszubauen, darin sieht die Universität<br />
ihren Auftrag für die kommenden Jahre. International<br />
sichtbare <strong>und</strong> interdisziplinäre<br />
Forschung sowie gezielte Nachwuchsförderung<br />
bilden die Basis. Über 80 Studiengänge<br />
bietet die Universität an. Ab 2012 gehört möglicherweise<br />
auch Medizin zum Studienangebot:<br />
Geplant ist eine European Medical School<br />
der Partnerstädte Oldenburg <strong>und</strong> Groningen<br />
(Niederlande). Der Deutsche Wissenschaftsrat<br />
als wichtigstes wissenschaftspolitisches<br />
Beratungsgremium von B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong><br />
B<strong>und</strong>esländern hat bereits grünes Licht gegeben.<br />
Zunächst müssen das Studienangebot<br />
Adressen online:<br />
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg<br />
www.uni-oldenburg.de<br />
Stadt der Wissenschaft<br />
www.uebermorgenstadt.de<br />
Jade Hochschule<br />
www.jade-hs.de<br />
Hörzentrum Oldenburg<br />
www.hoerzentrum-oldenburg.de<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Kultur <strong>und</strong> Geschichte der<br />
Deutschen im östlichen Europa<br />
www.bkge.de<br />
Fraunhofer Institut für Windenergie <strong>und</strong><br />
Meerestechnik<br />
www.iwes.fraunhofer.de<br />
Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie<br />
www.mpi-bremen.de<br />
Stadt Oldenburg<br />
www.stadt-oldenburg.de<br />
Zentrum für Windenergieforschung<br />
www.forwind.de<br />
ausgearbeitet <strong>und</strong> die Finanzierung geklärt<br />
werden. Die vier Oldenburger Kliniken, die<br />
Universität Oldenburg <strong>und</strong> die Universität<br />
Groningen arbeiten dabei eng zusammen.<br />
Die steife Brise der Nordsee hat einen weiteren<br />
Forschungsbereich stark beflügelt: die<br />
Windkraft. „ForWind“ ist das Zentrum für<br />
Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg,<br />
Bremen <strong>und</strong> Hannover <strong>und</strong> bildet<br />
einen b<strong>und</strong>esweit einmaligen Forschungsverb<strong>und</strong>.<br />
Die enge Zusammenarbeit <strong>mit</strong> dem<br />
Fraunhofer-Institut für Windenergie <strong>und</strong><br />
Energiesystemtechnik IWES schafft ein Forschungsnetzwerk<br />
von internationalem Gewicht,<br />
das alle Bereiche der Windenergieforschung<br />
abdecken kann. Katja Lüers<br />
Oldenburg<br />
ortStErmiN<br />
Oldenburg boasts 162,000 inhabitants, and<br />
is still growing. The <strong>magazin</strong>e Capital calls it a<br />
new magnet in Germany’s northwest. The city’s<br />
young university, fo<strong>und</strong>ed in 1973, also exerts<br />
an attractive force. It offers over 80 courses of<br />
study, and may add one in medicine in 2012. A<br />
European Medical School is being planned in<br />
Oldenburg and its Dutch sister city Groningen.<br />
Research in hearing is an outstanding speciality:<br />
Some 80 percent of all the hearing aids sold<br />
worldwide use technology developed in Oldenburg.<br />
The city’s auditory researchers share a common<br />
address, the “House of Hearing” (www.<br />
hoerzentrum-oldenburg.de). A communication<br />
acoustics simulator that is unique in Germany is<br />
able to simulate any acoustic environment, from a<br />
classroom to a railway station or Cologne Cathedral.<br />
Another scientific attraction, the Centre for<br />
Wind Power Research, jointly operated by the<br />
universities of Oldenburg, Bremen and Hannover,<br />
is a unique scientific consortium in Germany.<br />
21
22 WiSSENSchaft<br />
1948 zählen vier Nobelpreisträger zu den Gründern (von rechts): Adolf Windaus (Chemie 1928),<br />
Richard Kuhn (Chemie 1938), Max von Laue (Physik 1914), Otto Hahn (Chemie 1944)<br />
In 80 Instituten betreibt die Max-Planck-<br />
Gesellschaft heute Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
von internationaler Bedeutung. Die Wurzeln<br />
reichen bis ins Jahr 1911 zurück.<br />
Ich will einen Roboter dazu bringen, sich in<br />
der Welt so gut zurechtzufinden wie ein zweijähriges<br />
Kind.“ Das Ziel von Michael J. Black<br />
klingt bescheiden. Doch für den Informatiker<br />
ist es das ganz <strong>und</strong> gar nicht: Kleinkinder sind<br />
bereits Virtuosen, wenn sie greifen. Sie beherrschen<br />
dabei zahlreiche Varianten, bewegen<br />
die unterschiedlichsten Formen sicher in<br />
ihren Händen – <strong>und</strong> sie können abstrahieren.<br />
Zweijährige erkennen R<strong>und</strong>es als r<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Eckiges als eckig, ganz gleich, wie die R<strong>und</strong>ung<br />
beschaffen ist oder wie viele Ecken ein<br />
Gegenstand hat. „Wir Menschen analysieren<br />
unsere Umwelt in Sek<strong>und</strong>enbruchteilen“, sagt<br />
Black. „Uns reichen der Glanz einer Oberfläche<br />
<strong>und</strong> ihre Schattierungen, um zu erkennen,<br />
ob sie rutschig oder griffig ist.“ Computern<br />
dagegen fehlt das Vermögen, aus wenigen Informationen<br />
auf gr<strong>und</strong>legende Eigenschaften<br />
zu schließen. Genau das möchte der Wissenschaftler<br />
ihnen beibringen.<br />
Weltberühmte<br />
denkschmiede<br />
Die Max-Planck-Gesellschaft feiert 100 Jahre Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
Michael J. Black ist einer der weltweit führenden<br />
Experten für maschinelles Sehen. Deshalb<br />
wurde er Anfang 2011 als Professor an<br />
das damalige Max-Planck-Institut (MPI) für<br />
Metallforschung berufen: An den Standorten<br />
Stuttgart <strong>und</strong> Tübingen etabliert die Max-<br />
Planck-Gesellschaft den neuen Forschungsschwerpunkt<br />
„Intelligente Systeme“, der sich<br />
im Grenzbereich zwischen Informatik, Biologie<br />
<strong>und</strong> Materialwissenschaften bewegt. Mit<br />
dieser Neuausrichtung erhielt das Institut<br />
jetzt einen neuen Namen. Und während Black<br />
kürzlich zu einem der Gründungsdirektoren<br />
des „MPI für Intelligente Systeme“ wurde, ist<br />
das 1934 in Stuttgart gegründete Institut für<br />
Metallforschung Geschichte.<br />
Dynamische Strukturen<br />
Für die Max-Planck-Gesellschaft sind solche<br />
Entscheidungen nicht ungewöhnlich. „Die<br />
Ausrichtung eines Instituts ist nie dauerhaft<br />
festgelegt“, erklärt Peter Gruss, der Präsident<br />
der Organisation. „Sie ist abhängig<br />
von den aktuellen Herausforderungen.“ Der<br />
„Verein zur Förderung der Wissenschaften“<br />
widmet regelmäßig Institute um, wenn ein<br />
Tor für Spitzenforscher: Eingang<br />
zum Hauptsitz in München<br />
Forschungsgebiet sich wandelt. Dazu gehört<br />
auch, dass Abteilungen oder ganze Einrichtungen<br />
schließen, wenn sich auf einem Feld<br />
kein geeigneter Spitzenforscher mehr finden<br />
lässt.<br />
Die hohe Flexibilität stellt sicher, dass die<br />
Max-Planck-Wissenschaftler stets zu den<br />
brennendsten Themen forschen, von der Seuchenbekämpfung<br />
über die Klima-Entwicklung<br />
bis zur Finanzmarktkrise. Immer wieder entstehen<br />
auch völlig neue Institute, wie das MPI<br />
für die Physik des Lichts, das 2009 aus der auf<br />
fünf Jahre befristeten Max-Planck-Forschungsgruppe<br />
für Optik, Information <strong>und</strong> Photonik<br />
hervorgegangen ist.<br />
Die Gruppe hatte der Erlanger Physikprofessor<br />
Gerd Leuchs 2004 beantragt, um auf<br />
höchstem Niveau seine Arbeit zur Quanteninformation<br />
auszubauen. Leuchs <strong>und</strong> seine<br />
Mitarbeiter entwickeln in diesem Bereich<br />
beispielsweise Techniken, um Daten <strong>mit</strong>hilfe<br />
von Laserstrahlen abhörsicher zu übertragen.<br />
Zum Auslaufen der Förderung evaluierte<br />
eine Expertenkommission die Ergebnisse<br />
der Arbeitsgruppe, bewertete sie als herausragend<br />
– <strong>und</strong> zum 1. Januar 2009 wurde<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
das Max-Planck-Institut gegründet, das im<br />
Endausbau vier Abteilungen <strong>und</strong> etwa 300<br />
Mitarbeiter umfasst.<br />
Neuanfang nach dem Krieg<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich hängt die Ausrichtung der Institute<br />
von den Spezialgebieten ihrer Direktoren<br />
ab. Berufen werden nur herausragende<br />
Wissenschaftler, denen die Max-Planck-<br />
Gesellschaft dann viele Freiheiten gewährt.<br />
„Das betrifft beispielsweise die Wahl der<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter, des Themas<br />
oder der Methoden“, so Präsident Gruss.<br />
Ein Prinzip, das funktioniert: Bis heute gingen<br />
14 Nobelpreise an Max-Planck-Forscher.<br />
Übernommen hat die Max-Planck-Gesellschaft<br />
die Idee von ihrer Vorgängerorganisation, der<br />
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.<br />
Mit dem auf Spitzenforscher fokussierten<br />
Konzept hatte es die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft<br />
innerhalb weniger Jahre auf 15 Nobelpreise<br />
gebracht. Trotz ihres wissenschaftlichen<br />
Erfolgs wurde sie jedoch zum Ende des<br />
Zweiten Weltkriegs aufgelöst. Während der<br />
Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland<br />
hatten einige der Forscher <strong>mit</strong> dem Regime<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
kooperiert, ethische Grenzen weit überschritten<br />
<strong>und</strong> Verbrechen durch ihre Arbeit zum<br />
Teil erst ermöglicht. Doch der letzte Präsident<br />
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der deutsche<br />
Physiker <strong>und</strong> Nobelpreisträger Max Planck,<br />
galt als unbelastet <strong>und</strong> konnte eine Art Auffanggesellschaft<br />
etablieren. Unter dem Namen<br />
Max-Planck-Gesellschaft <strong>und</strong> finanziert aus<br />
öffentlichen Mitteln fügte die bewusste Neugründung<br />
1948 den Verein schließlich formal<br />
in die demokratische Struktur der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland ein.<br />
Laserrad im Fokus: Am neuen MPI für die Physik des Lichts<br />
werden kompakte optische Datenspeicher erforscht<br />
Das Prinzip, Gr<strong>und</strong>lagenforschung außerhalb<br />
der Universitäten zu organisieren, behielt die<br />
Max-Planck-Gesellschaft bei: „Von Anfang an<br />
war die Aufgabe der Kaiser-Wilhelm-Institute,<br />
auf diese Weise neue Forschungsfelder zu erschließen“,<br />
sagt Peter Gruss. „Voraussetzung<br />
war die Freiheit, sich nicht an den klassischen<br />
Disziplinen <strong>und</strong> Lehrverpflichtungen orientieren<br />
zu müssen.“ Bereits die erste Neugründung<br />
in Berlin-Dahlem betraf ein Gebiet, das<br />
an den deutschen Universitäten keinen Platz<br />
gef<strong>und</strong>en hatte. „Der Chemiker Otto Hahn<br />
hatte sich auf die noch junge Radiochemie<br />
spezialisiert“, erzählt Gruss. Als der spätere<br />
Nobelpreisträger an der Universität keinen<br />
Lehrstuhl erhielt, machte ihn die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft<br />
zum Direktor des Instituts<br />
für Chemie.<br />
Optimale Forschungsbedingungen<br />
Heute unterhält die Max-Planck-Gesellschaft<br />
weltweit 80 Institute, in denen fast 5 000 Wissenschaftler<br />
<strong>und</strong> mehr als 7 000 Nachwuchsforscher<br />
aus dem In- <strong>und</strong> Ausland arbeiten.<br />
Einer von ihnen ist der Kanadier Douglas<br />
Staple: Der <strong>DAAD</strong>-Stipendiat ist seit 2008<br />
© 1. MPG, 2. MPG-W. Filser, 3. MPI f.d. Physik d. Lichts-P. Banzer<br />
WiSSENSchaft<br />
in Deutschland, um zu promovieren. Sein<br />
Arbeitsplatz ist das Max-Planck-Institut für<br />
Physik komplexer Systeme in Dresden. „Die<br />
Max-Planck-Gesellschaft hat weltweit eine<br />
ausgezeichnete Reputation. Deshalb fiel die<br />
Wahl leicht.“ Spezialgebiet des 25-Jährigen ist<br />
die Biophysik, die Methoden aus der Physik in<br />
der Biologie anwendet. „Wir arbeiten <strong>mit</strong> dem<br />
Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie<br />
<strong>und</strong> Genetik zusammen“, berichtet Staple.<br />
„Dadurch habe ich optimale Bedingungen für<br />
meine Forschung.“<br />
Insgesamt spielen Kooperationen eine wichtige<br />
Rolle in der Max-Planck-Gesellschaft. Ein<br />
Großteil der Forscher übernimmt Aufgaben<br />
in der Lehre oder engagiert sich gemeinsam<br />
<strong>mit</strong> Universitäten in Projekten <strong>und</strong> Exzellenz-<br />
Clustern. Weitere Partner sind die Fraunhofer-<br />
Institute, deren überwiegend anwendungsorientierte<br />
Arbeit von der Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
der Max-Planck-Gesellschaft profitiert. Verschiedene<br />
Disziplinen forschen auch innerhalb<br />
der einzelnen Max-Planck-Institute traditionell<br />
zusammen – wie bald am designierten<br />
MPI für Intelligente Systeme, <strong>mit</strong> dem die<br />
Max-Planck-Gesellschaft erstmals maschinelles<br />
Lernen, Bilderkennung, Robotik <strong>und</strong> biologische<br />
Systeme unter einem Dach vereint.<br />
Bettina Röckl<br />
100 Years of<br />
Top-Flight Research<br />
The Max Planck Society (MPG) is one of the best<br />
non-university research establishments in the<br />
world. The MPG currently has 80 member institutes,<br />
where scientists carry out top-flight f<strong>und</strong>amental<br />
research. Their flexible structure allows the<br />
institutes to address current challenges, such as<br />
climate change, epidemics and financial market<br />
crises. In 2011 the MPG is celebrating the 100th<br />
year of its successful design, which began in 1911<br />
with the fo<strong>und</strong>ing of the Kaiser Wilhelm Society<br />
for the Advancement of Science. The Society’s<br />
history has been varied: its top researchers have<br />
won 29 Nobel prizes, but have also included<br />
scientists who participated in crimes of the Nazi<br />
regime. For that reason, the Society was reorganized<br />
after democratic principles in 1948, and<br />
renamed after its former president Max Planck.<br />
23
24 trENdS<br />
auf der Suche nach<br />
dem besseren maß<br />
Neue Indikatoren für eine lebenswerte <strong>und</strong> nachhaltige Zukunft<br />
Das Wohl einer Gesellschaft stellt sich<br />
nicht allein in wirtschaftlichen Wachstumsraten<br />
dar. Auch Umweltschäden <strong>und</strong><br />
andere negative Folgen lassen das Bruttoinlandsprodukt<br />
(BIP) steigen, <strong>und</strong> über<br />
Glück <strong>und</strong> Zufriedenheit sagt der Index<br />
letztlich nichts aus. Wie viele andere europäische<br />
Länder sucht Deutschland nach<br />
neuen Messmethoden.<br />
Ein Autounfall kann wirtschaftlich betrachtet<br />
ein Glücksfall sein. Der Fahrer muss<br />
ärztlich versorgt werden. Das steigert den Umsatz<br />
im Ges<strong>und</strong>heitssektor. Der Stau, der sich<br />
bildet, erhöht den Benzinverbrauch. Der Fahrer<br />
kauft später ein neues Auto <strong>und</strong> nutzt da<strong>mit</strong><br />
der Autoindustrie. Dass der Mensch durch<br />
den Unfall vielleicht ein lebenslanges Trauma<br />
hat, der Schrott seines Wagens den Müllberg<br />
erhöht <strong>und</strong> die Abgase im Stau die Umwelt<br />
belasten, ist wenig erfreulich. Die negativen<br />
Effekte schlagen sich in der ökonomischen,<br />
über den Markt ausgetauschten Wirtschaftsleistung<br />
– dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) –<br />
nicht nieder.<br />
„Wohlfahrt“ ist der Fachbegriff der Volkswirtschaftler<br />
für individuelles Wohlergehen<br />
<strong>und</strong> gesellschaftlichen Fortschritt. Die Erfahrung<br />
vieler Jahrh<strong>und</strong>erte technologischen<br />
Fortschritts ist, dass es Menschen <strong>mit</strong> steigendem<br />
Wohlstand besser geht. Die Methode,<br />
die Wirtschaftsleistung in einer einzigen Zahl<br />
– dem BIP – zu erfassen, entstand 1929 während<br />
der Weltwirtschaftskrise. Als Wohlfahrtsindikator<br />
war das BIP nicht konzipiert, wurde<br />
aber schnell dazu gemacht <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> regte<br />
sich bald die Kritik. Der Club of Rome, die 1968<br />
gegründete Vereinigung von Persönlichkeiten<br />
aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
aus allen Regionen unserer Erde, verwies<br />
schon 1972 auf die Grenzen des Wachstums.<br />
Enquete-Kommission im B<strong>und</strong>estag<br />
Auch in Deutschland verliert die Vorstellung,<br />
dass <strong>mit</strong> steigendem Pro-Kopf-Einkommen<br />
immer mehr Wohlfahrt erreicht wird, zunehmend<br />
an Überzeugungskraft. Das Diktat permanenten<br />
Wachstums wird in öffentlichen<br />
Vorlesungsreihen kritisch hinterfragt <strong>und</strong> in<br />
den Medien diskutiert. Denn die in Statistiken<br />
festgehaltene Wirtschaftsleistung nehmen viele<br />
Menschen im Alltag nicht mehr wahr. Der<br />
Anstieg des Bruttosozialprodukts heißt nicht<br />
automatisch, dass materieller Wohlstand <strong>und</strong><br />
die Lebensqualität aller Menschen gleichermaßen<br />
wachsen. „Man kann in einem hohen<br />
Bruttosozialprodukt eine Gesellschaft verstecken,<br />
in der es einige sehr reiche <strong>und</strong> viele<br />
arme Menschen gibt“, erklärt der Sozialwissenschaftler<br />
Professor Meinhard Miegel. Auch<br />
wenn gesellschaftliche Gruppen ausgeschlossen<br />
sind, wenn Arbeitslosigkeit hoch oder<br />
Bildung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit niedrig sind, kann<br />
der BIP-Index immer noch hoch sein. „Aber<br />
die Gesellschaft ist dann in einer angespannten<br />
<strong>und</strong> gespaltenen Lage – eine entfriedete<br />
Gesellschaft.“<br />
Meinhard Miegel ist Mitglied einer im Januar<br />
2011 vom deutschen B<strong>und</strong>estag eingesetzten<br />
Arbeitsgruppe, die dabei helfen soll, die Entwicklung<br />
der deutschen Gesellschaft besser<br />
© axeptDESIGN.de<br />
zu beschreiben. Wie gut geht es den Deutschen<br />
wirklich? Die Enquete-Kommission „Wachstum,<br />
Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu<br />
nachhaltigem Wirtschaften <strong>und</strong> gesellschaftlichem<br />
Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“<br />
sucht nach weiteren, aussagekräftigen<br />
Messgrößen, die den BIP-Index ergänzen<br />
könnten. Orientierung bietet dabei auch der<br />
„Human Development Index“ (HDI), den die<br />
Vereinten Nationen jedes Jahr veröffentlichen.<br />
„Um sagen zu können: In dieser Gesellschaft<br />
sind die sozialen Spannungen gering <strong>und</strong> in<br />
ihr fühlen sich Menschen wohl, braucht man<br />
mehr Indikatoren als nur einen, der Wachstum<br />
misst“, betont der Sozialwissenschaftler.<br />
Unter dem Eindruck der Finanzkrise hatte<br />
in Europa bereits 2008 der französische Präsident<br />
Nicolas Sarkozy die Aussagekraft des<br />
BIP für Wohlstand <strong>und</strong> Lebensqualität in Frage<br />
gestellt. Die Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph<br />
E. Stiglitz <strong>und</strong> Amartya Sen leiteten die<br />
eingesetzte Kommission, die 2009 erste Empfehlungen<br />
vorlegte, um Wohlbefinden besser<br />
zu bestimmen. Auch in anderen europäischen<br />
Ländern wie Großbritannien oder Schweden<br />
starteten Initiativen.<br />
Für Deutschland er<strong>mit</strong>telten der Heidelberger<br />
Wirtschaftswissenschaftler Professor<br />
Hans Diefenbacher <strong>und</strong> der Berliner Nachhaltigkeitsforscher<br />
Roland Zieschank <strong>mit</strong><br />
Unterstützung des B<strong>und</strong>esumweltamtes den<br />
„Nationalen Wohlfahrtsindex“ (NWI). In diese<br />
Berechungen <strong>mit</strong> 21 Variablen fließen nicht<br />
nur Dienstleistungen <strong>und</strong> Güter <strong>mit</strong> ein. Die<br />
privaten Konsumausgaben werden <strong>mit</strong> der<br />
Einkommensverteilung gewichtet, um Verteilungsprobleme<br />
abzubilden. Positiv dazu<br />
gerechnet werden außerdem Hausarbeit <strong>und</strong><br />
ehrenamtliche Tätigkeit. „Solche Leistungen<br />
schaffen Wohlfahrt, werden aber nicht über<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
den Markt ver<strong>mit</strong>telt“, sagt Hans Diefenbacher<br />
von der Forschungsstätte der Evangelischen<br />
Studiengemeinschaft Heidelberg. Schließlich<br />
wird dagegen gerechnet, was der Wohlfahrt<br />
schadet: Ökologische Schäden, CO2-Ausstoß,<br />
Ressourcenverbrauch, aber auch Kosten für<br />
Verkehrsunfälle, Kriminalität <strong>und</strong> von Alkohol<br />
<strong>und</strong> Drogen verursachte Krankheiten. Das Ergebnis:<br />
Der Nationale Wohlfahrtsindex steigt<br />
in Deutschland, wenn überhaupt, wesentlich<br />
flacher an als das BIP. Seit dem Jahr 2000 werden<br />
in einer Reihe von Jahren sogar Rückgänge<br />
verzeichnet.<br />
Geld allein macht nicht glücklich<br />
Die Suche nach neuen Berechnungsmethoden<br />
ist längst nicht abgeschlossen. Einen<br />
„Fortschrittsindex“ legte 2010 das Zentrum<br />
für gesellschaftlichen Fortschritt in Frankfurt<br />
am Main vor, um gesellschaftliche, ökonomische<br />
<strong>und</strong> ökologische Entwicklungen<br />
abzubilden. Der Index sieht Deutschland auf<br />
einem moderaten Kurs nach vorne. Die Stiftung<br />
„Denkwerk Zukunft“, der Meinhard<br />
Miegel vorsteht, legte ein Memorandum für<br />
ein umfassendes Wohlstandsverständnis vor:<br />
Im „Wohlstandsquartett“ werden auch gesellschaftliche<br />
<strong>und</strong> ökologische Indikatoren berücksichtigt.<br />
Der Deutsche Studienpreis 2010<br />
zeichnete eine Dissertation zu einem neuen<br />
Wohlfahrtsmaß aus; er ging an Martin Binder<br />
vom Max-Planck-Institut für Ökonomik<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
in Jena. „Für gesellschaftlichen Fortschritt ist<br />
auch die Suche nach dem Glück relevant“, sagt<br />
der Evolutionsökonom, der für seine Methode<br />
zur Messung von Wohlfahrt auch empirische<br />
Erkenntnisse aus der Glücksforschung, der<br />
Psychologie, Biologie <strong>und</strong> Neurowissenschaft<br />
heranzog. „Man weiß inzwischen, dass ein<br />
Einkommen über einer bestimmten Schwelle<br />
nicht mehr so wichtig ist für das Glück der<br />
Individuen“, sagt Martin Binder. Von Bedeutung<br />
sind soziale Kontakte, Familie, Selbstbestimmung<br />
im Berufsleben oder ehrenamtliche<br />
Arbeit. „All das ist glückstiftend für Menschen<br />
<strong>und</strong> tritt neben das reine Einkommensmaß.“<br />
Um eine völlige Abkehr vom BIP-Index<br />
geht es in den unterschiedlichen Vorschlägen<br />
nicht. Die Gleichung „steigendes BIP = steigendes<br />
Wohlergehen“ kann für eine Gesellschaft<br />
stimmen, in der die Wirtschaft wenig entwickelt<br />
ist. „Es gibt Gegenden auf der Welt, wo<br />
wir traditionelles Wirtschaftswachstum brauchen,<br />
also mehr Gr<strong>und</strong>bedarfsgüter, Infrastruktur,<br />
Krankenhäuser oder Schulen“, sagt<br />
Hans Diefenbacher. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass sich in armen Ländern eine steigende<br />
Sozialproduktgröße <strong>und</strong> ein steigendes Pro-<br />
Kopf-Einkommen auch auf das Wohlergehen<br />
der Gesellschaft auswirken, ist hoch. „Diese<br />
Verbindung lässt sich aber nicht aufrechterhalten,<br />
je reicher ein Land bereits ist <strong>und</strong> je<br />
umweltschädlicher es wirtschaftet.“<br />
Bettina Mittelstraß
26 EUropa<br />
aufbruch<br />
nach Europa<br />
Georgien auf dem Weg in den europäischen Hochschulraum<br />
Georgien ist noch kein offizieller<br />
Beitrittskandidat der Europäischen<br />
Union. Seit 2005<br />
gehört die ehemalige Sowjetrepublik<br />
aber zu den Ländern,<br />
die im Namen des Bologna-<br />
Prozesses einen gemeinsamen<br />
europäischen Hochschulraum<br />
aufbauen. In den vergangenen<br />
Monaten haben deutsche <strong>und</strong><br />
französische Professoren <strong>und</strong><br />
Verwaltungsprofis ihre georgischen<br />
Kollegen dabei unterstützt,<br />
das Hochschulsystem<br />
dafür fit zu machen.<br />
In Deutschland arbeiten Hochschulen<br />
bereits seit zehn Jahren<br />
an der Umstellung der Studiengänge<br />
auf das Bachelor- <strong>und</strong><br />
Mastersystem – Georgien hat<br />
sein gesamtes Hochschulsystem<br />
innerhalb von zwei Jahren reformiert.<br />
Kein W<strong>und</strong>er, dass nach<br />
einer solchen „Turbo-Reform“<br />
einiges ungeklärt blieb: Entsprechen<br />
die gesetzlichen Bedingungen<br />
in Georgien überhaupt den<br />
Bologna-Vorgaben? Wie können<br />
Bildungsministerium, Akkreditierungsagentur<br />
<strong>und</strong> Hochschulen<br />
kooperieren <strong>und</strong> gleichzeitig unabhängig<br />
bleiben?<br />
Universität von Tbilissi<br />
Werden georgische Studienabschlüsse<br />
in anderen Mitgliedsländern<br />
anerkannt? Und wie kann<br />
Georgien optimal von internationalen<br />
Hochschulkooperationen<br />
profitieren? Solche Fragen nahmen<br />
deutsche <strong>und</strong> französische<br />
Professoren <strong>und</strong> Verwaltungsprofis<br />
gemeinsam <strong>mit</strong> den georgischen<br />
Kollegen unter die Lupe.<br />
Die EU sandte die Berater ins<br />
Land, der <strong>DAAD</strong> <strong>und</strong> das Centre<br />
international d’études pédagogiques<br />
(CIEP) organisierten die<br />
Expertenmissionen.<br />
Von Deutschland geprägt<br />
„Für den <strong>DAAD</strong> war das Projekt<br />
eine gute Gelegenheit, <strong>mit</strong>hilfe<br />
seines großen internationalen<br />
Expertennetzwerks die ohnehin<br />
engen Beziehungen zu Georgien<br />
© Wikipedia<br />
zu stärken“, sagt Cay Etzold vom<br />
<strong>DAAD</strong>, der in Tbilissi die Expertenmissionen<br />
koordinierte. Seit<br />
Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts ist<br />
das wissenschaftliche Denken<br />
stark von deutschen <strong>und</strong> europäischen<br />
Wissenschaftlern geprägt,<br />
sie unterstützten 1918 die erste<br />
Hochschulgründung. „Heute gibt<br />
es zahlreiche Kooperationen zwischen<br />
georgischen <strong>und</strong> deutschen<br />
Hochschulen. Deutschland ist bei<br />
georgischen Studierenden das beliebteste<br />
Studienland“, erklärt Cay<br />
Etzold.<br />
Die Qualitätssicherung an den<br />
georgischen Hochschulen war ein<br />
wichtiges Ziel des EU-Projekts.<br />
„Es gab Zeiten, da konnte jeder<br />
eine Universität in Georgien eröffnen.<br />
Ende der 1990er Jahre existierten<br />
in dem kleinen Land über<br />
Steckbrief<br />
Was wurde gefördert?<br />
Mit dem Twinning-Instrument fördert die EU den Auf- <strong>und</strong><br />
Ausbau öffentlicher Strukturen in ihren Beitritts- <strong>und</strong><br />
Nachbarländern. In diesem Projekt ging es darum,<br />
Georgien stärker in den Europäischen Hochschulraum zu<br />
integrieren.<br />
Wer war zuständig?<br />
Das Projekt wurde vom georgischen Bildungs- <strong>und</strong><br />
Wissenschaftsministerium <strong>und</strong> dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Bildung <strong>und</strong> Forschung in Kooperation <strong>mit</strong> dem<br />
<strong>DAAD</strong> <strong>und</strong> dem französischen Centre international<br />
d’études pédagogiques (CIEP) durchgeführt. Für das<br />
Finanzmanagement war die Deutsche Gesellschaft für<br />
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zuständig.<br />
Wie lange lief das Projekt?<br />
Beginn war im Juni 2009. Das Projekt endete nach 21<br />
Monaten im März 2011.<br />
Wie viel Geld war im Spiel?<br />
Die EU stellte 1,1 Millionen Euro bereit.<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© Tamar Kobuladze
Reformen angestoßen:<br />
Nodar Surguladze, stellvertretender<br />
Minister für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
(rechts) <strong>und</strong> Cay Etzold<br />
(<strong>DAAD</strong>)<br />
260 Hochschulen“, berichtet Julia<br />
Schwarzenberger, die das Projekt<br />
vom <strong>DAAD</strong> in Bonn aus betreut.<br />
Erst durch den Bologna-Prozess<br />
sei eine Prüfung für die Gründung<br />
von Hochschulen geschaffen<br />
worden.<br />
Zurzeit entwickeln Bildungsministerium,Akkreditierungsinstitut<br />
<strong>und</strong> Hochschulen gemeinsam<br />
Methoden <strong>und</strong> Kriterien, um<br />
Hochschulen <strong>und</strong> Studiengänge<br />
zu evaluieren. Ein Mitarbeiter einer<br />
deutschen Akkreditierungsagentur<br />
informierte <strong>und</strong> beriet<br />
seine Kollegen bei der georgischen<br />
Akkreditierungsagentur<br />
<strong>und</strong> die Mitarbeiter, die an den<br />
Hochschulen für Qualitätssicherung<br />
zuständig sind. Gemeinsam<br />
spielten sie durch, wie die Uni<br />
sich selbst darstellen möchte,<br />
welche Inhalte in den Studiengängen<br />
behandelt werden sollen <strong>und</strong><br />
wie viele Kreditpunkte es dafür<br />
gibt. So wurden die gesetzlichen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen angepasst, Indikatoren<br />
zur Qualitätssicherung aufgestellt,<br />
ein nationaler Qualifikationsrahmen<br />
entwickelt, Anstöße<br />
für neue Hochschulpartnerschaften<br />
geschaffen, Kooperationen <strong>mit</strong><br />
Wirtschaftsverbänden angeregt<br />
<strong>und</strong> vieles mehr.<br />
Cay Etzold <strong>und</strong> Julia Schwarzenberger<br />
ziehen ein positives Fazit:<br />
Insgesamt 123 Kurzzeiteinsätze<br />
<strong>mit</strong> fast 40 Experten aus sechs europäischen<br />
Ländern lautet die Bilanz<br />
der vergangenen 21 Monate.<br />
Nun soll das erfolgreiche Projekt<br />
in benachbarte Länder wie Armenien<br />
oder Aserbaidschan getragen<br />
werden. Jana Degener<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Die Welt entdecken:<br />
Stipendien machen es möglich<br />
Nachrichten<br />
ERASMUS<br />
Neue Rekordzahlen<br />
Das ERASMUS-Programm der<br />
Europäischen Union bleibt auf<br />
Erfolgskurs: R<strong>und</strong> 29 000 Studierende<br />
aus Deutschland haben im<br />
Hochschuljahr 2009/2010 eine<br />
Förderung erhalten: über 24 000<br />
für ein drei- bis zwölfmonatiges<br />
Auslandsstudium, fast 5 000 für<br />
ein Praktikum. Da<strong>mit</strong> erreichte<br />
ERASMUS einen neuen Höchststand<br />
in Deutschland.<br />
Inzwischen nehmen 31 Staaten<br />
an ERASMUS teil. Neben den<br />
27 EU-Ländern sind das Island,<br />
Liechtenstein, Norwegen <strong>und</strong> die<br />
Türkei sowie künftig Kroatien<br />
<strong>und</strong> die Schweiz. Die gefragtesten<br />
Ziele der deutschen Studierenden:<br />
Spanien (20 Prozent), Frankreich<br />
(18 Prozent) <strong>und</strong> Großbritannien<br />
(12 Prozent). Die Praktikanten zog<br />
es in dieselben Länder, wenn auch<br />
in anderer Reihenfolge: Großbritannien<br />
rangiert als Zielland<br />
ganz oben, gefolgt von Spanien<br />
<strong>und</strong> Frankreich. Auch deutsche<br />
Dozenten macht ERASMUS mobil:<br />
2 805 unterrichten an einer ausländischen<br />
Hochschule.<br />
Mobilitätsstipendien<br />
Gerda Henkel Stiftung gibt<br />
Millionen<br />
Historiker, Archäologen, Kunsthistoriker<br />
<strong>und</strong> Islam-Wissenschaftler<br />
<strong>mit</strong> internationalen Forschungsvorhaben<br />
haben einen neuen<br />
Gönner: Die 1976 gegründete Gerda<br />
Henkel Stiftung <strong>und</strong> die Europäische<br />
Union stellen gemeinsam<br />
7,5 Millionen Euro für 100 Forschungsstipendien<br />
bereit, wobei<br />
die Stiftung 60 Prozent, die EU 40<br />
Prozent finanzieren. Die künftigen<br />
Stipendiaten sollen den größten<br />
Teil der zweijährigen Laufzeit<br />
© istockphoto.com<br />
an einer Institution ihrer Wahl im<br />
Ausland verbringen. Die Themen<br />
sind frei wählbar. Bewerben können<br />
sich erfahrene Forscher <strong>und</strong><br />
Nachwuchswissenschaftler ohne<br />
Altersbeschränkungen.<br />
Bewerbungsschluss: 30. Juni 2011<br />
www.gerda-henkel-stiftung.de<br />
Bologna-Prozess/Ingenieure<br />
Universitäten unterstützen<br />
Bachelor<br />
Die ingenieurwissenschaftlichen<br />
Fakultäten aller deutscher Universitäten<br />
(4ING) haben sich gemeinsam<br />
<strong>mit</strong> der Vereinigung der<br />
Arbeitgeber <strong>und</strong> der deutschen<br />
EUropa<br />
Industrie hinter die neuen Abschlüsse<br />
Bachelor <strong>und</strong> Master für<br />
Ingenieure gestellt. Im Gegensatz<br />
zu den neun führenden Technischen<br />
Universitäten TU9, die den<br />
Titel „Diplom-Ingenieur“ retten<br />
wollen (Letter berichtete), sprechen<br />
sich die Universitätsvertreter<br />
für die gestuften Studiengänge<br />
aus. Diese entstanden im Zuge der<br />
Bologna-Reform.<br />
Studierende sollen sich im Lauf<br />
des Studiums umorientieren können<br />
<strong>und</strong> nach dem Bachelor „zu<br />
einem eher anwendungs- oder einem<br />
forschungsorientierten Mas -<br />
ter in der gleichen oder einer anderen<br />
Disziplin“ wechseln können.<br />
Dabei müsse der Zugang zum<br />
Masterstudium von der Leistung<br />
abhängen. Starre Quoten lehnen<br />
4ING, Arbeitgeber <strong>und</strong> Industrie<br />
in ihrem im März 2011 veröffentlichten<br />
gemeinsamen Eckepunktepapier<br />
ab. KS<br />
Anzeige<br />
27
28 rätSEl<br />
rätSEl<br />
WEr War’S<br />
Professor Grübler fragt<br />
Geboren ist er zur Zeit des deutschen Kaiserreichs als neuntes Kind einer jüdischen Familie. Gestorben ist er als<br />
Bürger der DDR.<br />
Seine Eltern müssen sich oft gefragt haben: Was soll aus dem Jungen bloß mal werden? Denn als junger Erwachsener<br />
zieht er selbstkritisch eine erste Lebensbilanz: „Ich war von der Schule fortgelaufen <strong>und</strong> hatte als Kaufmann<br />
versagt. Ich war Student geworden <strong>und</strong> hatte kein Examen zuwege gebracht. Ich hatte mich als Dichter versucht<br />
<strong>und</strong> war gescheitert.“ Endlich gelingt ihm doch noch der ersehnte Aufstieg auf der wissenschaftlichen Karriereleiter:<br />
Promotion <strong>mit</strong> 31 Jahren, im Jahr darauf bereits die Habilitation <strong>mit</strong> einer Arbeit über den französischen Philosophen<br />
Montesquieu. Danach: Professor für Romanistik.<br />
Wegen seiner jüdischen Herkunft verliert er in der Hitler-Ära seine Professur, lebt völlig zurückgezogen in Dresden.<br />
Der Deportation in ein KZ entgeht er dank der Tapferkeit seiner nicht-jüdischen Ehefrau Eva, einer Pianistin. Sie hält<br />
treu zu ihm <strong>und</strong> weigert sich immer wieder, in die von den Nazi-Behörden geforderte Scheidung einzuwilligen.<br />
1947 veröffentlicht er ein Buch, in dem er darlegt, wie die Nazis die deutsche Sprache durch systematische Wort-<br />
Hervorhebungen <strong>und</strong> Umdeutungen in den Dienst ihrer Propaganda gestellt haben. Seine große Bekanntheit verdankt<br />
der Professor aber einem Werk, das<br />
erst 36 Jahre nach seinem Tod in einem<br />
In der deutschen Sprache gibt es eine Fülle von Verben, um Geräusche zu beschreiben.<br />
Einige Beispiele: Der Regen prasselt. Die Tür quietscht. Der Motor dröhnt. Hier sollen<br />
weitere Verben gef<strong>und</strong>en werden, die <strong>mit</strong> Geräusch <strong>und</strong> Klang zu tun haben <strong>und</strong> die in<br />
den jeweiligen Zusammenhang passen. Die gekennzeichneten Buchstabenfelder ergeben<br />
hintereinander gelesen das Lösungswort. Umlaute kommen nicht vor. Die Lösung<br />
stammt ebenfalls aus der Welt des Hörens – <strong>und</strong> ist identisch <strong>mit</strong> dem Romantitel eines<br />
bekannten deutschen Schriftstellers.<br />
Ein wachsamer H<strong>und</strong>: Er bei Gefahr<br />
Im Theater: Das zufriedene Publikum in die Hände<br />
Beim Wasserkochen: Schließlich der Dampfkessel<br />
Herbstspaziergang: Das Laub im Wind<br />
Ein Alarm-Signal: Plötzlich die Sirene<br />
Weitgehende Ruhe: Im Zimmer nur die Wanduhr<br />
In der Grünanlage: Unter den Schuhsohlen der Kies<br />
Im Wald: Der Specht gegen die Baumrinde<br />
Musikalischer Anfänger: Er auf dem Klavier<br />
Typisch für eine Ziege: Sie<br />
Auf dem Schulhof: Das Glöckchen<br />
<strong>und</strong> ruft zum Unterricht<br />
<strong>und</strong> verlangt Futter<br />
Wegen der Pünktlichkeit: Morgens der Wecker<br />
Lösungswort<br />
Schreiben Sie das Lösungswort an t<br />
Unter den richtigen Lösungen werden zehn Hauptgewinne <strong>und</strong> fünf Trostpreise vergeben. Bei<br />
diesem Rätsel nehmen an der Auslosung nur Einsendungen von Leserinnen <strong>und</strong> Lesern teil, deren<br />
Muttersprache nicht Deutsch ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte die vollständige Adresse<br />
des Absenders angeben!<br />
DIE GEWINNER KÖNNEN ZWISCHEN FOLGENDEN PREISEN WÄHLEN:<br />
1. Duden – Die deutsche Rechtschreibung. Dudenverlag<br />
2. Duden – Zitate <strong>und</strong> Aussprüche. Herkunft <strong>und</strong> aktueller Gebrauch. Dudenverlag<br />
3. Grimms Märchen. Vollständige Ausgabe. Mit Illustrationen<br />
von Otto Ubbelohde. Köln: Anaconda Verlag<br />
4. Lied – gut! Die schönsten deutschen Volkslieder.<br />
Calmus Ensemble Leipzig. Edition chrismon<br />
Bitte geben Sie <strong>mit</strong> der Lösung auch den von Ihnen gewünschten Preis an.<br />
Berliner Verlag herauskommt: Es sind seine<br />
Tagebuch-Aufzeichnungen aus der Nazi-Zeit,<br />
die er sorgsam versteckt hatte.<br />
Beklemmend anschaulich hat er darin notiert,<br />
was er als Jude während der zwölf<br />
Schreckensjahre erlebt <strong>und</strong> durchlitten hat:<br />
die alltägliche Diskriminierung, seine Angstträume,<br />
den Umgang <strong>mit</strong> der ständigen<br />
Ungewissheit. Zahllose private Gespräche<br />
von Nazis <strong>und</strong> Antinazis über das Regime,<br />
Gerüchte, Witze, scheinbar belanglose Beobachtungen<br />
auf der Straße, Schlussfolgerungen<br />
aus seiner Zeitungslektüre – all dies<br />
hat er fast Tag für Tag akribisch festgehalten<br />
<strong>und</strong> reflektiert. Da<strong>mit</strong> hinterlässt er für die<br />
Nachgeborenen ein Buch, das bewegend<br />
<strong>und</strong> authentisch wie kaum ein anderes das<br />
Leben <strong>und</strong> Überleben eines Verfolgten unter<br />
Hitler nachzeichnet.<br />
Professor Grübler fragt: Wer war’s?<br />
Unter den richtigen Lösungen werden<br />
fünf Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg<br />
ist ausgeschlossen. Bitte wählen Sie unter<br />
den links unten genannten Preisen.<br />
Senden Sie die Lösung an t<br />
!<br />
Redaktion <strong>DAAD</strong> Letter<br />
Trio MedienService GbR<br />
Chausseestraße 103<br />
10115 Berlin, Germany<br />
Fax: +49 30/85 07 54 52<br />
E-Mail: raetsel@trio-medien.de<br />
Einsendeschluss ist der 4. Juli 2011<br />
Die Lösung <strong>und</strong> die Gewinner<br />
der vorigen Letter-Rätsel<br />
finden Sie auf Seite 42<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
SprachWErkStatt<br />
Schlagen Sie nach!<br />
Für die deutsche Rechtschreibung<br />
gibt es ein ein Standardwerk<br />
zum Nachschlagen: Nachschlagen: den<br />
Duden. Was es <strong>mit</strong> <strong>mit</strong> diesem<br />
Buch auf sich hat <strong>und</strong> auf<br />
wen es zurückgeht, lesen Sie<br />
im folgenden Text. Dort sind<br />
an 30 Stellen Rechtschreibfehler<br />
versteckt, die zu finden<br />
sind. Im Zweifelsfall schlagen<br />
Sie doch einfach im Duden<br />
nach! Das geht auch unter<br />
www.duden.de.<br />
Vielleicht Vielleicht haben Sie ihn schon öfter zur Hand genommen: den Duden, das grosse StanStandardwerk der deutschen Rechtschreibung. In seiner aktuelen Ausgabe, der 25. Auflage<br />
von 2009, sind r<strong>und</strong> 135 000 Stichwörter enthalten. Drei Jahre zuvor war nach langem<br />
hin <strong>und</strong> her <strong>und</strong> gründlicher Überarbeitung die jüngste deutsche Rechtschreibreform<br />
entgültig <strong>und</strong> verbindlich in kraft getreten.<br />
Der Mann, der dem Werk seinen Nahmen gab, war Konrad Alexander Friedrich Duden<br />
(1829 – 1911), dessen Todestag sich am 1. August dieses Jahres zum h<strong>und</strong>ertstenmal<br />
jährt. Gebohren wurde er als Sohn eines Gutsbesitzers bei Wesel. Nach dem Abitur studierte<br />
er in Bonn Filologie, Germanistik <strong>und</strong> Geschichte. Im Revolutionsjahr 1848 brach<br />
er sein Studium ab <strong>und</strong> nahm in Frankfurt am Main eine Stelle als Hausleerer an. Sein<br />
Staatsexamen holte er 1854 nach <strong>und</strong> promovierte anschliessend an der Universität Marburg.<br />
Kurz darauf ging er als Hauslehrer nach Italien, wo er Adeline Jakob kennenlernte,<br />
die später (1861) seine Ehefrau <strong>und</strong> Mutter der sechs gemeinsamen Kinder wurde.<br />
1859 nach Deutschland zurück gekehrt, unterichtete Konrad Duden zunächst zehn Jahre<br />
an einem Soester Gymnasium. Danach wurde er Director eines Gymnasiums in Schleiz<br />
<strong>und</strong> begann schon bald, Rechtschreibregeln für seine Schule zu erarbeiten. Das besondere<br />
an diesen Regeln: Sie richteten sich erstmals am Prinzip der Fonetik aus – gemäss<br />
dem Motto: Schreibe, wie Du sprichst.<br />
Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 bewirkte, daß nun für ganz Deutschland<br />
allgemein gültige Rechtschreibregeln eingeführt werden sollten. Zwar wurden die Reformbestrebungen<br />
1876 durch das Veto des Reichskanzlers Otto von Bismarck zunächst<br />
zunichte gemacht. Doch Duden, der im selben Jahr Direktor des Königlichen Gymnasiums<br />
in Bad Hersfeld wurde, liess sich nicht beirren <strong>und</strong> veröfentlichte 1880 sein „Vollständiges<br />
Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Der heute so genannte<br />
„Uhrduden“ enthielt 27 000 Stichwörter <strong>und</strong> bildete die Gr<strong>und</strong>lage für eine einheitliche<br />
Rechtschreibung im deutschen. Es dauerte aller Dings noch weitere zwölf Jahre, bis der<br />
deutsche B<strong>und</strong>esrat beschloß, Dudens Regeln als verbindlich für das gesammte deutsche<br />
Reich einzuführen – ein Beschluss, den auch Österreich-Ungarn <strong>und</strong> die Schweiz<br />
übernamen.<br />
Erst <strong>mit</strong> 76 Jahren ging Konrad Duden in den Ruhestand. Doch auch dann wollte er nicht<br />
kürzer treten, sondern arbeitete weiter <strong>mit</strong> in der Dudenredaktion, die er noch bis zur<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertwende fast allein geführt hatte. Am 1. August 1911 ferstarb er in Sonnenberg<br />
bei Wiesbaden <strong>und</strong> wurde im Familiengrab in Bad Hersfeld beigesetzt.<br />
Christine Hardt<br />
LÖSUNG: große; aktuellen; Hin <strong>und</strong> Her; endgültig; Kraft; Namen; h<strong>und</strong>ertsten Mal; geboren; Philologie;<br />
Hauslehrer; anschließend; zurückgekehrt; unterrichtete; Direktor; Besondere; gemäß; du; dass;<br />
zunichtegemacht; ließ; veröffentlichte; Urduden; Deutschen; allerdings; beschloss; gesamte; Deutsche;<br />
übernahmen; kürzertreten; verstarb.<br />
© Duden<br />
aUfgESpiESSt<br />
Rätselhafte Floskeln<br />
SprachEckE<br />
Wer heutzutage zwischen Flensburg <strong>und</strong> Garmisch<br />
unterwegs ist <strong>und</strong> sich dabei notgedrungen<br />
in Hotels, Gaststätten <strong>und</strong> Geschäften<br />
herumtreibt, wird von der einst vielbeklagten<br />
„Servicewüste Deutschland“ nicht mehr allzu<br />
viel spüren. Vor allem sprachlich nicht. Bis zum<br />
Abwinken wird dem Reisenden ein fre<strong>und</strong>liches<br />
„Kein Problem!“ oder „Sehr gern!“ entgegenschallen<br />
– selbst bei Bitten oder Fragen, die<br />
solche Antworten ein wenig seltsam, vielleicht<br />
sogar übertrieben erscheinen lassen: „Ich hätte<br />
gerne noch ein Bier!“ – „Kein Problem!“. Merkwürdig,<br />
nicht wahr? Und manchmal ein bisschen<br />
nervig. Gerade im weltweit bekannten Kernland<br />
des Gerstensafts sollte es eigentlich nirgendwo<br />
ein Problem sein, einen simplen Zapfhahn<br />
ein Stück weit herumzudrehen <strong>und</strong> das frische<br />
Bier dem Gast dann <strong>mit</strong> einem schlichten „Bitte<br />
sehr!“ zu servieren.<br />
„Sehr gern!“ übrigens hat bereits vielfach das<br />
alte „Bitte!“ ersetzt – jemand hält einem die Tür<br />
auf, man sagt: „Danke!“ <strong>und</strong> bekommt zur Antwort:<br />
„Sehr gern!“. Oder nur: „Gern!“. Ob die oft<br />
wie angelernt wirkenden Sprach-Fertigteilchen<br />
womöglich nur bedeuten: „Lass mich in Ruhe!“?<br />
Man sollte solche Verbal-Versatzstücke natürlich<br />
nicht nur <strong>mit</strong> Argwohn betrachten <strong>und</strong> darf<br />
durchaus annehmen, dass sie oft guten Willen<br />
transportieren. Auch wenn sie selten einmal<br />
wirklich angemessen sind – <strong>und</strong> die Angemessenheit<br />
der Rede gilt doch seit jeher als ein wichtiges<br />
Element konstruktiver Rhetorik.<br />
Floskeln zu gebrauchen, die alle ständig im M<strong>und</strong>e<br />
führen, ist das Gegenteil von originell <strong>und</strong><br />
da<strong>mit</strong> auch von persönlich. Aber es sind eben<br />
Floskeln, mehr nicht. „Wie geht’s?“ ist ja auch<br />
keine Frage nach dem persönlichen Wohlergehen,<br />
sondern eine unverbindliche Gesprächseinleitung.<br />
Doch anders als beispielsweise in den<br />
USA werden solche sprachlichen Versatzstücke<br />
in Deutschland nicht unbedingt als hilfreich angesehen.<br />
Es kann ein sensibles Gemüt durchaus<br />
stören, wenn es vor sieben Uhr morgens <strong>mit</strong> der<br />
Floskel „Schönen Tag noch!“ aus der Bäckerei<br />
entlassen wird. Der Tag hat doch noch nicht einmal<br />
richtig angefangen! Da lobt man sich denn<br />
doch ganz altmodische Verabschiedungen wie<br />
„Einen guten Morgen!“ oder einfach: „Auf Wiedersehen!“<br />
findet<br />
29
© <strong>DAAD</strong><br />
30<br />
daad report<br />
kritische geister<br />
Führungsnachwuchs auf entwicklungspolitisch relevanten Gebieten<br />
Seit 2008 fördert der <strong>DAAD</strong> fünf deutsch-afrikanische Fachzentren<br />
zur Ausbildung von Führungseliten. Bei einem Treffen<br />
am Fachzentrum für Entwicklungsforschung <strong>und</strong> Strafjustiz<br />
in Kapstadt vereinbarten die Leiter aller Zentren eine stärkere<br />
inhaltliche Vernetzung untereinander.<br />
Lovell Fernandez ist ein ruhiger, besonnener<br />
Mann – doch das Thema Wirtschaftskriminalität<br />
bringt ihn auf. „Korruption <strong>und</strong> Geldwäsche<br />
hemmen die wirtschaftliche Entwicklung<br />
<strong>und</strong> paralysieren viele afrikanische Staaten“,<br />
echauffiert sich der Professor für Strafjustiz<br />
der südafrikanischen University of the Western<br />
Cape (UWC) in Kapstadt. Niemand wisse<br />
genau, wie viel Geld weltweit gewaschen werde.<br />
„Sicher ist, dass Wirtschaftskriminalität<br />
erheblichen Schaden anrichtet, insbesondere<br />
in Entwicklungsländern.“<br />
Entscheidend für die Bekämpfung dieser<br />
Verbrechen seien gut qualifizierte Juristen,<br />
darauf geschult, die sich häufig in internationalen<br />
Verflechtungen abspielenden Machenschaften<br />
strafrechtlich zu verfolgen. „An solchen<br />
Experten mangelt es in Südafrika, wie<br />
auch in vielen anderen Staaten.“ Fernandez<br />
arbeitet daran, diesen Mangel zu beheben: Er<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
Wir sind Afrika:<br />
Vertreter aller fünf Zentren<br />
vernetzen sich<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Wegweisend:<br />
Die künftige Führungselite bildet<br />
sich an den deutsch-afrikanischen<br />
Fachzentren weiter<br />
ist Direktor der Abteilung für Strafjustiz des<br />
<strong>DAAD</strong>-geförderten Südafrikanisch-Deutschen<br />
Fachzentrums für Entwicklungsforschung<br />
<strong>und</strong> Strafjustiz. Hier werden unter anderem<br />
Juristen für die Bekämpfung solcher Verbrechen<br />
ausgebildet.<br />
Seit 2008 fördert der <strong>DAAD</strong> fünf Fachzentren<br />
zur Ausbildung von Führungseliten in<br />
Subsahara-Afrika. Ende Januar trafen sich an<br />
der UWC in Kapstadt Leiter, Mitarbeiter <strong>und</strong><br />
Studierende aller Fachzentren. Sie diskutierten<br />
vor allem, wie sich die Zentren inhaltlich<br />
stärker vernetzen lassen. Die Ergebnisse:<br />
Für 2012 ist ein Workshop der Doktoranden<br />
aller Fachzentren in Namibia vorgesehen,<br />
außer dem soll es eine Alumni-Sommerschule<br />
geben. Und dort, wo es die thematische Ausrichtung<br />
zulässt, werden die einelnen Zentren<br />
enger kooperieren.<br />
Juristen arbeiten zusammen<br />
Das Zentrum für Strafjustiz wird <strong>mit</strong> dem<br />
Tansanisch-Deutschen Fachzentrum für Menschenrechte<br />
<strong>und</strong> internationales Recht in Dar<br />
es Salaam zusammenarbeiten. Die Themengebiete<br />
ergänzen sich: In Dar es Salaam umfasst<br />
das Curriculum Verfassungsrecht, Menschenrechte<br />
<strong>und</strong> Rechtsvergleich <strong>mit</strong> starkem Bezug<br />
zur ostafrikanischen Gemeinschaft. Am<br />
Zentrum für Strafjustiz in Kapstadt geht es<br />
im einjährigen Masterkurs um internationale<br />
Strafjustiz, Strafverfolgung beim Übergang<br />
von einer Staatsform in eine andere, Bekämpfung<br />
von Korruption, Geldwäsche <strong>und</strong> organisierter<br />
Kriminalität.<br />
Pro Jahrgang können sich drei Studierende<br />
für ein weiterführendes PhD-Programm qualifizieren.<br />
Eine von ihnen ist Juliet Okoth aus<br />
Kenia. Die 31-jährige Juristin schloss den Masterkurs<br />
2009 ab <strong>und</strong> geht nun in ihrem PhD-<br />
Studium der Frage nach, warum Konspiration<br />
– also die Verabredung zum Begehen von Verbrechen<br />
– im internationalen Strafrecht nicht<br />
als Straftatbestand behandelt wird <strong>und</strong> ob<br />
dadurch eine Lücke im Rechtssystem besteht.<br />
Was sie in ihrem Studium antreibt? „Prägend<br />
waren vor allem die Gewalteskalationen in ihrer<br />
Heimat nach den Präsidentschaftswahlen<br />
2007“, sagt Juliet Okoth. Nach dem Konflikt<br />
kam die Frage auf, wie man <strong>mit</strong> den Straftätern<br />
verfahren solle. „Da habe ich festgestellt,<br />
© <strong>DAAD</strong><br />
dass es in Kenia an Juristen für diese Themengebiete<br />
fehlt, <strong>und</strong> mich beim Fachzentrum der<br />
UWC beworben.“<br />
Neben Juristen bereiten sich an dem Doppelzentrum<br />
in Kapstadt auch Sozialwissenschaftler,<br />
Politikwissenschaftler <strong>und</strong> Ökonomen auf<br />
leitende Positionen in der Entwicklungszusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> der Regierungsverwaltung<br />
vor. Drei verschiedene Masterstudiengänge<br />
bietet die Abteilung für Entwicklungsforschung<br />
an, ebenso wie ein weiterführendes<br />
PhD-Programm. „In Projekten der Entwicklungszusammenarbeit<br />
besetzen bislang meist<br />
ausländische Experten die Schlüsselpositionen“,<br />
sagt Britta Niklas, Koordinatorin des<br />
Masterprogramms am deutschen Partnerinstitut,<br />
dem Institut für Entwicklungsforschung<br />
Critical Minds<br />
daad<br />
The five German–African Centres of Excellence<br />
train Africa’s future leaders in fields relevant to<br />
development policy. One example: corruption and<br />
money-la<strong>und</strong>ering are hampering the continent’s<br />
economic development. Well-qualified lawyers<br />
are essential to combat these crimes, and they<br />
are being trained at the South African–German<br />
Centre for Development Research and Criminal<br />
Justice in Capetown. At a meeting in Capetown,<br />
the directors of all five Centres of Excellence<br />
resolved to intensify their academic networking.<br />
A workshop for the doctoral candidates of all the<br />
centres is being planned for 2012 in Namibia.<br />
A summer school programme for alumni is also<br />
projected. The Capetown centre in particular will<br />
cooperate with the Tanzanian–German Centre for<br />
Postgraduate Studies in Law in Dar es Salaam.<br />
31
32 daad<br />
<strong>und</strong> Entwicklungspolitik der Ruhr-Universität<br />
Bochum. Dabei sei es für den Erfolg <strong>und</strong> die<br />
Nachhaltigkeit solcher Projekte wichtig, leitende<br />
Positionen <strong>mit</strong> afrikanischem Personal<br />
zu besetzen. Diese Führungselite findet am<br />
Zentrum der UWC eine Ausbildungsstätte.<br />
Wissen anwenden <strong>und</strong> weitergeben<br />
Einer der Studenten im Masterprogramm<br />
für Entwicklungsforschung ist Zoheb Khan.<br />
Nach seinem Bachelorabschluss in Politikwissenschaften<br />
<strong>und</strong> Ökonomie arbeitete er<br />
ein Jahr lang als Sozialarbeiter bei einer<br />
© Jürgen Schulzki<br />
Professor für Strafjustiz Lovell Fernandez:<br />
„Wirtschaftskriminalität richtet erheblichen<br />
Schaden an“<br />
Nichtregierungsorganisation, die sich für eine<br />
bessere Schulbildung in südafrikanischen<br />
Townships einsetzt. „Das hat mich motiviert,<br />
mich eingehender <strong>mit</strong> Entwicklungspolitik zu<br />
befassen“, sagt Khan. Der 24-jährige Südafrikaner<br />
schreibt parallel an zwei Masterarbeiten.<br />
Thema in beiden ist das „Black Economic<br />
Empowerment“-Programm der südafrikanischen<br />
Regierung, das die wirtschaftliche Teilhabe<br />
benachteiligter Bevölkerungsgruppen in<br />
Südafrika erhöhen soll. In der einen Arbeit<br />
untersucht er, wie südafrikanische Unternehmen<br />
<strong>mit</strong> dem Programm umgehen, <strong>und</strong> in der<br />
anderen, wie es sich auf die öffentliche Infrastruktur<br />
auswirkt. „Das Ziel des Programms<br />
ist gut <strong>und</strong> wichtig, aber die Umsetzung wird<br />
kontrovers betrachtet“, sagt Khan. Sie eröffne<br />
beispielsweise neue Möglichkeiten für Korruption.<br />
Sein Thema sei hochsensibel. Wer die<br />
Umsetzung des Programms kritisiere, setze<br />
sich dem Verdacht aus, das Ziel – die verstärkte<br />
wirtschaftliche Teilhabe der schwarzen <strong>und</strong><br />
farbigen Bevölkerung – zu missbilligen.<br />
Kritische Geister wie Zoheb Khan hat das<br />
Fachzentrum am UWC bereits mehrfach hervorgebracht:<br />
Die Abteilung für Strafjustiz hat<br />
30, die Abteilung für Entwicklungsforschung<br />
111 Absolventen. Die große Mehrheit stammt<br />
aus afrikanischen Staaten. „Viele Studierende<br />
melden sich zurück <strong>und</strong> erzählen, sie seien<br />
stolz, das Gelernte für ihr Land anzuwenden“,<br />
sagt Britta Niklas.<br />
Auch Khan möchte sich gerne den Problemen<br />
seiner Heimat widmen, doch er fühlt<br />
sich noch hin- <strong>und</strong> hergerissen: „Es wäre auch<br />
schön, im internationalen Kontext zu arbeiten<br />
<strong>und</strong> andere Länder kennen zu lernen.“ Juliet<br />
Okoth ist sich dagegen sicher, dass sie zurück<br />
nach Kenia gehen wird. Sie würde gerne als<br />
Staatsanwältin für internationales Strafrecht<br />
arbeiten oder an einer kenianischen Universität<br />
lehren. „Wir brauchen mehr qualifizierte<br />
Juristen, um die Probleme unseres Landes anzugehen“,<br />
findet Okoth. Und dabei möchte sie<br />
helfen – indem sie ihr am Fachzentrum erworbenes<br />
Wissen an möglichst viele Studierende<br />
weitergibt. Dietrich von Richthofen<br />
Afrikanisch-Deutsche Fachzentren<br />
Ghanaisch-Deutsches Fachzentrum für Entwicklungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsforschung<br />
Partner: University of Ghana – Universität Bonn (ZEF) <strong>und</strong> Universität Heidelberg<br />
Kongolesisch-Deutsches Fachzentrum für Mikrofinanz<br />
Partner: Université Protestante au Congo – Frankfurt School of Finance and<br />
Management<br />
Tansanisch-Deutsches Fachzentrum für Rechtswissenschaft<br />
Partner: University of Tanzania – Universität Bayreuth<br />
Namibisch-Deutsches Fachzentrum für Logistik<br />
Partner: Polytechnic of Namibia – Fachhochschule Flensburg<br />
Südafrikanisch-Deutsches Fachzentrum für Entwicklungsforschung <strong>und</strong> Strafjustiz<br />
Partner: University of the Western Cape – Ruhr-Universität Bochum <strong>und</strong> Humboldt-<br />
Universität Berlin<br />
www.african-excellence.de<br />
Die Zentren werden über fünf Jahre aus Mitteln der „Aktion Afrika“ des Auswärtigen<br />
Amtes gefördert. Alle Zentren basieren auf bestehenden Beziehungen zu Instituten<br />
deutscher Hochschulen <strong>und</strong> kooperieren auf Augenhöhe <strong>mit</strong> den deutschen Partnern.<br />
kleine<br />
Mit dem Programm „Internationale Netzwerke<br />
Klimawandel“ fördert der <strong>DAAD</strong><br />
Kooperationen in der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung,<br />
um globale Strategien gegen den<br />
Klimawandel zu erarbeiten. Eines von vier<br />
Klimanetzen ist „GrassNet“. Die Wissenschaftler<br />
interessiert, wie sich die klimatischen<br />
Veränderungen auf Graslandschaften<br />
auswirken.<br />
Stürme, Hochwasser, Dürren – der Klimawandel<br />
wird zunehmend spürbar. Auch<br />
dort, wo man ihn am wenigsten erwartet, zum<br />
Beispiel in den riesigen Graslandschaften, die<br />
ein Viertel der Erdlandfläche bedecken. Wie<br />
sie auf den Klimawandel reagieren, untersucht<br />
„GrassNet“, eine internationale Hochschulkooperation,<br />
die sich über vier Kontinente<br />
erstreckt. Beteiligt sind die Universitäten<br />
Hohenheim <strong>und</strong> Kassel-Witzenhausen, das Instituto<br />
Nacional de Tecnologia Agropecuaria in<br />
Argentinien, das Kenya Agricultural Research<br />
Institute <strong>und</strong> die Egerton University in Kenia<br />
sowie die Northeast Normal University in China.<br />
Durch Austausch von Studierenden <strong>und</strong><br />
Wissenschaftlern soll das Wissen über Grasländer<br />
gemehrt <strong>und</strong> deren Verletzlichkeit im<br />
Klimawandel untersucht werden.<br />
„Was hat Gras <strong>mit</strong> klimatischen Veränderungen<br />
zu tun?“, fragen sich viele Laien. Folkard<br />
Asch, Pflanzenphysiologe <strong>und</strong> Agrarökologe<br />
an der Universität Hohenheim <strong>und</strong> Koordinator<br />
von GrassNet, erläutert den Zusammenhang:<br />
„Grasland ist verletzlich <strong>und</strong> wichtig<br />
für die Biodiversität.“ Wenn sich das Klima<br />
ändert, kann die Artenvielfalt der Grasländer<br />
verarmen, weil Wasser <strong>und</strong> Bodentiefe beispielsweise<br />
den Aufwuchs von Bäumen nicht<br />
zulassen. Da viele andere Pflanzenarten von<br />
diesem Lebensraum abhängig sind, können<br />
ganze Ökosysteme veröden.<br />
Der Wandel der Artenzusammensetzung hat<br />
auch wirtschaftliche Folgen. Wenn Grasland<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
pflanze <strong>mit</strong> großer Wirkung<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Fünf Hochschulpartner<br />
untersuchen<br />
die Verletzlichkeit von<br />
Graslandschaften<br />
verarmt, sinkt die Qualität des Futters für<br />
Wiederkäuer, die Milch <strong>und</strong> Fleisch liefern.<br />
In manchen Regionen droht hier ein Teufelskreis,<br />
etwa in China: Dort vernichten Bauern<br />
riesige Grasländer, um Mais für die Schweinezucht<br />
anzubauen. Oder im Norden Argentiniens:<br />
Durch die Klimaerwärmung kann dort<br />
neuerdings Reis angebaut werden, auch dadurch<br />
gehen Graslandflächen verloren.<br />
Ein Teufelskreis<br />
Grasländer auf verschiedenen Kontinenten<br />
haben vieles gemeinsam, es gibt aber auch<br />
regionale Unterschiede. Welche das sind, soll<br />
GrassNet klären. Die dort vertretenen Regionen<br />
<strong>mit</strong> ihren politischen Hintergründen<br />
könnten unterschiedlicher nicht sein: In China<br />
bestimmt die Regierung, wie Land genutzt<br />
wird, in Argentinien dagegen entscheiden das<br />
die Großgr<strong>und</strong>besitzer. Am flexibelsten <strong>und</strong><br />
am stärksten zu Kompromissen bereit sind die<br />
Verantwortlichen in Kenia, weil das Land dort<br />
von Nomaden genutzt wird. Das Klimanetz<br />
kümmert sich deshalb nicht nur um ökologische<br />
Aspekte, wichtig ist ebenso die sozialökologische<br />
Expertise, die von der Universität<br />
Kassel beigesteuert wird.<br />
Geplant ist, dass die Institute an den Partneruniversitäten<br />
in China, Kenia <strong>und</strong> Argentinien<br />
über die fünfjährige Projektlaufzeit<br />
insgesamt zwölf Masterstudenten nach Hohenheim<br />
beziehungsweise Witzenhausen<br />
schicken. Außerdem veranstalten die Partner<br />
fünf Summerschools, von denen die ersten<br />
beiden in Hohenheim stattfanden, die nächsten<br />
beiden in Witzenhausen. Dazu kommen<br />
so genannte Sandwich-PhDs, also Promotionen,<br />
bei denen der Doktorvater an einer der<br />
© Okapia/imagebroker/Florian Kopp<br />
Graslandschaft: Lebensgr<strong>und</strong>lage<br />
für andere Pflanzen <strong>und</strong> Tiere<br />
daad<br />
ausländischen Partnerunis sitzt, der Doktorand<br />
aber Teile seiner Arbeit in Deutschland<br />
absolviert. Deutsche Studierende waren bisher<br />
noch nicht bei den ausländischen Partnern,<br />
doch auch hier sind einige Entsendungen von<br />
Postdocs anvisiert.<br />
Breite Förderpalette<br />
„Mit den Klimanetzen hat der <strong>DAAD</strong> die ganze<br />
Bandbreite der Förderinstrumente ausgeschöpft,<br />
um den Beteiligten möglichst viele<br />
Freiheiten zu lassen“, sagt Joachim Schneider,<br />
beim <strong>DAAD</strong> Leiter des Referats Fach- <strong>und</strong> Sonderprogramme.<br />
„Gerade das macht es für uns<br />
so reizvoll“, lobt Folkard Asch. Verschiedene<br />
wissenschaftliche Interessen <strong>und</strong> Zeitskalen<br />
– von der Masterarbeit über die Promotion<br />
bis zu nachhaltiger, längerer Forschungsarbeit<br />
von jungen Wissenschaftlern – ließen<br />
sich so abdecken. Die eigentliche Forschung<br />
finanziert der <strong>DAAD</strong> allerdings nicht, diese<br />
Mittel müssen GrassNet <strong>und</strong> die drei anderen<br />
bewilligten Klimanetze zusätzlich einwerben.<br />
GrassNet hat seit dem Start 2009 vom B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> Entwicklung den Zuschlag für vier<br />
weitere Projekte erhalten. Folkard Asch hofft<br />
auf eine Weiterförderung, wenn das Klimanetz<br />
2013 ausläuft, „weil wir möglichst viele junge<br />
Menschen auf die Klimaprobleme aufmerksam<br />
machen möchten“. Michael Müller<br />
Mehr Informationen: www.grassnet.info.<br />
33
34 daad<br />
Stipendiaten forschen<br />
Biotechnologie<br />
Die Natur als Heil<strong>mit</strong>tel<br />
Kopfschmerzen: Ein unangenehmes Gefühl<br />
<strong>und</strong> ein pochender Schmerz können oft unerträglich<br />
sein. Eine Tablette hilft schnell, doch<br />
nicht immer sind chemische Medikamente nötig.<br />
Der Extrakt der Weidenrinde wurde schon<br />
im antiken Griechenland gegen Schmerzen<br />
aller Art verwendet. „Die Natur bietet so viele<br />
verschiedene pflanzliche Medikamente,<br />
deren Wirkungsweise aufgr<strong>und</strong> der vielen<br />
Inhaltsstoffe noch nicht gut untersucht sind“,<br />
erklärt Anna Koptina, <strong>DAAD</strong>-Stipendiatin aus<br />
Russland.<br />
An der Universität Bonn vergleicht sie die<br />
Effekte von pflanzlichen <strong>und</strong> synthetischen<br />
Medikamenten, um Gemeinsamkeiten <strong>und</strong><br />
Unterschiede in ihrer Wirkungsweise zu ergründen.<br />
Anna Koptina möchte nach ihrem<br />
Studium in der pflanzlichen Arznei<strong>mit</strong>tel-Forschung<br />
arbeiten. Dort will sie die Basis bei der<br />
Anwendung von pflanzlichen Medikamenten<br />
erweitern. „Vor allem die wissenschaftlichen<br />
Erklärungen für die verschiedenen Effekte des<br />
Weidenrinden-Extraktes interessieren mich“,<br />
sagt die 27-jährige Stipendiatin.<br />
Als Höhepunkt ihres Deutschlandaufenthaltes<br />
wird sie im Juni 2011 <strong>mit</strong> anderen jungen<br />
Forschern nach Lindau fahren <strong>und</strong> dort beim<br />
„61st Meeting of Nobel Laureates“ knapp 20<br />
Nobelpreisträger aus dem Bereich Physik <strong>und</strong><br />
Medizin treffen. „Ich freue mich sehr über die<br />
Chance, so renommierten Wissenschaftlern<br />
zu begegnen“, sagt Anna Koptina.<br />
Natalie Zündorf<br />
© tinpalace/www.sxc.hu<br />
Kinderpsychologie<br />
Einfluss der Kulturen<br />
Eine Hexe auf dem Computer-Bildschirm<br />
guckt immer wieder aus einem anderen Fenster.<br />
Sobald sie erscheint, drücken fünf- bis<br />
zwölfjährige Kinder aus Syrien <strong>und</strong> Deutschland<br />
so schnell wie möglich eine Taste. „Mit<br />
dieser Untersuchung konnten wir die Aufmerksamkeit<br />
der jungen Probanden testen“,<br />
erklärt Jamal Sobeh. Der <strong>DAAD</strong>-Stipendiat<br />
verwendete solche Verfahren, um Daten für<br />
seine Doktorarbeit zu sammeln. Das Thema:<br />
„Aufmerksamkeitsfunktionen <strong>und</strong> ihre<br />
Aufmerksam?<br />
Deutsche <strong>und</strong> syrische<br />
Kinder am PC im Vergleich<br />
© Jamal Sobeh<br />
Entwicklung bei Vorschul- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulkindern:<br />
eine kulturvergleichende Studie bei<br />
Kindern aus Damaskus (Syrien) <strong>und</strong> Aachen<br />
(Deutschland)“. Von der Rheinisch-Westfälischen<br />
Technischen Hochschule Aachen aus<br />
fuhr er mehrmals nach Damaskus, um Kinder<br />
an staatlichen Schulen zu testen. Da<strong>mit</strong> betrat<br />
er Neuland, denn in arabischen Ländern gab<br />
es bisher keine Studien zu diesem Thema.<br />
Die arabischen Kinder schnitten durchschnittlich<br />
schlechter ab – sie zeigten langsamere<br />
Reaktionen <strong>und</strong> mehr Fehler – als<br />
ihre deutschen Altersgenossen. Jamal Sobeh<br />
ist der Meinung, dass es an den Kulturunterschieden<br />
liegen könnte: „In der arabischen<br />
Kultur spielt Zeit im Sinne von ‚so schnell wie<br />
möglich’ keine so große Rolle wie in Deutschland.<br />
Zudem ist die westlich-individualistische<br />
Kultur um einiges leistungsorientierter als die<br />
arabisch-kollektivistische.“<br />
„Deutschland ist meine dritte Heimat“,<br />
sagt der in Syrien lebende palästinensische<br />
Flüchtling. Dennoch wird er zurück nach Syrien<br />
gehen, denn dort werden gut qualifizierte<br />
Psychologen dringend benötigt. Dies merkt<br />
er immer wieder bei seinen Besuchen in Damaskus.<br />
Er arbeitet bei den Ordensschwestern<br />
„Gute Hirten“ <strong>mit</strong> traumatisierten Kindern<br />
<strong>und</strong> bietet psychologische Hilfe an. Gute Erfahrungen<br />
hat er <strong>mit</strong> einem Workshop für Mütter<br />
zu hyperaktiven Kindern gemacht. „Die Frauen<br />
waren sehr motiviert <strong>und</strong> wollten alles über<br />
dieses Thema wissen. Mit einer solch guten<br />
Resonanz habe ich nicht gerechnet“, sagt Jamal<br />
Sobeh. Natalie Zündorf<br />
Visuelle Anthropologie<br />
Mit der Kamera ins Innere schauen<br />
„Das Äußere zu filmen bedeutet, sich dem<br />
Inneren zu nähern“ – das ist für Karin Dürr<br />
mehr als der Titel ihrer Masterarbeit. Es ist<br />
das Credo ihrer Forschung <strong>und</strong> ihrer Filme.<br />
Gemeinsam <strong>mit</strong> Carolin Röckelein hat sie für<br />
ihre Masterarbeit an der Freien Universität<br />
Berlin einen Film über burmesische Flüchtlinge<br />
in Thailand gedreht. Im Fachbereich Visual<br />
and Media Anthropology bewegen sich Karin<br />
Dürr <strong>und</strong> Carolin Röckelein an der Grenze<br />
zwischen Filmkunst <strong>und</strong> ethnografischer Forschung.<br />
Vier Wochen lang haben die beiden<br />
Berliner Stipendiatinnen im Frühjahr 2010<br />
eine Gruppe von Jugendlichen an ihrem ungewöhnlichen<br />
Wohnort porträtiert.<br />
Die 16-jährige Zu Zin Moe <strong>und</strong> ihre Fre<strong>und</strong>e<br />
leben auf einer Müllhalde an der Grenze zwischen<br />
Thailand <strong>und</strong> Burma. Als burmesische<br />
Flüchtlinge haben sie keinerlei rechtlichen<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
Autonom: Burmesische Flüchtlinge<br />
leben auf einer Müllkippe in Thailand<br />
Schutz, sie sind vogelfrei. Anders als in den für<br />
sie vorgesehenen Camps können die Jugendlichen<br />
<strong>und</strong> ihre Familien auf der Müllkippe ein<br />
selbstbestimmtes Leben führen: Sie verdienen<br />
Geld, indem sie recycelbare Reste sammeln,<br />
die im maschinellen Prozess der Mülltrennung<br />
übrig geblieben sind. In<strong>mit</strong>ten der Müllkippe<br />
haben die Erwachsenen ein kleines Kino aus<br />
einem alten Fernseher <strong>und</strong> einem DVD-Player<br />
eingerichtet, es kostet umgerechnet nur ein<br />
paar Cent Eintritt. Wenn sich ihr harter Arbeitstag<br />
dem Ende zuneigt, hocken die Bewohner<br />
der Müllhalde in der Sicherheit der Nacht<br />
zusammen auf dem staubigen Boden, der ihr<br />
Zuhause ist, <strong>und</strong> singen Karaoke. „Was willst<br />
du später werden?“, fragt Zu Zin Moe einen<br />
Fre<strong>und</strong>. „Ich möchte Filmstar werden. Aber es<br />
ist unmöglich, es ist ein ganz weit entfernter<br />
Traum.“ Zu Zin Moe übernimmt die Rolle der<br />
Journalistin, manchmal filmt sie sogar selbst.<br />
So sprengt der Film „Finders Keepers. Dreamless<br />
Sleepers“ die starre Dreiecksbeziehung<br />
zwischen Zuschauer, Dokumentarfilmer <strong>und</strong><br />
Akteuren vor der Kamera. „Uns geht es darum,<br />
was während des Filmens <strong>mit</strong> denjenigen<br />
passiert, die vor <strong>und</strong> hinter der Kamera<br />
stehen“, erklärt Karin Dürr. „Gerade dadurch<br />
entsteht auch ein stärkerer Eindruck beim Zuschauer.“<br />
Die Regisseurinnen sind überzeugt:<br />
Wer filmt, erlebt das Vertraute neu. Auch <strong>und</strong><br />
gerade sich selbst.<br />
www.gipfelfilm.de Julia Walter<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Mechatronik<br />
Abenteuer Osteuropa<br />
Drei Semester lang hatte Mechatronikstudent<br />
Matthias Uhlemann an der Technischen Universität<br />
Dresden Russisch gepaukt, bevor er<br />
Sven Rost, dem ersten <strong>DAAD</strong>-Lektor seines<br />
Fachgebietes, im Oktober 2009 in die Ukraine<br />
folgte. Während eines Praktikums an der<br />
Nationalen Technischen Universität Donezk<br />
entschied sich Matthias Uhlemann dafür,<br />
die Diplomarbeit dort anzuschließen. Seine<br />
Forschung hätte er überall durchführen können<br />
– für seinen Entwurf eines hyperred<strong>und</strong>anten<br />
Roboterarmes brauchte er nur einen<br />
Laptop. Doch die Abenteuerlust zog ihn nach<br />
Osteuropa.<br />
Ein hyperred<strong>und</strong>anter Roboter hat so viele<br />
Möglichkeiten sich zu bewegen, dass er auch<br />
Hindernisse umgehen kann. An solchen<br />
Robotern fehlt es zum Beispiel<br />
der Automobilindustrie. Dort werden<br />
deshalb noch r<strong>und</strong> 70 Prozent der Produktionsschritte<br />
von Menschenhand<br />
ausgeführt. „Ein Hindernis für den<br />
Einsatz hyperred<strong>und</strong>anter Roboter in<br />
der Industrie war bisher beispielsweise<br />
ihr schlechtes Nutzlast-Eigenmasse-Verhältnis“,<br />
erklärt Matthias Uhlemann.<br />
Während klassische Industrie-Roboter<br />
weniger als ein Zehntel<br />
ihres Eigengewichtes heben können,<br />
stemmt seine eigene Konstruktion im<br />
Idealfall das Zehnfache ihrer Masse.<br />
Unentbehrlich:<br />
Roboter <strong>mit</strong><br />
Gelenkarm in der Industrie<br />
© Berthold Hermle AG/wikipedia<br />
daad<br />
Für die Energieübertragung wählte der <strong>DAAD</strong>-<br />
Stipendiat ein hydraulisches Verfahren, durch<br />
das hohe Kräfte erzeugt werden können.<br />
„Die Forschung im Bereich der Hydraulik hat<br />
in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht“,<br />
sagt der Ingenieur. „Entgegen verbreiteter<br />
Vorurteile ist die Hydraulik heutzutage<br />
zum Beispiel eine saubere Technologie.“ Das<br />
Besondere an Matthias Uhlemanns Roboterarm<br />
ist aber seine Fachwerkstruktur, <strong>mit</strong> der<br />
der Mechatroniker an Entwürfe aus den achtziger<br />
Jahren anknüpft. Durch sie lässt sich der<br />
Roboterarm zusammenfalten.<br />
Die Diplomarbeit hat Matthias Uhlemann<br />
Ende 2010 abgeschlossen, seine Leidenschaft<br />
für Osteuropa ist geblieben: „Auch auf Jobsuche<br />
orientiere ich mich ostwärts“, sagt der<br />
25-Jährige, der <strong>mit</strong>tlerweile fließend Russisch<br />
spricht. Julia Walter<br />
© Karin Dürr, www.gipfelfilm.de<br />
35
36<br />
daad<br />
Nachrichten<br />
New York<br />
Forschungsfenster nach<br />
Deutschland<br />
Seit seiner Eröffnung am 19. Februar<br />
2010 hat das Deutsche Wissenschafts-<br />
<strong>und</strong> Innovationshaus<br />
(German Center for Research and<br />
Innovation – GCRI) im Deutschen<br />
Haus in New York zu zahlreichen<br />
Workshops <strong>und</strong> Podiumsdiskussionen<br />
eingeladen. Aktuelle Forschungsprojekte<br />
aus Deutschland<br />
standen dabei im Mittelpunkt: unter<br />
anderem zur Hirnforschung,<br />
Nachhaltigkeit oder Nanotechnologie.<br />
Sebastian Fohrbeck, einer<br />
der Direktoren <strong>und</strong> Leiter der<br />
<strong>DAAD</strong>-Außenstelle in New York,<br />
sieht viel Potenzial für eine Intensivierung<br />
der transatlantischen<br />
Zusammenarbeit: „In den USA<br />
besteht großes Interesse an Technologien<br />
für erneuerbare Energien,<br />
<strong>und</strong> in Großstädten wie New<br />
York ist man neugierig auf innovative<br />
stadtplanerische Ansätze.“<br />
Das Wissenschaftshaus fungiert<br />
zudem als eine Art Agentur, die<br />
alle Angebote deutscher Wissenschaftsinstitutionen<br />
bündelt. So<br />
bahnt eine neue Internetplattform<br />
Wissenschaftlern, Studierenden<br />
oder Unternehmern aus Nordamerika<br />
einen Weg durch den Dschungel<br />
der deutschen Forschungs-<br />
<strong>und</strong> Hochschullandschaft.<br />
www.germaninnovation.org<br />
© Michael Jordan<br />
Germanistenkongress<br />
Chancen ergreifen<br />
Deutsche Spitzenforschung: Nobelpreisträger Bert Sakmann sprach im German Center<br />
for Research and Innovation über „Mapping the Brain“<br />
Engagiert <strong>und</strong> kämpferisch traten<br />
Germanisten aus Frankreich, den<br />
Benelux-Staaten <strong>und</strong> Deutschland<br />
in Weimar für die mehrsprachige<br />
Kommunikation <strong>und</strong> ihren Erhalt<br />
in Europa ein. Die Fixierung von<br />
Englisch als erste Fremdsprache<br />
an westeuropäischen Schulen er -<br />
schwert die Arbeit an vielen Instituten<br />
für deutsche Sprache.<br />
Der Nachwuchs an Studierenden<br />
bricht weg, obwohl Mehrsprachigkeit<br />
eine Schlüsselkompetenz auf<br />
innereuropäischen Arbeitsmärkten<br />
darstellt.<br />
„Wir haben noch eine Chance,<br />
aber es eilt“, sagt Anthonya Visser,<br />
Professorin für Germanistik<br />
an der Universität Leiden (Niederlande).<br />
Der Zusammenschluss<br />
zu Zentren für die Germanistik ist<br />
eine Möglichkeit. Neue Konzepte<br />
für die Deutschlehrerausbildung<br />
eine andere.<br />
Die <strong>DAAD</strong>-Tagung im Februar in<br />
Goethes Heimatstadt gab den Anstoß<br />
dafür, dass die Germanisten-<br />
<strong>und</strong> Deutschlehrerverbände Belgiens,<br />
Luxemburgs <strong>und</strong> der Niederlande<br />
nun einen Dachverband<br />
gründen wollen, um gemeinsam<br />
sichtbarer <strong>und</strong> stärker zu werden.<br />
bcm<br />
Von Büchern umgeben: Germanisten im Kubus der<br />
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, Weimar<br />
© Michael Jordan<br />
Masterstudiengang<br />
Die ökologische Stadt<br />
Wie könnte sie aussehen, die Stadt<br />
<strong>mit</strong> guter Öko-Bilanz? Deutsche<br />
<strong>und</strong> arabische Stadtmanager der<br />
Zukunft haben jetzt die Möglichkeit,<br />
einen Master im Fachgebiet<br />
„Ökologisches Stadtmanagement/<br />
Energieeffizientes Bauen“ zu absolvieren.<br />
„Die schlechte Energiebilanz<br />
der Gebäude in ägyptischen<br />
Städten ist hier die große Herausforderung“,<br />
erläutert Michael<br />
Harms, <strong>DAAD</strong>-Außenstellenleiter<br />
in Kairo. In den Nächten kühlen<br />
die schlecht isolierten Häuser aus,<br />
bei 40 Grad im Sommer laufen<br />
permanent Klimaanlagen gegen<br />
die Hitze an – „wirtschaftlich <strong>und</strong><br />
ökologisch ein Problem“, sagt<br />
Harms. Der neue Masterstudiengang<br />
ver<strong>mit</strong>telt technisches <strong>und</strong><br />
politisches Wissen – wie man beispielsweise<br />
Anreize zum Energiesparen<br />
schafft – <strong>und</strong> richtet sich<br />
da<strong>mit</strong> an zukünftige Entscheider<br />
in Unternehmen oder Politik. Die<br />
Einrichtung des Studiengangs,<br />
der Anfang Dezember in Kairo<br />
feierlich eröffnet wurde, ist ein gemeinsames<br />
Ausbildungsangebot<br />
der Ain Shams Universität Kairo<br />
<strong>und</strong> der Universität Stuttgart. Sie<br />
markiert einen weiteren Meilenstein<br />
in der Hochschulzusammenarbeit<br />
zwischen Deutschland <strong>und</strong><br />
Ägypten. bcm<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
<strong>DAAD</strong>-Portal<br />
Passende Stelle für<br />
Doktoranden<br />
Wer in Deutschland promovieren<br />
möchte, dem hilft ab sofort ein<br />
Klick: Die <strong>DAAD</strong>-Ver<strong>mit</strong>tlungsplattform<br />
PhDGermany ist online.<br />
Freie, bezahlte Stellen können<br />
internationale Doktoranden auf<br />
Englisch oder Deutsch suchen<br />
<strong>und</strong> einsehen. Für Studierende<br />
<strong>mit</strong> Stipendien finden sich auch<br />
unbezahlte Betreuungsangebote.<br />
Der Ablauf ist einfach: Kriterien<br />
eingeben, die passende Stelle finden<br />
<strong>und</strong> sich über den Button „Online-Bewerbung“<br />
direkt über das<br />
<strong>DAAD</strong>-Portal bei der deutschen<br />
Hochschule oder Forschungseinrichtung<br />
bewerben. Das erleichtert<br />
vor allem das formale Verfahren<br />
für ausländische Bewerber. „Die<br />
Seite assistiert beim Verfassen<br />
eines Motivationsschreibens <strong>und</strong><br />
führt Schritt für Schritt durch die<br />
Struktur einer Bewerbung“, sagt<br />
Karin Heistermann vom <strong>DAAD</strong>.<br />
Davon profitieren auch deutsche<br />
Hochschulen. Sie bekommen fertige<br />
<strong>und</strong> strukturierte Unterlagen.<br />
Ein zusätzlicher Vorteil: Der Service<br />
ist für Hochschulen <strong>und</strong> Bewerber<br />
kostenfrei. bcm<br />
www.phdgermany.de<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Chinesisch-Deutsche Hochschule besiegelt:<br />
<strong>DAAD</strong>-Beauftragter Christian Bode <strong>und</strong><br />
Tongji-Präsident Pei Gang (rechts)<br />
La Caixa-Stipendien<br />
Chance für Spaniens<br />
Akademiker<br />
Junge Akademiker haben es in<br />
Spanien nicht leicht: Geeignete<br />
Stellen sind derzeit knapp. Für exzellente<br />
Nachwuchsforscher gibt<br />
es seit 1982 die Stipendien der<br />
Stiftung „La Caixa“ – gegründet<br />
von der gleichnamigen Bank. Sie<br />
ermöglichen den Studierenden<br />
ein zweijähriges Postgraduiertenstudium<br />
im Ausland. Seit 1993 kooperiert<br />
der <strong>DAAD</strong> <strong>mit</strong> „La Caixa“<br />
<strong>und</strong> finanziert 20 Stipendien aus<br />
einem gemeinsamen Topf.<br />
Zog es in der Vergangenheit vor<br />
allem Geisteswissenschaftler <strong>und</strong><br />
Musiker nach Deutschland, so<br />
gibt es nun immer mehr Bewerber<br />
aus ingenieurwissenschaftlichen<br />
<strong>und</strong> technischen Fächern.<br />
Anfang März überreichte der spanische<br />
König Juan Carlos I. die<br />
Urk<strong>und</strong>en der Stipendien an 117<br />
spanische Studierende. Insgesamt<br />
20 von ihnen studieren <strong>mit</strong> Unterstützung<br />
des <strong>DAAD</strong> an deutschen<br />
Hochschulen. CW<br />
Glückwunsch: Spaniens König<br />
überreicht die Stipendienurk<strong>und</strong>e<br />
für ein Studium in Deutschland<br />
© F<strong>und</strong>ación “la Caixa”/Máximo García<br />
© <strong>DAAD</strong><br />
Schanghai<br />
Brücke nach China<br />
Ein Studienjahr in Schanghai? Ein<br />
deutsch-chinesischer Doppelabschluss?<br />
In der deutschen Wirtschaft<br />
sind China-Erfahrungen<br />
ge fragt, doch für Studierende ist<br />
es nicht einfach, einen Aufenthalt<br />
in dem Land zu organisieren.<br />
Eine Brücke nach China bildet<br />
die neue Chinesisch-Deutsche<br />
Hochschule (CDH) an der Tongji-<br />
Universität. Die am 23. März<br />
2011 gegründete Einrichtung verbindet<br />
das Chinesisch-Deutsche<br />
Hochschulkolleg, die Chinesisch-<br />
Deutsche Hochschule für Angewandte<br />
Wissenschaften <strong>und</strong> das<br />
Chinesisch-Deutsche Institut für<br />
Berufsbildung <strong>mit</strong>einander. Die<br />
Zusammenführung ermöglicht<br />
mehr Sichtbarkeit, bessere Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> den Ausbau des<br />
Studienangebots für die weitere<br />
Internationalisierung der Hochschullandschaft.<br />
„Das Ziel ist hier<br />
vor allem, mehr deutsche Studierende<br />
an die Tongji-Universität<br />
zu bekommen“, sagt der <strong>DAAD</strong>-<br />
Beauftragte Christian Bode. Komplettiert<br />
wird die CDH durch den<br />
Chinesisch-Deutschen Campus,<br />
eine Serviceeinrichtung für alle<br />
deutschlandbezogenen Institutionen<br />
<strong>und</strong> Kooperationsprojekte an<br />
der Tongji-Universität. bcm<br />
GUS-Agraruniversitäten<br />
Reise <strong>mit</strong> Netzwerkeffekt<br />
daad 37<br />
Bolashak bedeutet auf Kasachisch<br />
Zukunft – <strong>und</strong> ist auch der Name<br />
des staatlichen Stipendienprogramms,<br />
<strong>mit</strong> dem die Regierung<br />
des zentralasiatischen Landes<br />
jährlich r<strong>und</strong> 3 000 Studierende<br />
zum Studium ins Ausland schickt.<br />
„Kasachstan braucht internationalen<br />
Anschluss, nur so können wir<br />
in Zukunft bestehen“, sagt Olessya<br />
Berezhnaya vom Auslandsbüro<br />
der Nationalen Agraruniversität<br />
in Almaty. Jeder Student, der ins<br />
Ausland gehe, sei ein kleiner Stein<br />
in der Brücke zwischen Kasachstan<br />
<strong>und</strong> dem Rest der Welt.<br />
Die Agrarwissenschaftlerin besuchte<br />
Ende November gemeinsam<br />
<strong>mit</strong> 19 Kollegen von agrarwissenschaftlich<br />
ausgerichteten<br />
Hochschulen aus elf GUS-Staaten<br />
die Agrarfakultäten mehrerer<br />
deutscher Hochschulen. Der<br />
<strong>DAAD</strong> hatte die Reise organisiert.<br />
Zwar gibt es Kooperationen zwischen<br />
deutschen <strong>und</strong> GUS-Agraruniversitäten,<br />
doch es besteht ein<br />
großes Interesse, den fachlichen<br />
Austausch <strong>mit</strong> Deutschland zu intensivieren.<br />
Neben der Information<br />
über das Ausbildungsmanagement<br />
der deutschen Hochschulen<br />
diente die Reise auch dem Knüpfen<br />
neuer Kontakte zwischen den<br />
GUS-Staaten. DvR
38<br />
daad<br />
Republik Tatarstan<br />
Stipendienprogramm<br />
erweitert<br />
Die Republik Tatarstan verlängert<br />
das seit 2008 bestehende Stipendienprogramm<br />
für Masterstudierende<br />
um fünf Jahre bis 2016.<br />
Dies vereinbarten der tatarische<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Wissenschaftsminister,<br />
Professor Albert Gilmutdinov,<br />
<strong>und</strong> der <strong>DAAD</strong>. Tatarstan <strong>und</strong><br />
Deutschland finanzieren das Programm<br />
zu gleichen Teilen. Die Republik<br />
gilt als eine der reichsten<br />
der Russischen Föderation – Erdöl-<br />
<strong>und</strong> Erdgasvorkommen tragen<br />
zum Reichtum bei.<br />
„Unsere jungen Leute kommen<br />
<strong>mit</strong> neuen Ideen, neuen kulturellen<br />
Einsichten zurück, was für die<br />
Modernisierung unseres Landes<br />
von großer Bedeutung ist“, sagt<br />
Albert Gilmutdinov. Die Kooperation<br />
<strong>mit</strong> Deutschland verlaufe<br />
besonders erfreulich. „Abgesehen<br />
von den guten Universitäten liegt<br />
das auch an der äußerst sorgfältigen<br />
Auswahl der Bewerber durch<br />
den <strong>DAAD</strong>.“<br />
Zukünftig vergibt das r<strong>und</strong> 3,7<br />
Millionen Einwohner zählende<br />
Tatarstan jedes Jahr 30 statt bisher<br />
20 Stipendien für Studierende.<br />
Außerdem existiert nun ein<br />
weiteres, vollständig von den Tataren<br />
finanziertes Programm, das<br />
© Michael Jordan<br />
Doktoranden, Postdocs <strong>und</strong> Wissenschaftlern<br />
einen Forschungsaufenthalt<br />
in Deutschland ermöglicht.<br />
CW<br />
Deutsch-Indische Kooperation<br />
Nachhaltige Gründung<br />
Gesucht werden Lösungsvorschläge<br />
für drängende Umweltprobleme<br />
Asiens. Im Dezember eröffnete<br />
in der südindischen Stadt Chennai<br />
das neue Deutsch-Indische Zentrum<br />
für Nachhaltigkeitsforschung<br />
(Indo-German Center for Sustainability,<br />
IGCS) am Indian Institute<br />
of Technology (IIT) Madras. Spitzenforscher<br />
beider Länder treten<br />
an, um innovative Strategien vor<br />
allem in den Bereichen Energie,<br />
Gute Nachrichten: Tatarischer Bildungsminister Albert Gilmutdinov,<br />
Thomas Prahl (<strong>DAAD</strong>) <strong>und</strong> <strong>DAAD</strong>-Vizepräsident Max Huber (von links)<br />
vereinbaren Ausbau des gemeinsamen Stipendienprogramms<br />
Landnutzung, Abfall- <strong>und</strong> Wassermanagement<br />
zu entwickeln. „Das<br />
sind die Rahmenbedingungen für<br />
unser zukünftiges Leben auf der<br />
Erde“, sagt Zentrumskoordinator<br />
Rafig Azzam. „Es ist unser Anliegen,<br />
die Ressourcen für kommende<br />
Generationen zu erhalten.“<br />
Der <strong>DAAD</strong> finanziert am IGCS<br />
vier Gastdozenturen für die Fachgebiete<br />
Energietechnik, Hy drogeo<br />
graphie, Abfallwirtschaft <strong>und</strong><br />
Was ser management. Hinzu kommen<br />
Stipendien für Forscher sowie<br />
Doktoranden in Indien <strong>und</strong><br />
Deutschland. Das Geld stammt aus<br />
Mitteln der Initiative „A New Passage<br />
to India“, für die das B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Bildung <strong>und</strong> Forschung<br />
3,1 Millionen Euro jährlich<br />
Abfall- <strong>und</strong> Wassermanagement:<br />
Forschungsthema am neuen Indo-German Center for Sustainability, Chennai/Indien<br />
© gordondix/istockphoto.com<br />
bis 2012 zur Verfügung gestellt<br />
hat. Der akademische Austausch<br />
zwischen Deutschland <strong>und</strong> Indien<br />
hat eine lange Tradition. Das international<br />
renommierte IIT Madras<br />
wurde 1959 <strong>mit</strong> deutscher Unterstützung<br />
eröffnet, deutsche Professoren<br />
haben dort immer wieder<br />
unterrichtet, <strong>und</strong> das <strong>DAAD</strong>-Büro<br />
in Neu Delhi ist eine der ältesten<br />
Außenstellen des <strong>DAAD</strong>. lom<br />
Ort im Land der Ideen<br />
<strong>DAAD</strong>-Fre<strong>und</strong>eskreis<br />
ausgezeichnet<br />
2011 ist der <strong>DAAD</strong>-Fre<strong>und</strong>eskreis<br />
einer von „365 Orten im Land<br />
der Ideen“. In dem Alumniverein<br />
haben sich ehemalige deutsche<br />
<strong>DAAD</strong>-Stipendiaten zusammengeschlossen.<br />
Sie sind in r<strong>und</strong><br />
40 Städten in ganz Deutschland<br />
vertreten, wo sie Freizeitaktivitäten<br />
für ausländische <strong>DAAD</strong>-<br />
Stipendiaten organisieren, sie<br />
<strong>mit</strong> der deutschen Kultur vertraut<br />
machen <strong>und</strong> ihnen so das Einleben<br />
in Deutschland erleichtern.<br />
Da<strong>mit</strong> leistet der Fre<strong>und</strong>eskreis<br />
nicht nur einen Beitrag zur Völkerverständigung,<br />
sondern stärkt<br />
auch den Wissenschaftsstandort<br />
Deutschland. In diesem Jahr feiert<br />
der Verein, der r<strong>und</strong> 1300 Mitglieder<br />
hat, sein dreißigjähriges<br />
Bestehen. Die Auszeichnung als<br />
„Ausgewählter Ort 2011“ wird anlässlich<br />
der Jubiläumsfeier am 25.<br />
September in Berlin übergeben.<br />
„Deutschland – Land der Ideen“<br />
ist eine Initiative von B<strong>und</strong>esregierung<br />
<strong>und</strong> deutscher Wirtschaft.<br />
Unter der Schirmherrschaft des<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
B<strong>und</strong>espräsidenten werden seit<br />
2006 jährlich 365 Projekte <strong>und</strong><br />
Ideen ausgezeichnet, die ein positives<br />
Deutschlandbild ver<strong>mit</strong>teln.<br />
<strong>DAAD</strong>-IC Bogotá<br />
Zentrale Anlaufstelle<br />
Mehr als 1000 Gäste feierten Mitte<br />
Februar den Einzug des <strong>DAAD</strong>-<br />
Informationszentrums Bogotá in<br />
neue Räume. Gemeinsam <strong>mit</strong> dem<br />
Goethe-Institut hat der <strong>DAAD</strong> nun<br />
wieder eine zentrale Anlaufstelle<br />
für kolumbianische Studierende,<br />
aber auch für Wissenschaftler <strong>und</strong><br />
Hochschulen, die Interesse an einem<br />
Austausch <strong>mit</strong> Deutschland<br />
haben. Kolumbien hat sich in den<br />
vergangenen Jahren zu einem der<br />
wichtigsten Partner der deutschen<br />
Wissenschaftskooperation in Lateinamerika<br />
entwickelt. Nach Brasilien<br />
<strong>und</strong> Mexiko sind Studierende<br />
aus Kolumbien die drittstärkste<br />
Gruppe in Deutschland<br />
Kontakt: Sven Werkmeister, Leiter<br />
des <strong>DAAD</strong>-Informationszentrums<br />
Bogotá<br />
Email: info@daad.co<br />
Heiskell Award für RISE<br />
Beispielhaftes Format<br />
Sie kommen aus Nordamerika<br />
oder Großbritannien, studieren<br />
Natur- oder Ingenieurwissenschaften<br />
<strong>und</strong> absolvieren ein<br />
Praktikum bei Doktoranden an<br />
deutschen Universitäten oder Forschungseinrichtungen.<br />
Jährlich<br />
fördert der <strong>DAAD</strong> r<strong>und</strong> 300 junge<br />
Bachelorstudierende in seinem<br />
RISE-Programm (RISE steht für<br />
„Research Internships in Science<br />
and Engineering“). Das Besondere:<br />
Die Doktoranden betreuen<br />
ihre Praktikanten nach dem Mentorenprinzip<br />
auch außerhalb der<br />
Forschungsarbeit. Der Andrang<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
Wir haben geöffnet: <strong>DAAD</strong>-Informationszentrum<br />
<strong>und</strong> Goethe-Institut in Bogotá<br />
ist groß: Die Zahl der Bewerbungen<br />
hat sich seit dem Start 2005<br />
mehr als vervierfacht – von r<strong>und</strong><br />
300 auf fast 1300, <strong>mit</strong> steigender<br />
Tendenz. Die Erfolgsgeschichte<br />
des RISE-Programms spiegelt sich<br />
nun in einer internationalen Anerkennung<br />
wider: Anfang 2011<br />
erhielt RISE den Heiskell Award<br />
© <strong>DAAD</strong><br />
Vorbildlich:<br />
RISE-Praktikant<br />
in deutschem<br />
Labor<br />
des Institute of International Education<br />
(IIE). Das renommierte New<br />
Yorker Institut prämiert <strong>mit</strong> den<br />
Awards Initiativen zur Internationalisierung<br />
der Hochschulen im<br />
In- <strong>und</strong> Ausland. Das IIE würdigte<br />
das RISE-Programm als beispielhaftes<br />
Format. CW<br />
© <strong>DAAD</strong><br />
tErmiNE<br />
daad 39<br />
2. Mai bis 3. Juni 2011<br />
NAFSA in Kanada<br />
Die NAFSA 2011 Annual Conference<br />
& Expo (Association of<br />
International Educators) gilt als<br />
bedeutendste Konferenz für internationale<br />
Hochschulbildung, Austausch<br />
<strong>und</strong> Mobilität, <strong>mit</strong> jährlich<br />
8 000 Teilnehmern aus der ganzen<br />
Welt. Im „Study in Germany<br />
– Land of Ideas“-Pavillon präsentiert<br />
sich der <strong>DAAD</strong> gemeinsam<br />
<strong>mit</strong> deutschen Hochschulen <strong>und</strong><br />
Länderinitiativen in Vancouver.<br />
9. bis 16. September 2011<br />
EAIE in Dänemark<br />
Die EAIE (European Association<br />
for International Education) ist die<br />
größte Netzwerkmesse dieser Art<br />
in Europa. In Kopenhagen treffen<br />
sich im September Universitäten,<br />
Länderkonsortien <strong>und</strong> Mittlerorganisationen<br />
aus aller Welt, um<br />
die aktuellen Entwicklungen im<br />
Bereich internationaler Bildung<br />
zu beleuchten. Zum Rahmenprogramm<br />
der 23. EAIE gehört der<br />
„German Participants’ Evening“,<br />
bei dem Themen r<strong>und</strong> um den<br />
skandinavischen Bildungsmarkt<br />
im Mittelpunkt stehen.<br />
www.eaie.org/copenhagen<br />
23./24. September 2011<br />
Deutsche Hochschulmesse<br />
in der Ukraine<br />
Deutsche Hochschulen präsentieren<br />
sich <strong>mit</strong> ihren internationalen<br />
Programmen auf der Deutschen<br />
Hochschulmesse in Kiew. Englisch-<br />
oder auch zweisprachige<br />
Bachelor- <strong>und</strong> Masterangebote<br />
für die Ingenieurwissenschaften,<br />
Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften<br />
sowie Wirtschaftswissenschaften<br />
<strong>und</strong> Management stehen dabei im<br />
Fokus.<br />
Die eigenständige deutsche Hochschulmesse<br />
wird zum vierten Mal<br />
von GATE-Germany organisiert.
40 daad<br />
© David Ausserhofer<br />
Die dramatischen Umwälzungen in Tunesien,<br />
Ägypten <strong>und</strong> einigen angrenzenden<br />
Ländern bewegen viele Menschen in Deutschland.<br />
Die besondere Anteilnahme, <strong>mit</strong> der die<br />
Berliner Historikerin Ulrike Freitag die Ereignisse<br />
im Nahen Osten beobachtet, hat nicht<br />
zuletzt berufliche Gründe: Sie leitet seit neun<br />
Jahren das Zentrum Moderner Orient (ZM0),<br />
das einzige deutsche Forschungsinstitut, das<br />
sich interdisziplinär <strong>und</strong> historisch-vergleichend<br />
<strong>mit</strong> dem Nahen Osten, Afrika sowie<br />
Süd- <strong>und</strong> Südost-Asien befasst. An dem 1996<br />
gegründeten Zentrum forscht Ulrike Freitag<br />
<strong>mit</strong> 30 Wissenschaftlern zur Geschichte,<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Kultur islamisch geprägter<br />
Länder <strong>und</strong> deren Beziehungen zur nicht-islamischen<br />
Welt.<br />
Gestern Stipendiatin – <strong>und</strong> heute...<br />
Ulrike freitag<br />
Direktorin des Zentrums Moderner Orient, Berlin<br />
In Tunesien schnupperte die 20-jährige Arabisch-Studentin<br />
als Touristin zum ersten Mal<br />
die Luft des Vorderen Orients. Das Land <strong>mit</strong><br />
seiner islamisch geprägten Kultur erschien<br />
ihr „gar nicht so fremd“. Erinnerungen an ihre<br />
Kindheit kamen hoch. Im Alter zwischen fünf<br />
<strong>und</strong> acht lebte sie dreieinhalb Jahre in Afghanistan,<br />
wo ihr Vater als Professor für Botanik<br />
an der Universität Kabul unterrichtete.<br />
Schon in der Schule hatte Ulrike Freitag eine<br />
Vorliebe für das Fach Geschichte, das sie dann<br />
auch studierte. Eher zufällig fiel die Wahl auf<br />
Arabisch als Nebenfach. Die Liebe zur arabischen<br />
Sprache <strong>und</strong> Kultur habe sie ihrem<br />
palästinensischen Lehrer an der Universität<br />
Bonn zu verdanken – <strong>und</strong> zahlreichen Aufenthalten<br />
in den arabischen Ländern, erzählt die<br />
Nahosthistorikerin.<br />
Sprachkurse führten sie nach Tunis <strong>und</strong> Kairo,<br />
<strong>und</strong> <strong>mit</strong> einem <strong>DAAD</strong>-Stipendium kam sie<br />
1984/85 erstmals nach Syrien. In Damaskus,<br />
das so etwas wie die zweite Heimat für sie<br />
wurde, forschte sie – wiederum vom <strong>DAAD</strong> gefördert<br />
– 1987 <strong>und</strong> 1990 für ihre Dissertation<br />
über die syrische Geschichtsschreibung <strong>und</strong><br />
promovierte 1991 an der Universität Freiburg.<br />
Nach einer kurzen Tätigkeit an der Fernuniversität<br />
Hagen folgte sie ihrem Mann, der<br />
damals <strong>DAAD</strong>-Lektor in London war, für zehn<br />
Jahre an die Themse. Hier unterrichtete sie<br />
an der School of Oriental and African Studies<br />
der Universität London. Sie forschte über die<br />
jemenitische Migration im Bereich des Indischen<br />
Ozeans, reiste dafür nicht nur in den<br />
Jemen, sondern auch nach Singapur <strong>und</strong> Java<br />
<strong>und</strong> habilitierte sich zu dem Thema. In dieser<br />
Zeit wurde sie auch Mutter von zwei Kindern.<br />
Familiäre Überlegungen spielten durchaus<br />
eine Rolle, als sich Ulrike Freitag 2002 für<br />
das ZMO in Berlin entschied. „Mein Mann bekam<br />
gleichzeitig eine Stelle an der Humboldt-<br />
Universität, <strong>und</strong> in Berlin sind die Kinder gut<br />
versorgt.“ Kompromisse zwischen Familie <strong>und</strong><br />
Arbeit sind dennoch an der Tagesordnung für<br />
die vielbeschäftigte Wissenschaftlerin. Sie ist<br />
an mehreren großen Forschungsprojekten des<br />
ZMO beteiligt, zu ihren Schwerpunkten gehört<br />
die Stadtgeschichte in arabischen Ländern.<br />
Gleichzeitig unterrichtet sie als Professorin<br />
am Islamwissenschaftlichen Institut der Freien<br />
Universität Berlin.<br />
Mit ihren Studenten ging sie 2008 <strong>und</strong> 2009<br />
auf Exkursionen nach Saudi-Arabien, wo<br />
sozialwissenschaftliche Forschung erst seit<br />
kurzem möglich ist. Hier beobachteten die<br />
jungen Deutschen den behutsamen gesellschaftlichen<br />
Wandel in dem Land – wie etwa<br />
neue Freiheiten für Frauen oder die Liberalisierung<br />
in der Kulturszene. Als sie ihre Ergebnisse<br />
2010 in Buchform brachten, fanden sie<br />
da<strong>mit</strong> viel Aufmerksamkeit in den deutschen<br />
Medien (Saudi-Arabien. Ein Königreich im<br />
Wandel. Hrsg. von Ulrike Freitag. Ferdinand<br />
Schöningh Verlag 2010).<br />
Für die Medien sind die Experten vom<br />
ZMO speziell in diesen Monaten gefragte Gesprächspartner.<br />
Auf die zahlreichen Anfragen<br />
von R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Fernsehen geben sie fachk<strong>und</strong>ig<br />
Auskunft <strong>und</strong> laden Journalisten zum<br />
Pressegespräch, um die Öffentlichkeit <strong>mit</strong><br />
Hintergr<strong>und</strong>informationen zur Nahost-Region<br />
zu versorgen. „Wir haben etwas zu bieten, was<br />
über die Tagespolitik hinausgeht“, sagt Ulrike<br />
Freitag.<br />
Das gilt auch für die Zusammenarbeit <strong>mit</strong><br />
Kollegen aus den muslimisch geprägten Ländern.<br />
Mitarbeiter <strong>und</strong> Fellows aus aller Welt<br />
arbeiten am ZMO, <strong>und</strong> die Kontakte in die<br />
arabischen Länder sind zahlreich. Das<br />
Konzept, nicht „über“ die Region, sondern<br />
„<strong>mit</strong>“ ihr zu forschen, ist tägliche<br />
Praxis.<br />
Davon profitieren alle Seiten, findet<br />
Ulrike Freitag. Ende Februar<br />
packte sie wieder einmal die Koffer<br />
für einen mehrwöchigen Aufenthalt<br />
in der saudi-arabischen Stadt Dschidda.<br />
Dort ist sie an der Effat University,<br />
einer Frauenuniversität, an einem Dialog<br />
über Forschungsentwicklung beteiligt.<br />
Dabei geht es um die Gründung<br />
eines Lehrstuhls für „Heritage Studies“.<br />
Die Altstadt von Dschidda <strong>und</strong> deren<br />
Erhaltung beschäftigen Ulrike Freitag<br />
schon länger. Nun beteiligt sie sich an<br />
einer großen Ausstellung zu Saudi-Arabien,<br />
die im Herbst in Berlin gezeigt<br />
wird, <strong>und</strong> bereitet gemeinsam <strong>mit</strong><br />
deutschen <strong>und</strong> saudischen Kollegen<br />
begleitend dazu eine Tagung<br />
zum architektonischen Erbe<br />
in Saudi-Arabien vor.<br />
www.zmo.de<br />
Leonie Loreck<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11
köpfe<br />
Beim Internationalen Filmfestival<br />
in Berlin, der 61. Berlinale<br />
im Februar dieses Jahres,<br />
war der <strong>DAAD</strong> gleich mehrfach<br />
beteiligt. Zwei seiner Gäste im<br />
Berliner Künstlerprogramm<br />
(BKP) erhielten Spitzenpreise,<br />
darüber hinaus vergab der<br />
<strong>DAAD</strong> einen Kurzfilmpreis.<br />
Der Film „Nader <strong>und</strong> Simin,<br />
eine Trennung“ des iranischen<br />
Drehbuchautors <strong>und</strong> Regisseurs<br />
Asghar Farhadi wurde<br />
<strong>mit</strong> der höchsten Auszeichnung<br />
bedacht, dem Goldenen Bären.<br />
Darüber hinaus erhielt der Film<br />
zwei Silberne Bären für die besten<br />
Darstellerinnen, darunter die<br />
12-jährige Tochter des Regisseurs,<br />
Sarina Farhadi.<br />
Der Film erzählt von einem Ehepaar,<br />
das sich trennt. Die Konflikte,<br />
die sich daraus ergeben, werfen<br />
ein Licht auf das iranische Alltagsleben<br />
<strong>und</strong> eine Gesellschaft,<br />
in der die Frauen eine tragende<br />
Rolle spielen. Auf die politische<br />
Botschaft seines Films angesprochen,<br />
sagte Farhadi gegenüber der<br />
„Berliner Zeitung“: „Es ist nicht<br />
einfach ein politischer oder ein<br />
gesellschaftskritischer oder ein<br />
privater Film, sondern von allem<br />
etwas.“<br />
Farhadi wurde 1972 in Isfahan<br />
geboren, studierte an der Universität<br />
Teheran <strong>und</strong> arbeitete<br />
für Hörfunk <strong>und</strong> Fernsehen. Seit<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
© Heinrich Völkel<br />
Auf der Berlinale: Der Goldene Bär ging an den Iraner<br />
Asghar Farhadi (rechts), Preise bekamen auch der<br />
Ungar Béla Tarr (oben) <strong>und</strong> die Chilenin Maria José<br />
San Martín<br />
seinem Erstlingsfilm „Tanz im<br />
Staub“ 2003 feiert er international<br />
Erfolge. Bei der Berlinale<br />
2009 wurde er bereits <strong>mit</strong> dem<br />
Silbernen Bären für seinen Film<br />
„Alles über Elly“ ausgezeichnet.<br />
Seine Beziehungen zur deutschen<br />
Hauptstadt wird Farhadi in diesem<br />
Jahr weiter ausbauen. Ab Juni<br />
2011 wird er als Gast des <strong>DAAD</strong>-<br />
Künstlerprogramms <strong>mit</strong> seiner<br />
Frau <strong>und</strong> seinen beiden Töchtern<br />
für ein halbes Jahr in Berlin leben.<br />
Schon als Jugendlicher drehte<br />
Farhadi erste eigene Streifen<br />
auf 8mm-Filmen. Auch der ungarische<br />
Regisseur Béla Tarr betätigte<br />
sich bereits <strong>mit</strong> 16 Jahren<br />
als Amateurfilmer. Der 1955 in<br />
Pécs geborene Künstler studierte<br />
an der Hochschule für Film <strong>und</strong><br />
Theater in Budapest. Früh wandte<br />
er sich vom Sozialistischen Realismus<br />
seiner Erstlingswerke ab<br />
<strong>und</strong> dreht seit den 80er Jahren<br />
vorwiegend künstlerisch sehr anspruchsvolle<br />
Schwarzweiß-Filme<br />
<strong>mit</strong> langen, ruhigen Einstellungen.<br />
Alexander Janetzki © Berlinale 2011<br />
1989/90 lebte er auf Einladung<br />
des <strong>DAAD</strong> in Berlin <strong>und</strong> unterrichtete<br />
ab 1990 als Gastdozent an der<br />
Deutschen Film- <strong>und</strong> Fernsehakademie<br />
in Berlin.<br />
Viele seiner Filme beruhen auf<br />
Romanen von László Krasznahorkai.<br />
Der ungarische Schriftsteller<br />
war 1987/88 ebenfalls <strong>DAAD</strong>-Gast<br />
in Berlin. Sein Roman „Satanstango“<br />
(1985) bot die Vorlage für<br />
einen mehr als siebenstündigen<br />
Film, <strong>mit</strong> dem Béla Tarr 1994 bei<br />
der Berlinale Aufsehen erregte. In<br />
diesem Jahr erhielt sein Film „A<br />
Torinói ló“ (Das Turiner Pferd) den<br />
Großen Preis der Jury. Der Film<br />
zeigt das armselige Leben eines<br />
Kutschers, seiner Tochter <strong>und</strong> seines<br />
Pferds. Es ist das Pferd, das<br />
im Januar 1889 von dem Kutscher<br />
in Turin geschlagen wurde, als<br />
der Philosoph Friedrich Nietzsche<br />
hinzukam <strong>und</strong> das Tier schluchzend<br />
umarmte. Das war un<strong>mit</strong>telbar<br />
bevor er in geistige Umnachtung<br />
verfiel. Für Béla Tarr soll dieser<br />
Film nach eigenen Angaben<br />
der letzte seines Lebens sein.<br />
daad 41<br />
F<br />
ür ihren ersten Film in eigener<br />
Regie wurde bei der<br />
Berlinale die Chilenin Maria José<br />
San Martín ausgezeichnet. Die<br />
internationale Jury für Kurzfilme<br />
wählte ihren Beitrag „La Ducha“<br />
(Die Dusche) für den <strong>DAAD</strong>-Kurzfilmpreis<br />
aus. Die 36-jährige Regisseurin<br />
kam vom Theater zum<br />
Film. Sie wirkte zwischen 2005<br />
<strong>und</strong> 2010 bei einigen der wichtigsten<br />
Filme ihres Heimatlandes <strong>mit</strong>,<br />
zunächst als Schauspielerin, dann<br />
als Regieassistentin.<br />
Der zehnminütige Kurzfilm,<br />
bei dem sie als Debütantin Regie<br />
führte <strong>und</strong> auch am Drehbuch<br />
<strong>mit</strong>wirkte, beschreibt den letzten<br />
gemeinsamen Morgen zweier<br />
Frauen im Bad, die sich nach<br />
langer Beziehung trennen. Die<br />
„kraftvolle wie schmerzerfüllte“<br />
Art der Darstellung einer Frauenbeziehung<br />
beeindruckte die<br />
Juroren. Nach der Preisverleihung<br />
sagte San Martín, sie brauche nun<br />
Zeit, um über neue künstlerische<br />
Projekte nachzudenken. Die Gelegenheit<br />
dazu wird kommen:<br />
Der <strong>DAAD</strong>-Kurzfilmpreis, der seit<br />
2006 bei der Berlinale vergeben<br />
wird, ist <strong>mit</strong> einem dreimonatigen<br />
Berlin-Aufenthalt als Gast des<br />
Künstlerprogramms verb<strong>und</strong>en.<br />
Llo/ors<br />
Richard Hübner © Berlinale 2011
42<br />
daad<br />
Als Sabine Kunst im Juli 2010<br />
ihr Amt als Präsidentin des<br />
<strong>DAAD</strong> antrat, freute sie sich auf<br />
die internationalen Aufgaben, die<br />
sie erwarteten. Doch für die erste<br />
Frau an der Spitze des <strong>DAAD</strong> blieb<br />
es bei einem Intermezzo von nur<br />
knapp acht Monaten. Anfang dieses<br />
Jahres wurde ihr anlässlich einer<br />
Kabinettsumbildung im B<strong>und</strong>esland<br />
Brandenburg das Amt<br />
der Wissenschaftsministerin angetragen<br />
– <strong>und</strong> sie nahm an. Die<br />
promovierte Politologin <strong>und</strong> Ingenieurin,<br />
Professorin für Umweltbiotechnologie<br />
<strong>und</strong> Expertin für<br />
Wasserwirtschaft hatte Auslandserfahrung<br />
in China, Südafrika<br />
<strong>und</strong> Lateinamerika gesammelt –<br />
ein Gr<strong>und</strong> unter anderen, warum<br />
die <strong>DAAD</strong>-Präsidentschaft auf sie<br />
zugeschnitten war. Umso mehr<br />
bedauerte sie, das Ehrenamt nach<br />
so kurzer Zeit wieder aufgeben zu<br />
müssen. Über ihre Nachfolge beim<br />
<strong>DAAD</strong> ist noch nicht entschieden.<br />
Vertraut ist Sabine Kunst freilich<br />
auch die brandenburgische<br />
Landespolitik. Seit 2007 war sie<br />
Präsidentin der Universität in<br />
Potsdam, der Hauptstadt Brandenburgs.<br />
Im Kabinett von Ministerpräsident<br />
Matthias Platzeck<br />
(SPD) ist die 56-jährige parteilose<br />
Ministerin seit Ende Februar für<br />
Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong><br />
Kultur zuständig. Ihre vielleicht<br />
schwierigste Aufgabe: Den Hochschulen<br />
muss sie einen Sparkurs<br />
verordnen, unter dem sie als Uni-<br />
Präsidentin selbst gelitten hat.<br />
Llo<br />
© Daniela Sch<strong>mit</strong>ter<br />
Sein Traum von einer Karriere<br />
als Fußballprofi erfüllte sich<br />
nie. Doch Rouven Rech fand eine<br />
andere Berufung: Dokumentarfilme.<br />
Auch als Filmer kann er vom<br />
Fußball nicht ganz lassen: Für seine<br />
Langzeitdokumentation „Das<br />
Leben ist kein Heimspiel“, die in<br />
diesem Frühjahr Premiere feierte,<br />
begleitete er den Fußballverein<br />
TSG 1899 Hoffenheim bei seinem<br />
Aufstieg in die erste B<strong>und</strong>esliga.<br />
Rech zeigt, wie der Verein <strong>und</strong><br />
das dörfliche Umfeld den Erfolg<br />
verarbeiteten. Die „Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung“ lobt: „Ein<br />
liebevoller Heimatfilm“, der „im<br />
Fußball das ganze Leben <strong>und</strong> die<br />
Gegenwart entdeckt“.<br />
Dass Rech einen Blick für das Leben<br />
hat, bewies er bereits in früheren<br />
Projekten. Nach seinem Studium<br />
der Medienwissenschaften an<br />
der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg<br />
ging er 1999 <strong>mit</strong> einem<br />
<strong>DAAD</strong>-Stipendium an die Universidad<br />
del Cine nach Buenos Aires.<br />
Dort recherchierte er für seine Diplomarbeit<br />
über das argentinische<br />
Kino während der Militärherrschaft.<br />
Sein Film „Nachbarn“ – die<br />
Abschlussarbeit eines Aufbaustudiums<br />
an der Filmakademie<br />
Baden-Württemberg – beschreibt<br />
am Beispiel eines reichen, abgeschirmten<br />
Viertels im Norden von<br />
Buenos Aires die soziale Kluft in<br />
Argentinien nach dem wirtschaftlichen<br />
Zusammenbruch. Rech ist<br />
inzwischen eine angesehene Größe<br />
im Doku-Genre. Der Weg dahin<br />
war nicht leicht. „Es ist ein hartes<br />
Brot“, sagt er, „aber dennoch ist es<br />
ein toller Beruf.“<br />
Einen Trailer zum aktuellen<br />
Film gibt es unter www.hoffenheim-film.de.<br />
boh<br />
© David Ausserhofer<br />
© Rouven Rech<br />
Eine 14-tägige Wanderung<br />
durch die Rocky Mountains<br />
gab den Anstoß für das Geologie-<br />
Studium. Damals war Hauke<br />
Marquardt 20 Jahre alt. Die<br />
Tour durch die gewaltige amerikanische<br />
Berglandschaft weckte<br />
das Interesse am Boden unter<br />
seinen Füßen. Wie tief er einmal<br />
ins Innerste der Erde vordringen<br />
würde, wusste er damals freilich<br />
noch nicht. Zehn Jahre später,<br />
im November 2010, erhielt er für<br />
die beste naturwissenschaftliche<br />
Dissertation den <strong>mit</strong> 30 000 Euro<br />
dotierten Deutschen Studienpreis<br />
der Körber-Stiftung. Seine<br />
Forschung über die „geologische<br />
Unterwelt“ hatte die Jury beeindruckt.<br />
Für seine Promotion an<br />
der Freien Universität Berlin hatte<br />
er am Deutschen GeoForschungs-<br />
Zentrum Potsdam (GFZ) im Laborversuch<br />
die Bedingungen im weitgehend<br />
unerforschten unteren<br />
Erdmantel – in 1900 Kilometer<br />
Tiefe – nachgestellt.<br />
Marquardt, heute wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am GFZ, will<br />
die Prozesse im tiefen Erdinneren<br />
verstehen <strong>und</strong> auch künftig<br />
an seiner „Vision“ arbeiten: der<br />
sicheren Erdbebenvorhersage.<br />
Dafür forschte der 30-Jährige voriges<br />
Jahr im Postdoc-Programm<br />
des <strong>DAAD</strong> an der University of<br />
California in Berkeley. Llo<br />
Rätsel-Lösungen<br />
Die LöSUNG des vorigen Letter-Rätsels lautet:<br />
MAUERSEGLER<br />
Die LÖSUNG ergibt sich aus folgenden Wörtern: meise,<br />
amsel, Uhu, Elster, rabe, Specht, Eisvogel, gans, lerche,<br />
Eule, reihe<br />
Einen Hauptpreis haben gewonnen:<br />
Juri Kiyko, Czernowitz/Ukraine; Blanka Pirnerova,<br />
Plzen/Tschechien; Adriana Garcia-Vargas, Genf/Schweiz;<br />
Mahmut Karakus, Istanbul/Türkei; Margarita Cazanobe,<br />
Buenos Aires/Argentinien; Nickolas Gakhokidze, Tbilisi/<br />
Georgien; Silvia Terracciano, Mailand/Italien; Sunanda<br />
Mahajan, Kothrud Pune/Indien; Merili Metsvahi,<br />
Tartu/Estland; Kristiana Selimi, Jena/Deutschland<br />
Einen Trostpreis erhalten:<br />
Krisna Murti, Würzburg/Deutschland; Igor Sklar,<br />
Zaporoshje/Ukraine; Samuel Sekiziyivu, Kampala/<br />
Uganda; Mutabar Baxriddinova, Hojaobod Andijan/<br />
Usbekistan; D<strong>mit</strong>rij Zharin, Fanipol/Weißrussland<br />
Wer war’s?<br />
FRIEDRICH VON SCHILLER<br />
Anne Siemons, Berlin/Deutschland; Desirée Rocha<br />
de Sá, Sousa/Paraíba/Brasilien; Ari Arinafril,<br />
Palembang/Indonesien; Nurcan Özköklü, Ankara/<br />
Türkei; Anna Schallau, Gatersleben/Deutschland<br />
<strong>DAAD</strong> Letter<br />
Das Magazin für <strong>DAAD</strong>-Alumni<br />
Herausgeber:<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V., Bonn<br />
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany<br />
Tel.: +49-228-882-0, Fax: +49-228-882-444<br />
E-Mail: postmaster@daad.de<br />
Redaktion: Katja Sproß (verantwortlich), Uschi Heidel,<br />
Dr. Isabell Lisberg-Haag, Bettina Mittelstraß<br />
Weitere Autoren: Boris Hänßler (boh), Christine Hardt,<br />
Christian Hohlfeld (cho), Dr. Klaus Hübner (Michel), Christoph<br />
Kessler (CK), Mareike Knoke (mk), Mirko Lomoth (lom),<br />
Dr. Leonie Loreck (Llo), Bernd Müller (BM), Dietrich von<br />
Richthofen (dvr), Horst Willi Schors (ors), Claudia Wallendorf<br />
(CW), Julia Walter (JW), Sabine Wygas (wys), Natalie Zündorf<br />
Übersetzungen Abstracts: Tony Crawford<br />
Koordination: Sabine Pauly<br />
Redaktionsbeirat: Dr. Klaus Birk, Bendedikt Brisch,<br />
Claudius Habbich, Francis Hugenroth (Vorsitz), Pia Klein,<br />
Christian Hülshörster, Birgit Klüsener, Ruth Krahe,<br />
Dr. Anette Pieper, Alexandra Schäfer, Christiane Schmeken,<br />
Nina Scholtes, Friederike Schomaker, Julia Vitz<br />
Gestaltung/Titel: axeptDESIGN, Berlin<br />
Titelillustration: dieKLEINERT.de/Frank Schmolke<br />
Herstellung: Bonifatius GmbH Paderborn<br />
Redaktion Bonn:<br />
Trio Service GmbH – www.trio-medien.de<br />
Kaiserstr. 139-141<br />
53113 Bonn, Germany<br />
Tel.: +49-228-1801662, Fax: +49-228-1801663<br />
E-Mail: spross@trio-medien.de<br />
Redaktion Berlin:<br />
Chausseestr.103<br />
10115 Berlin, Germany<br />
Tel.: +49-30-48810128, Fax: +49-30-85075452<br />
E-Mail: loreck@trio-medien.de<br />
Auch nicht ausgezeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall<br />
die Meinung des Herausgebers wieder.<br />
<strong>DAAD</strong> Letter erscheint dreimal im Jahr.<br />
Einzelpreis 6,– Euro, Jahresabonnement 15,– Euro<br />
inklusive Porto <strong>und</strong> MwSt.<br />
Printed in Germany – Imprimé en Allemagne PVST 20357<br />
Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein Faltblatt des<br />
<strong>DAAD</strong>-Fre<strong>und</strong>eskreises bei.
© dpa/Jens Kalaene<br />
19. Dezember<br />
Sportler des Jahres<br />
Deutschlands Sportjournalisten<br />
küren in Baden-Baden ihre nationalen<br />
Sportler 2010: Formel-<br />
1-Weltmeister Sebastian Vettel,<br />
Skifahrerin <strong>und</strong> Doppel-Olympiasiegerin<br />
Maria Riesch sowie die<br />
Deutsche Fußball-Nationalelf der<br />
Männer.<br />
21. Dezember<br />
Dioxin im Tierfutter<br />
In Deutschland wird Dioxin, ein<br />
krebserregendes Gift, in Tierfutter<br />
entdeckt. Die B<strong>und</strong>esregierung<br />
schätzt, dass bis zu 150 000<br />
Tonnen Futter für Geflügel <strong>und</strong><br />
Schweine verseucht sein könnten.<br />
Bauern müssen mehr als h<strong>und</strong>erttausend<br />
Eier vernichten <strong>und</strong> Tausende<br />
von Tieren töten.<br />
1. Januar<br />
Fehlstart beim Biosprit<br />
Tankstellen in Deutschland bieten<br />
einen neuen Treibstoff an: das<br />
Biobenzin E10. Es soll den CO2-<br />
Ausstoß <strong>und</strong> die Abhängigkeit von<br />
den Ölförderstaaten verringern.<br />
Doch kaum ein Autofahrer tankt<br />
den Biosprit. Beim „Benzin-Gipfel“<br />
am 8. März beschließen Politik,<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Verbände, die<br />
Autofahrer besser zu informieren.<br />
24. Januar<br />
Bernd Eichinger tot<br />
Der Filmproduzent Bernd Eichinger<br />
stirbt in Los Angeles im<br />
Alter von 61 Jahren an einem<br />
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
deutsche chronik<br />
Eine Auswahl von Ereignissen, die in der B<strong>und</strong>esrepublik Schlagzeilen machten (1. Dezember 2010 bis 31. März 2011)<br />
Herzinfarkt. Er zählt zu den bekanntesten<br />
Filmemachern der<br />
deutschen Nachkriegsgeschichte.<br />
Erfolge erzielte er zum Beispiel<br />
<strong>mit</strong> dem Oscar-prämierten Film<br />
„Nirgendwo in Afrika“ <strong>und</strong> <strong>mit</strong><br />
„Der Name der Rose“.<br />
28. Januar<br />
Afghanistan-Mandat verlängert<br />
Der B<strong>und</strong>estag verlängert <strong>mit</strong><br />
großer Mehrheit das Afghanistan-<br />
Mandat. Die B<strong>und</strong>eswehr bleibt<br />
bis Ende 2012 in dem Land. Der<br />
Abzug soll Ende 2011 beginnen<br />
<strong>und</strong> 2014 abgeschlossen sein,<br />
wenn es die Lage erlaubt.<br />
1. Februar<br />
Innovationsmotor<br />
Deutschland gehört zu den innovationsstärksten<br />
Ländern der<br />
Europäischen Union (EU). Das<br />
zeigt der von der Europäischen<br />
Kommission veröffentlichte Innovationsanzeiger<br />
2010. Allerdings<br />
bleibt die EU nach wie vor hinter<br />
den USA <strong>und</strong> Japan zurück.<br />
20. Februar<br />
CDU stürzt ab<br />
In Hamburg erringt die SPD bei<br />
den Wahlen zur Bürgerschaft die<br />
absolute Mehrheit der Sitze. Olaf<br />
Scholz löst Christoph Ahlhaus<br />
(CDU) als Ersten Bürgermeister<br />
ab. Die CDU verliert knapp die<br />
Hälfte der Stimmen <strong>und</strong> fährt <strong>mit</strong><br />
21,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis<br />
in Hamburg ein. Ihr wird<br />
das Scheitern der Koalition <strong>mit</strong><br />
den Grünen angelastet, die acht<br />
Monate zuvor geplatzt war. Die<br />
Grünen legen dagegen leicht auf<br />
11,2 Prozent zu. Die FDP zieht <strong>mit</strong><br />
6,7 Prozent erstmals seit 2001<br />
wieder in die Bürgerschaft ein.<br />
Auch „Die Linke“, die erneut 6,4<br />
Prozent erhält, ist vertreten.<br />
1. März<br />
Guttenberg gibt auf<br />
Verteidigungsminister Karl-Theodor<br />
zu Guttenberg erklärt nach<br />
anhaltender Kritik seinen Rücktritt<br />
von allen politischen Ämtern.<br />
Zwei Wochen zuvor war bekannt<br />
geworden, dass der CSU-Politiker<br />
in seiner 2006 erschienenen<br />
Doktorarbeit Textpassagen aus<br />
anderen Veröffentlichungen ohne<br />
Trauer: Filmproduzent Bernd<br />
Eichinger ist tot<br />
Sorge:<br />
Deutschland überprüft<br />
die Sicherheit<br />
der Kernkraftwerke<br />
Hinweis übernommen hatte. Die<br />
Universität Bayreuth entzog ihm<br />
seinen Doktortitel.<br />
14. März<br />
Umdenken bei Atomkraft<br />
Die B<strong>und</strong>esregierung setzt die beschlossene<br />
Laufzeitverlängerung<br />
der Atomkraftwerke für drei Monate<br />
aus. Da<strong>mit</strong> reagiert sie auf die<br />
Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk<br />
Fukushima <strong>und</strong> die<br />
daraufhin gestiegene Ablehnung<br />
der Atomkraft in Deutschland. Die<br />
Sicherheit aller Meiler soll überprüft<br />
werden. Sieben Kraftwerke<br />
gehen vorerst vom Netz.<br />
17. März<br />
Enthaltung<br />
Der Uno-Sicherheitsrat beschließt<br />
die Einrichtung einer Flugverbotszone<br />
sowie weitere Maßnahmen<br />
zum Schutz der Bevölkerung in<br />
Libyen. Deutschland enthält sich<br />
der Stimme <strong>und</strong> beteiligt sich<br />
nicht an den Luftschlägen gegen<br />
die Truppen des libyschen Machthabers<br />
Muammar al-Gaddafi.<br />
20. März<br />
Kaum Veränderungen<br />
Bei der Landtagswahl in Sachsen-<br />
Anhalt bleiben die Stimmanteile<br />
der drei großen Parteien nahezu<br />
unverändert. Die CDU (32,5 Prozent)<br />
stellt weiterhin die meisten<br />
Abgeordneten, gefolgt von<br />
der „Linken“ (23,7) <strong>und</strong> der SPD<br />
(21,5). Voraussichtlich bilden CDU<br />
<strong>und</strong> SPD erneut die Regierung.<br />
Die Grünen ziehen <strong>mit</strong> 7,1 Prozent<br />
erstmals seit 1994 wieder in den<br />
Landtag ein. Nicht mehr vertreten<br />
ist die FDP. Die Wahlbeteiligung<br />
steigt von 44,4 auf 51,2 Prozent.<br />
Jubel: Die Grünen feiern Erfolge<br />
bei Landtagswahlen<br />
27. März<br />
Grüne schreiben Geschichte<br />
Die Landtagswahlen in Baden-<br />
Württemberg <strong>und</strong> Rheinland-Pfalz<br />
stehen im Zeichen der Atomkrise<br />
in Japan. Die Wahlbeteiligung<br />
steigt in beiden B<strong>und</strong>esländern.<br />
Am meisten profitieren die Grünen.<br />
In Baden-Württemberg steht<br />
nach r<strong>und</strong> 60 Jahren Regierungszeit<br />
der CDU ein Machtwechsel<br />
bevor. Die CDU liegt nur noch bei<br />
39 Prozent. Die Grünen verdoppeln<br />
ihren Stimmanteil auf 24,2<br />
Prozent <strong>und</strong> könnten <strong>mit</strong> Hilfe der<br />
SPD (23,1) erstmals in ihrer Geschichte<br />
einen Ministerpräsidenten<br />
stellen. Die FDP schafft knapp<br />
den Wiedereinzug in das Landesparlament,<br />
dagegen scheitert „Die<br />
Linke“.<br />
In Rheinland-Pfalz verliert die<br />
SPD von Ministerpräsident Kurt<br />
Beck deutlich. Mit 35,7 Prozent<br />
liegt sie nur 0,5 Prozentpunkte<br />
vor der CDU. Trotzdem könnte<br />
Beck bei einer Koalition <strong>mit</strong> den<br />
Grünen weiter regieren. Die Grünen<br />
steigern sich von 4,6 auf 15,4<br />
Prozent. Die FDP ist nicht mehr<br />
im Landtag vertreten, „Die Linke“<br />
scheitert erneut.<br />
© dpa/Patrick Seeger<br />
© RWE Pressebild<br />
43