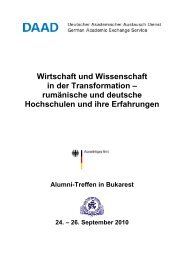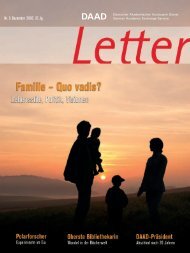Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
Lesen mit Lust und Laune - DAAD-magazin
- TAGS
- lust
- laune
- www.daad-magazin.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DAAD</strong> Letter 1/11<br />
SprachWErkStatt<br />
Schlagen Sie nach!<br />
Für die deutsche Rechtschreibung<br />
gibt es ein ein Standardwerk<br />
zum Nachschlagen: Nachschlagen: den<br />
Duden. Was es <strong>mit</strong> <strong>mit</strong> diesem<br />
Buch auf sich hat <strong>und</strong> auf<br />
wen es zurückgeht, lesen Sie<br />
im folgenden Text. Dort sind<br />
an 30 Stellen Rechtschreibfehler<br />
versteckt, die zu finden<br />
sind. Im Zweifelsfall schlagen<br />
Sie doch einfach im Duden<br />
nach! Das geht auch unter<br />
www.duden.de.<br />
Vielleicht Vielleicht haben Sie ihn schon öfter zur Hand genommen: den Duden, das grosse StanStandardwerk der deutschen Rechtschreibung. In seiner aktuelen Ausgabe, der 25. Auflage<br />
von 2009, sind r<strong>und</strong> 135 000 Stichwörter enthalten. Drei Jahre zuvor war nach langem<br />
hin <strong>und</strong> her <strong>und</strong> gründlicher Überarbeitung die jüngste deutsche Rechtschreibreform<br />
entgültig <strong>und</strong> verbindlich in kraft getreten.<br />
Der Mann, der dem Werk seinen Nahmen gab, war Konrad Alexander Friedrich Duden<br />
(1829 – 1911), dessen Todestag sich am 1. August dieses Jahres zum h<strong>und</strong>ertstenmal<br />
jährt. Gebohren wurde er als Sohn eines Gutsbesitzers bei Wesel. Nach dem Abitur studierte<br />
er in Bonn Filologie, Germanistik <strong>und</strong> Geschichte. Im Revolutionsjahr 1848 brach<br />
er sein Studium ab <strong>und</strong> nahm in Frankfurt am Main eine Stelle als Hausleerer an. Sein<br />
Staatsexamen holte er 1854 nach <strong>und</strong> promovierte anschliessend an der Universität Marburg.<br />
Kurz darauf ging er als Hauslehrer nach Italien, wo er Adeline Jakob kennenlernte,<br />
die später (1861) seine Ehefrau <strong>und</strong> Mutter der sechs gemeinsamen Kinder wurde.<br />
1859 nach Deutschland zurück gekehrt, unterichtete Konrad Duden zunächst zehn Jahre<br />
an einem Soester Gymnasium. Danach wurde er Director eines Gymnasiums in Schleiz<br />
<strong>und</strong> begann schon bald, Rechtschreibregeln für seine Schule zu erarbeiten. Das besondere<br />
an diesen Regeln: Sie richteten sich erstmals am Prinzip der Fonetik aus – gemäss<br />
dem Motto: Schreibe, wie Du sprichst.<br />
Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 bewirkte, daß nun für ganz Deutschland<br />
allgemein gültige Rechtschreibregeln eingeführt werden sollten. Zwar wurden die Reformbestrebungen<br />
1876 durch das Veto des Reichskanzlers Otto von Bismarck zunächst<br />
zunichte gemacht. Doch Duden, der im selben Jahr Direktor des Königlichen Gymnasiums<br />
in Bad Hersfeld wurde, liess sich nicht beirren <strong>und</strong> veröfentlichte 1880 sein „Vollständiges<br />
Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Der heute so genannte<br />
„Uhrduden“ enthielt 27 000 Stichwörter <strong>und</strong> bildete die Gr<strong>und</strong>lage für eine einheitliche<br />
Rechtschreibung im deutschen. Es dauerte aller Dings noch weitere zwölf Jahre, bis der<br />
deutsche B<strong>und</strong>esrat beschloß, Dudens Regeln als verbindlich für das gesammte deutsche<br />
Reich einzuführen – ein Beschluss, den auch Österreich-Ungarn <strong>und</strong> die Schweiz<br />
übernamen.<br />
Erst <strong>mit</strong> 76 Jahren ging Konrad Duden in den Ruhestand. Doch auch dann wollte er nicht<br />
kürzer treten, sondern arbeitete weiter <strong>mit</strong> in der Dudenredaktion, die er noch bis zur<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertwende fast allein geführt hatte. Am 1. August 1911 ferstarb er in Sonnenberg<br />
bei Wiesbaden <strong>und</strong> wurde im Familiengrab in Bad Hersfeld beigesetzt.<br />
Christine Hardt<br />
LÖSUNG: große; aktuellen; Hin <strong>und</strong> Her; endgültig; Kraft; Namen; h<strong>und</strong>ertsten Mal; geboren; Philologie;<br />
Hauslehrer; anschließend; zurückgekehrt; unterrichtete; Direktor; Besondere; gemäß; du; dass;<br />
zunichtegemacht; ließ; veröffentlichte; Urduden; Deutschen; allerdings; beschloss; gesamte; Deutsche;<br />
übernahmen; kürzertreten; verstarb.<br />
© Duden<br />
aUfgESpiESSt<br />
Rätselhafte Floskeln<br />
SprachEckE<br />
Wer heutzutage zwischen Flensburg <strong>und</strong> Garmisch<br />
unterwegs ist <strong>und</strong> sich dabei notgedrungen<br />
in Hotels, Gaststätten <strong>und</strong> Geschäften<br />
herumtreibt, wird von der einst vielbeklagten<br />
„Servicewüste Deutschland“ nicht mehr allzu<br />
viel spüren. Vor allem sprachlich nicht. Bis zum<br />
Abwinken wird dem Reisenden ein fre<strong>und</strong>liches<br />
„Kein Problem!“ oder „Sehr gern!“ entgegenschallen<br />
– selbst bei Bitten oder Fragen, die<br />
solche Antworten ein wenig seltsam, vielleicht<br />
sogar übertrieben erscheinen lassen: „Ich hätte<br />
gerne noch ein Bier!“ – „Kein Problem!“. Merkwürdig,<br />
nicht wahr? Und manchmal ein bisschen<br />
nervig. Gerade im weltweit bekannten Kernland<br />
des Gerstensafts sollte es eigentlich nirgendwo<br />
ein Problem sein, einen simplen Zapfhahn<br />
ein Stück weit herumzudrehen <strong>und</strong> das frische<br />
Bier dem Gast dann <strong>mit</strong> einem schlichten „Bitte<br />
sehr!“ zu servieren.<br />
„Sehr gern!“ übrigens hat bereits vielfach das<br />
alte „Bitte!“ ersetzt – jemand hält einem die Tür<br />
auf, man sagt: „Danke!“ <strong>und</strong> bekommt zur Antwort:<br />
„Sehr gern!“. Oder nur: „Gern!“. Ob die oft<br />
wie angelernt wirkenden Sprach-Fertigteilchen<br />
womöglich nur bedeuten: „Lass mich in Ruhe!“?<br />
Man sollte solche Verbal-Versatzstücke natürlich<br />
nicht nur <strong>mit</strong> Argwohn betrachten <strong>und</strong> darf<br />
durchaus annehmen, dass sie oft guten Willen<br />
transportieren. Auch wenn sie selten einmal<br />
wirklich angemessen sind – <strong>und</strong> die Angemessenheit<br />
der Rede gilt doch seit jeher als ein wichtiges<br />
Element konstruktiver Rhetorik.<br />
Floskeln zu gebrauchen, die alle ständig im M<strong>und</strong>e<br />
führen, ist das Gegenteil von originell <strong>und</strong><br />
da<strong>mit</strong> auch von persönlich. Aber es sind eben<br />
Floskeln, mehr nicht. „Wie geht’s?“ ist ja auch<br />
keine Frage nach dem persönlichen Wohlergehen,<br />
sondern eine unverbindliche Gesprächseinleitung.<br />
Doch anders als beispielsweise in den<br />
USA werden solche sprachlichen Versatzstücke<br />
in Deutschland nicht unbedingt als hilfreich angesehen.<br />
Es kann ein sensibles Gemüt durchaus<br />
stören, wenn es vor sieben Uhr morgens <strong>mit</strong> der<br />
Floskel „Schönen Tag noch!“ aus der Bäckerei<br />
entlassen wird. Der Tag hat doch noch nicht einmal<br />
richtig angefangen! Da lobt man sich denn<br />
doch ganz altmodische Verabschiedungen wie<br />
„Einen guten Morgen!“ oder einfach: „Auf Wiedersehen!“<br />
findet<br />
29