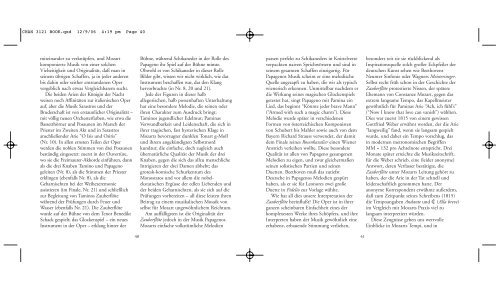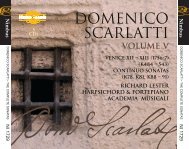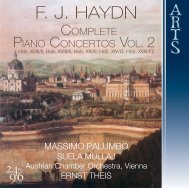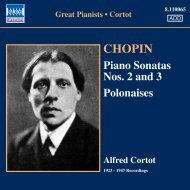Christopher Purves bass - Chandos
Christopher Purves bass - Chandos
Christopher Purves bass - Chandos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAN 3121 BOOK.qxd 12/9/06 4:19 pm Page 40<br />
miteinander zu verknüpfen, und Mozart<br />
komponierte Musik von einer solchen<br />
Vielseitigkeit und Originalität, daß man in<br />
seinem übrigen Schaffen, ja in jeder anderen<br />
bis dahin oder seither entstandenen Oper<br />
vergeblich nach etwas Vergleichbarem sucht.<br />
Die beiden Arien der Königin der Nacht<br />
weisen noch Affinitäten zur italienischen Oper<br />
auf, aber die Musik Sarastros und der<br />
Bruderschaft ist von erstaunlicher Originalität –<br />
mit völlig neuen Orchesterfarben, wie etwa die<br />
Bassetthörner und Posaunen im Marsch der<br />
Priester im Zweiten Akt und in Sarastros<br />
anschließender Arie “O Isis und Osiris”<br />
(Nr. 10). In allen ernsten Teilen der Oper<br />
werden die noblen Stimmen von drei Posaunen<br />
beständig eingesetzt: zuerst in der Ouvertüre,<br />
wo sie die Freimaurer-Akkorde einführen, dann<br />
als die drei Knaben Tamino und Papageno<br />
geleiten (Nr. 8), als die Stimmen der Priester<br />
erklingen (ebenfalls Nr. 8), als die<br />
Geharnischten bei der Weihezeremonie<br />
assistieren (im Finale, Nr. 21) und schließlich<br />
zur Begleitung von Taminos Zauberflöte<br />
während der Prüfungen durch Feuer und<br />
Wasser (ebenfalls Nr. 21). Die Zauberflöte<br />
wurde auf der Bühne von dem Tenor Benedikt<br />
Schack gespielt; das Glockenspiel – ein neues<br />
Instrument in der Oper – erklang hinter der<br />
40<br />
Bühne, während Schikaneder in der Rolle des<br />
Papageno ihr Spiel auf der Bühne mimte.<br />
Obwohl es von Schikaneder in dieser Rolle<br />
Bilder gibt, wissen wir nicht wirklich, wie das<br />
Instrument beschaffen war, das den Klang<br />
hervorbrachte (in Nr. 8, 20 und 21).<br />
Jede der Figuren in dieser halb<br />
allegorischen, halb possenhaften Unterhaltung<br />
hat eine besondere Melodie, die seinen oder<br />
ihren Charakter zum Ausdruck bringt:<br />
Taminos jugendlicher Edelmut; Paminas<br />
Verwundbarkeit und Leidenschaft, die sich in<br />
ihrer tragischen, fast hysterischen Klage in<br />
Mozarts bevorzugter dunklen Tonart g-Moll<br />
und ihrem angekündigten Selbstmord<br />
kundtut; die einfache, doch zugleich auch<br />
übernatürliche Qualität der Musik der drei<br />
Knaben, gegen die sich das allzu menschliche<br />
Intrigieren der drei Damen abhebt; das<br />
grotesk-komische Schurkentum des<br />
Monostatos und vor allem die nobelekstatischen<br />
Ergüsse der edlen Liebenden und<br />
der beiden Geharnischten, als sie sich auf die<br />
Prüfungen vorbereiten – all diese leisten ihren<br />
Beitrag zu einem musikalischen Mosaik von<br />
selbst für Mozart ungewöhnlichem Reichtum.<br />
Am auffälligsten ist die Originalität der<br />
Zauberflöte jedoch in der Musik Papagenos.<br />
Mozarts einfache volkstümliche Melodien<br />
passen perfekt zu Schikaneders in Knittelverse<br />
verpackten naiven Sprichwörtern und sind in<br />
seinem gesamten Schaffen einzigartig. Für<br />
Papagenos Musik scheint er eine melodische<br />
Quelle angezapft zu haben, die wir als typisch<br />
wienerisch erkennen. Unmittelbar nachdem er<br />
die Wirkung seines magischen Glockenspiels<br />
getestet hat, singt Papageno mit Pamina ein<br />
Lied, das beginnt “Könnte jeder brave Mann”<br />
(“Armed with such a magic charm”). Diese<br />
Melodie wurde später in verschiedenen<br />
Formen von österreichischen Komponisten<br />
von Schubert bis Mahler sowie auch von dem<br />
Bayern Richard Strauss verwendet, der damit<br />
dem Finale seines Rosenkavalier einen Wiener<br />
Anstrich verleihen wollte. Diese besondere<br />
Qualität ist allen von Papageno gesungenen<br />
Melodien zu eigen, und zwar gleichermaßen<br />
seinen solistischen Partien und seinen<br />
Duetten. Beethoven muß das zutiefst<br />
Deutsche in Papagenos Melodien gespürt<br />
haben, als er sie für Leonores zwei große<br />
Duette in Fidelio zur Vorlage wählte.<br />
Wie hat all dies unsere Interpretation der<br />
Zauberflöte beeinflußt? Die Oper ist in ihrer<br />
ganzen scheinbaren Einfachheit eines der<br />
komplexesten Werke ihres Schöpfers, und ihre<br />
Interpreten haben der Musik gewöhnlich eine<br />
erhabene, erbauende Stimmung verliehen,<br />
41<br />
besonders seit sie sie rückblickend als<br />
Inspirationsquelle solch großer Eckpfeiler der<br />
deutschen Kunst sehen wie Beethovens<br />
Neunter Sinfonie oder Wagners Meistersinger.<br />
Selbst recht früh schon in der Geschichte der<br />
Zauberflöte protestierte Nissen, der spätere<br />
Ehemann von Constanze Mozart, gegen das<br />
extrem langsame Tempo, das Kapellmeister<br />
gewöhnlich für Paminas Arie “Ach, ich fühl’s”<br />
(“Now I know that love can vanish”) wählten.<br />
Dies war zuerst 1815 von einem gewissen<br />
Gottfried Weber erwähnt worden, der die Arie<br />
“langweilig” fand, wenn sie langsam gespielt<br />
wurde, und daher ein Tempo vorschlug, das<br />
in modernen metronomischen Begriffen<br />
MM = 132 pro Achtelnote entspricht. Drei<br />
Monate später erreichte die Musikzeitschrift,<br />
für die Weber schrieb, eine (leider anonyme)<br />
Antwort, deren Verfasser bestätigte, die<br />
Zauberflöte unter Mozarts Leitung gehört zu<br />
haben, der die Arie in der Tat schnell und<br />
leidenschaftlich genommen hatte. Der<br />
anonyme Korrespondent erwähnte außerdem,<br />
daß zum Zeitpunkt seines Schreibens (1815)<br />
die Tempoangaben Andante und C| (Alla breve)<br />
im Vergleich mit Mozarts Praxis viel zu<br />
langsam interpretiert würden.<br />
Diese Zeugnisse geben uns wertvolle<br />
Einblicke in Mozarts Tempi, und in