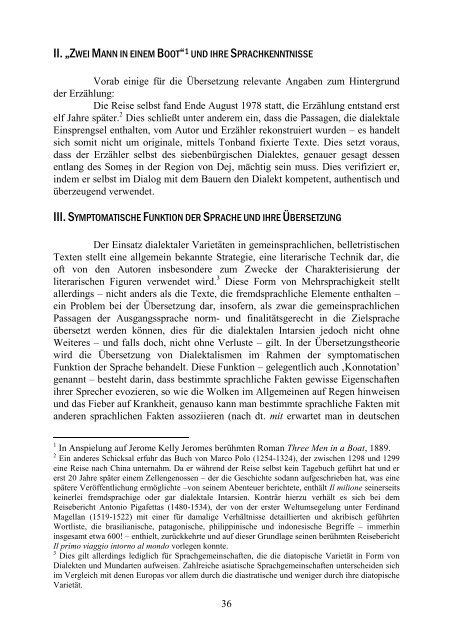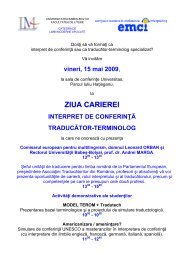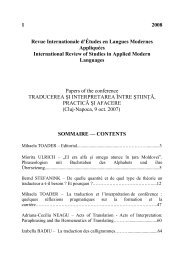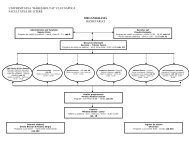- Page 1: REVUE INTERNATIONALE D’ÉTUDES EN
- Page 4 and 5: Thomas Lenzen, La note du traducteu
- Page 7: I ère Partie Actes du colloque int
- Page 10 and 11: sourciers et ciblistes pour dire le
- Page 12 and 13: 100). Un livre fameux en la matièr
- Page 14 and 15: la force dans le langage » (2007 :
- Page 17 and 18: Un herméneute dans l’âme : Tudo
- Page 19 and 20: soit pas orné d‘un jeu de mots,
- Page 21 and 22: ien. Quand il fait très froid, non
- Page 23 and 24: présentent comme points d‘orient
- Page 25 and 26: Nous arrêterons là la liste des s
- Page 27 and 28: La « praxéologie » de la traduct
- Page 29 and 30: D‘ailleurs le traducteur et tradu
- Page 31 and 32: des solutions de compensation, sans
- Page 33 and 34: l’ellipse, solution tout à fait
- Page 35: Numa’ că musai trebe să dau egz
- Page 39 and 40: Derselbe Junge stellt seiner Mutter
- Page 41 and 42: Pourquoi et comment mimer la traduc
- Page 43 and 44: II. ENQUÊTE occidentale, qui voit
- Page 45 and 46: Les références culturelles : parf
- Page 47 and 48: Il y a aussi d‘autres inadvertanc
- Page 49 and 50: Une interrogation sur le sens d‘u
- Page 51 and 52: Le traductologue que nous sommes, n
- Page 53 and 54: traducteur/traductologue sur fond d
- Page 55 and 56: Dynamique et subjectivité du disco
- Page 57 and 58: explicite l‘une des caractéristi
- Page 59 and 60: n‘était plus là. » (Dubois 200
- Page 61 and 62: « coup » est remplacé par « pal
- Page 63 and 64: 2.4.3. Transposition d’un mode ve
- Page 65 and 66: (Dubois, Ionescu 2005 : 182) [heure
- Page 67: (Dubois, Ionescu 2005 : 182). Une a
- Page 71 and 72: Les voix fédérées ou confédér
- Page 73 and 74: état de cohabitation avec la voix
- Page 75 and 76: 1) de ce que l‘écrivain suppose
- Page 77 and 78: n‘ai pas été capable d‘écrir
- Page 79 and 80: premier dans un texte second « bé
- Page 81 and 82: Outre les reports (Maramures, Kunde
- Page 83 and 84: Tsepeneag, Dumitru (2001) Au pays d
- Page 85 and 86: Traduire ou (comment) faire entendr
- Page 87 and 88:
moduler sa voix pour tenter de fair
- Page 89 and 90:
Holden‘s restraints help to chara
- Page 91 and 92:
Ainsi, son approche reprend des él
- Page 93 and 94:
[1] I slid the hell down in my chai
- Page 95 and 96:
Nous avons évoqué plus haut le mo
- Page 97 and 98:
... comme si quelqu‘un venait jus
- Page 99 and 100:
Adepte du « courant de conscience
- Page 101 and 102:
Berman, Antoine (1984) L‘épreuve
- Page 103 and 104:
“Palabras que no tienen una corre
- Page 105 and 106:
estudios también han puesto de man
- Page 107 and 108:
adquieren de manera implícita en e
- Page 109 and 110:
operacional del traductor, sus estr
- Page 111 and 112:
IV. EVIDENCIAS: LA VOZ DE LOS TRADU
- Page 113 and 114:
NORMAS DE LA LENGUA ALEMANA se sele
- Page 115 and 116:
(1) ―[...] es necesario ordenar l
- Page 117 and 118:
teorías subjetivas con procedimien
- Page 119:
Rodrigues, C. (2001) Überzeugungen
- Page 122 and 123:
concreto del escenario y de los act
- Page 124 and 125:
―representaciñn‖ e insistir en
- Page 126 and 127:
Marleau, D. (1997) “Avant propos
- Page 128 and 129:
4/ les visions culturelles du monde
- Page 130 and 131:
Ce syntagme cliché est si notoire
- Page 132 and 133:
**Reviste pentru tineret. (13) […
- Page 134 and 135:
(21) Se pare că decandenţii au c
- Page 136 and 137:
(35) Etapa următoare, pentru ele [
- Page 138 and 139:
(43) […] vom intui mai uşor gân
- Page 140 and 141:
o la NdT résumé (la NdT où le te
- Page 142 and 143:
Carmen ANDREI is an Associate Profe
- Page 144 and 145:
which influence the choice of a cer
- Page 146 and 147:
eference, the cultural transparency
- Page 148 and 149:
However, this classification might
- Page 150 and 151:
adequate equipment and resources, m
- Page 152 and 153:
the semiotic value of the referent,
- Page 155 and 156:
Issues of Voice for the CAT-Assiste
- Page 157 and 158:
on translation workbench tools and
- Page 159 and 160:
eformats it in order for it to be t
- Page 161 and 162:
It is reasonable to assume that the
- Page 163 and 164:
normal texts. The translator must r
- Page 165:
V. CONCLUSION The use of CAT tools
- Page 168 and 169:
s‘exprimer devant un auditoire. V
- Page 170 and 171:
sentiment de satisfaction ou de reg
- Page 172 and 173:
voix, considérant que les seules c
- Page 175 and 176:
La terminologie eurolectale en usag
- Page 177 and 178:
pourrait présenter une technicité
- Page 179 and 180:
métaphoriquement pour désigner le
- Page 181 and 182:
syntagmes asyndétiques : mesures a
- Page 183 and 184:
L‘emprunt terminologique paraît
- Page 185 and 186:
étant incorporées dans des énonc
- Page 187 and 188:
tous les 20 domaines de l‘acquis
- Page 189 and 190:
Herramientas del portal Europa util
- Page 191 and 192:
nacional multilingüe debido a los
- Page 193 and 194:
consiste en la totalidad de las sen
- Page 195 and 196:
A estas alturas, se impone hacer un
- Page 197 and 198:
Dada la extensión de la sentencia
- Page 199 and 200:
vemos ejemplos de malas prácticas
- Page 201 and 202:
La note du traducteur en traduction
- Page 203 and 204:
un projet de terminographie « macr
- Page 205 and 206:
mise en demeure, initialement adres
- Page 207 and 208:
commanditaire initial d‘un servic
- Page 209 and 210:
I. INTRODUCTION Lire l’organisati
- Page 211 and 212:
Et c‘est du brassage entre ces di
- Page 213 and 214:
Scène 1 Scène 2 Scène 3 Le PS Sc
- Page 215 and 216:
que celle du PS est plus traditionn
- Page 217 and 218:
ênes du pouvoir. C‘est le seul p
- Page 219 and 220:
Cette répétition perturbe la lect
- Page 221 and 222:
Dans ces cas, l‘image a une fonct
- Page 223 and 224:
Les pages d‘accueil renferment pa
- Page 225 and 226:
Présentation de l’information R
- Page 227 and 228:
La terminologie informatique roumai
- Page 229 and 230:
Les extensions de sens que subissen
- Page 231 and 232:
appartiennent les notions qui subis
- Page 233 and 234:
informatique. Le dernier type est l
- Page 235 and 236:
que la formation de la terminologie
- Page 237 and 238:
informatique, on peut parler d‘un
- Page 239:
Trif, R.N. (2006) Influenţa limbii
- Page 242 and 243:
L‘interprétation simultanée sup
- Page 244 and 245:
L‘une des tâches les plus diffic
- Page 246 and 247:
manifestation […] sans oublier le
- Page 249:
Section 2 Aspects culturels et litt
- Page 252 and 253:
source-language into a target-langu
- Page 254 and 255:
coincide with an overt avowal of th
- Page 256 and 257:
în fundul văii Kamakura se distin
- Page 258 and 259:
endition of the original Japanese t
- Page 260 and 261:
the ―sound‖ of the mountain. Ra
- Page 262 and 263:
*** (1991) Le Robert. Dictionnaire
- Page 264 and 265:
poeta non fa che alimentare quella
- Page 266 and 267:
una dimensione più profonda e cari
- Page 268 and 269:
Qui est vivante, en sa rumeur. Imme
- Page 270 and 271:
Qui è da rintracciare, pertanto, i
- Page 272 and 273:
l‘effetto della fricativa sonora
- Page 274 and 275:
primi e Bonnefoy tra i secondi, tal
- Page 277 and 278:
Une expérience d’adaptation du m
- Page 279 and 280:
des formules tombées en désuétud
- Page 281 and 282:
est précisément appelé le conteu
- Page 283 and 284:
La jeune femme, se lamentant : Quel
- Page 285 and 286:
بْ بْ بْ ! ٍمغي تٍجؽ
- Page 287 and 288:
devenu dur comme du cuir ( ِذهج
- Page 289 and 290:
le processus créateur et nécessai
- Page 291 and 292:
L’enjeu de l’autotraduction ist
- Page 293 and 294:
ou le lexique français. En s`autot
- Page 295 and 296:
III. TRADUIRE ET S’AUTOTRADUIRE D
- Page 297 and 298:
de socialisation. Il regarde le mon
- Page 299 and 300:
favorable de la critique, l`intéri
- Page 301 and 302:
journal Facla. Celui-ci avait tradu
- Page 303 and 304:
dirigent vers la création d`un dis
- Page 305 and 306:
Langages révolutionnaires chez les
- Page 307 and 308:
l‘inadéquation de nouveaux cadre
- Page 309 and 310:
Relevons déjà quelques caractéri
- Page 311 and 312:
soumise à l‘aliénation 3 . Les
- Page 313 and 314:
formules les plus radicales que nou
- Page 315 and 316:
Parmi les citations puisées dans l
- Page 317 and 318:
anodin si l‘on parle, rétrospect
- Page 319:
Section 2 Pédagogie des langues
- Page 322 and 323:
qu‘enseignante responsable de leu
- Page 324 and 325:
canadiens et suisses, moins par des
- Page 326 and 327:
ilingue la personne qui se sert ré
- Page 328 and 329:
scolaire français à n‘ajouter q
- Page 330 and 331:
sanguin au cerveau, assurant ainsi
- Page 333 and 334:
An analysis of Spanish EFL learners
- Page 335 and 336:
has shown that there seem to exist
- Page 337 and 338:
2.3. Instrument The normative appro
- Page 339 and 340:
60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%
- Page 341 and 342:
After briefy analysing each stateme
- Page 343 and 344:
Difficoltà nell’interpretazione
- Page 345 and 346:
2.2. Nelle frasi subordinate, il co
- Page 347 and 348:
Dall‘altro canto, nelle subordina
- Page 349 and 350:
―După cum ai putut observa, mare
- Page 351 and 352:
Der Einsatz von Filmen im fachliche
- Page 353 and 354:
Berücksichtigung von kognitiven, e
- Page 355 and 356:
Solche Fragen könnten der Lehrpers
- Page 357 and 358:
zweiten Fall können mögliche Aufg
- Page 359 and 360:
Comptes rendus Kathryn Batchelor, Y
- Page 361 and 362:
Soulignant, à sa manière, le fait
- Page 363 and 364:
ignorés par les médias ; or le pr
- Page 365 and 366:
how interpreters are perceived and
- Page 367 and 368:
According to Springer, in order for