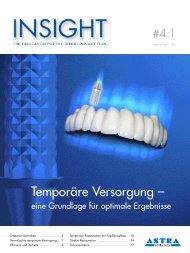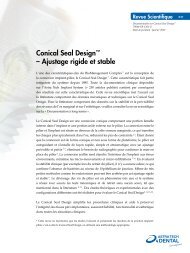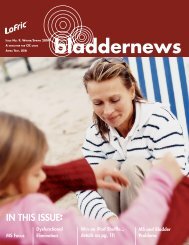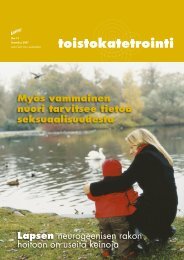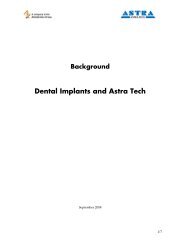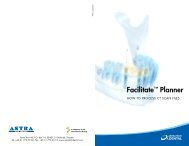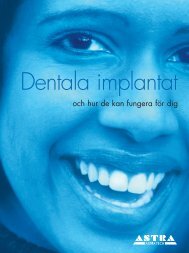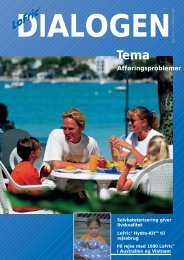MAGAZIN - Astra Tech
MAGAZIN - Astra Tech
MAGAZIN - Astra Tech
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DREI FRAGEN +1 AN …<br />
Herr Zipprich, welche Rolle spielen Verbindungen<br />
in Ihrem Fachgebiet, der zahnärztlichen<br />
Werkstoffkunde?<br />
Eine sehr große Rolle! In der mechanischen<br />
Verbindungstechnik allgemein, aber auch in<br />
der zahnärztlichen Werkstoffkunde unterscheiden<br />
wir zunächst zwischen unlösbaren<br />
und lösbaren Verbindungen. Unlösbare Verbindungen<br />
sind das Kleben, Zementieren,<br />
Verblenden, Löten oder Schweissen, lösbare<br />
Verbindungen das Verschrauben oder Verklemmen.<br />
Wenn Zahnsubstanz oder ganze Zähne ersetzt<br />
werden, ist – nach der Wahl des Materials<br />
– die Entscheidung für die Verbindungstechnik<br />
die wichtigste. Dabei ist es<br />
egal, ob es sich um unlösbare oder lösbare<br />
Verbindungen handelt: Die Eigenschaften<br />
der gesamten prothetischen Versorgung,<br />
also Festigkeit, Komfort oder Ästhetik, werden<br />
stark von der Ausführung an den Verbindungsstellen<br />
beeinflusst.<br />
Gibt es – in der Welt der Ingenieure, aber<br />
auch im Alltag – Verbindungen, die für eine<br />
bestimmte Aufgabe perfekt geeignet sind<br />
und damit alle anderen denkbaren Lösungen<br />
übertreffen?<br />
Selbstverständlich, und ich will Ihnen dazu<br />
einige Beispiele nennen. In der Bohr- und<br />
Frästechnik (Bilder S. 9) müssen hohe Drehmomente<br />
und hohe Axial- und Querkräfte<br />
spielfrei und selbstzentrierend übertragen<br />
werden – und das Ganze bei einfacher und<br />
Platz sparender Montage. Eine andere Lösung<br />
als eine konische Verbindung zwischen<br />
Maschine und Bohrer wäre, bei vergleichbarem<br />
Konstruktions- und Handhabungsaufwand,<br />
schwer vorstellbar.<br />
Für die Befestigungen von Flugzeugturbinen<br />
(Bild S. 8) gibt es ebenfalls nur ein wirklich<br />
brauchbares Lösungsprinzip – die konische<br />
Verbindung. Hier sind extrem hohe<br />
Dauerfestigkeiten bei häufigen Lastwechseln<br />
gefordert. Das wird oft mit nur drei<br />
konischen Verbindungen erreicht.<br />
Ein weiteres Beispiel, das jeder kennt: der<br />
Cocktail Shaker (Bild S. 9). Im Prinzip geht<br />
es hier darum, mit harten Werkstoffen eine<br />
Flüssigkeitsdichtigkeit ohne Verwendung<br />
von Dichtungen oder Dichtmaterialien zu<br />
erzeugen. Das ist technisch nicht einfacher<br />
zu gestalten, als mit einer konischen<br />
Formgebung der Einzelteile.<br />
Oder anders ausgedrückt:<br />
Es gibt für die<br />
„dichtungslose Dichtigkeit“<br />
keine bessere Lösung<br />
als die konische<br />
Verbindung. Stellen<br />
Sie sich nur einmal<br />
vor, der Barkeeper<br />
müsste vor dem<br />
Schütteln erst noch<br />
einen Dichtring zwischen<br />
die beiden Teile<br />
des Shakers einlegen!<br />
Wo sehen Sie weiteres Entwicklungspotenzial<br />
bei den implantologischen<br />
Werkstoffen? Kann<br />
die Zahnheilkunde hier von der Orthopädischen<br />
Chirurgie oder anderen operativen<br />
Fachgebieten der Medizin lernen?<br />
Würden wir bezüglich der Werkstoffe von<br />
der Orthopädie lernen beziehungsweise Parallelen<br />
ziehen, dann kämen statt Keramik-<br />
Implantaten überwiegend Implantate aus<br />
Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierungen zum<br />
Einsatz. Der gescheiterte Einsatz von keramischen<br />
Implantaten in der orthopädischen<br />
Implantologie basierte auf dem ungenügenden<br />
Implantat-Knochenverbund. Sobald<br />
neue <strong>Tech</strong>nologien eine verbesserte Oberflächengestaltung<br />
von Zirkonoxidimplantaten<br />
ermöglichen und für einen sichereren Implantat-Knochenverbund<br />
sorgen, werden<br />
keramische Implantate stark an Bedeutung<br />
gewinnen.<br />
Eine Verdrängung des Werkstoffs Titan aus<br />
der dentalen Implantologie ist meiner Meinung<br />
nach noch lange nicht in Sicht. Die<br />
<strong>Tech</strong>nologievielfalt bei der Gestaltung von<br />
Titanoberflächen ist auf keinem implantologischen<br />
Sektor größer als bei der dentalen<br />
Implantologie.<br />
Ihr aktueller Zahnstatus?<br />
Nun, ich müsste die Lücke 36 mit einem Implantat<br />
versorgen lassen. Glücklicherweise<br />
fällt mir die Entscheidung für das geeignete<br />
Implantatsystem sehr viel leichter als der<br />
letzte Autokauf.<br />
INTERVIEW<br />
Dipl.-Ing. Holger Zipprich<br />
11<br />
1968 in Darmstadt geboren,<br />
machte Holger Zipprich zunächst<br />
eine Lehre als Elektrogerätemechaniker.<br />
Danach studierte er<br />
Elektrotechnik (Grundstudium)<br />
und Elektromechanische Konstruktionen<br />
(Hauptstudium) an<br />
der TU Darmstadt.<br />
Nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter bei der<br />
Materialprüfanstalt in Darmstadt<br />
arbeitet Holger Zipprich seit 2001<br />
als Leiter der Sektion Werkstoffkunde<br />
in der Poliklinik Prothetik<br />
der Johann-Wolfgang-Goethe-<br />
Universität in Frankfurt am Main.<br />
Sein wissenschaftliches Interesse<br />
gilt besonders den „Versagensmodi<br />
von Implantat-Abutment-<br />
Verbindungen“.