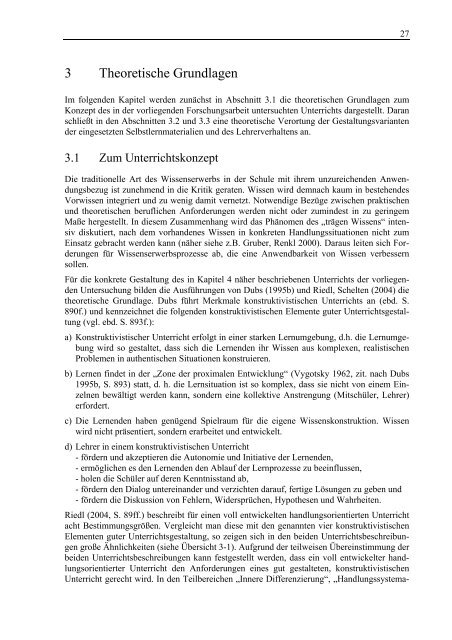Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 Theoretische Grundlagen<br />
Im folgenden Kapitel werden zunächst in Abschnitt 3.1 die theoretischen Grundlagen zum<br />
Konzept des in der vorliegenden Forschungsarbeit untersuchten Unterrichts dargestellt. Daran<br />
schließt in den Abschnitten 3.2 und 3.3 eine theoretische Verortung der Gestaltungsvarianten<br />
der eingesetzten Selbstlernmaterialien und des Lehrerverhaltens an.<br />
3.1 Zum Unterrichtskonzept<br />
Die traditionelle Art des Wissenserwerbs in der Schule mit ihrem unzureichenden Anwendungsbezug<br />
ist zunehmend in die Kritik geraten. Wissen wird demnach kaum in bestehendes<br />
Vorwissen integriert und zu wenig damit vernetzt. Notwendige Bezüge zwischen praktischen<br />
und theoretischen beruflichen Anforderungen werden nicht oder zumindest in zu geringem<br />
Maße hergestellt. In diesem Zusammenhang wird das Phänomen des „trägen Wissens“ intensiv<br />
diskutiert, nach dem vorhandenes Wissen in konkreten Handlungssituationen nicht zum<br />
Einsatz gebracht werden kann (näher siehe z.B. Gruber, Renkl 2000). Daraus leiten sich Forderungen<br />
<strong>für</strong> Wissenserwerbsprozesse ab, die eine Anwendbarkeit von Wissen verbessern<br />
sollen.<br />
Für die konkrete Gestaltung des in Kapitel 4 näher beschriebenen Unterrichts der vorliegenden<br />
Untersuchung bilden die Ausführungen von Dubs (1995b) und Riedl, Schelten (2004) die<br />
theoretische Grundlage. Dubs führt Merkmale konstruktivistischen Unterrichts an (ebd. S.<br />
890f.) und kennzeichnet die folgenden konstruktivistischen Elemente guter Unterrichtsgestaltung<br />
(vgl. ebd. S. 893f.):<br />
a) Konstruktivistischer Unterricht erfolgt in einer starken Lernumgebung, d.h. die Lernumgebung<br />
wird so gestaltet, dass sich die Lernenden ihr Wissen aus komplexen, realistischen<br />
Problemen in authentischen Situationen konstruieren.<br />
b) Lernen findet in der „Zone der proximalen Entwicklung“ (Vygotsky 1962, zit. nach Dubs<br />
1995b, S. 893) statt, d. h. die Lernsituation ist so komplex, dass sie nicht von einem Einzelnen<br />
bewältigt werden kann, sondern eine kollektive Anstrengung (Mitschüler, Lehrer)<br />
erfordert.<br />
c) Die Lernenden haben genügend Spielraum <strong>für</strong> die eigene Wissenskonstruktion. Wissen<br />
wird nicht präsentiert, sondern erarbeitet und entwickelt.<br />
d) Lehrer in einem konstruktivistischen Unterricht<br />
- fördern und akzeptieren die Autonomie und Initiative der Lernenden,<br />
- ermöglichen es den Lernenden den Ablauf der Lernprozesse zu beeinflussen,<br />
- holen die Schüler auf deren Kenntnisstand ab,<br />
- fördern den Dialog untereinander und verzichten darauf, fertige Lösungen zu geben und<br />
- fördern die Diskussion von Fehlern, Widersprüchen, Hypothesen und Wahrheiten.<br />
Riedl (2004, S. 89ff.) beschreibt <strong>für</strong> einen voll entwickelten handlungsorientierten Unterricht<br />
acht Bestimmungsgrößen. Vergleicht man diese mit den genannten vier konstruktivistischen<br />
Elementen guter Unterrichtsgestaltung, so zeigen sich in den beiden Unterrichtsbeschreibungen<br />
große Ähnlichkeiten (siehe Übersicht 3-1). Aufgrund der teilweisen Übereinstimmung der<br />
beiden Unterrichtsbeschreibungen kann festgestellt werden, dass ein voll entwickelter handlungsorientierter<br />
Unterricht den Anforderungen eines gut gestalteten, konstruktivistischen<br />
Unterricht gerecht wird. In den Teilbereichen „Innere Differenzierung“, „Handlungssystema-<br />
27