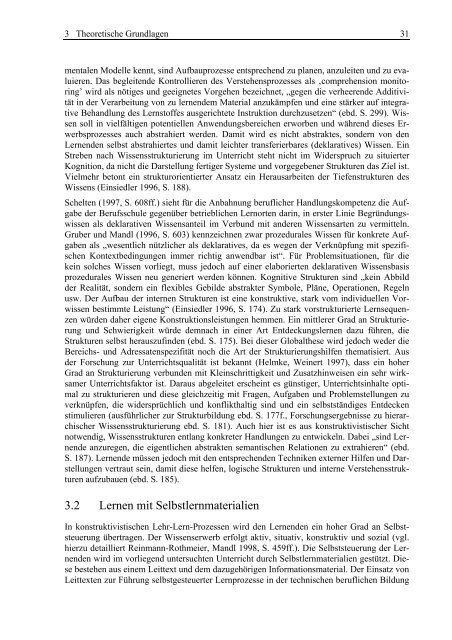Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Dr. Robert Geiger - Lehrstuhl für Pädagogik - TU München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 Theoretische Grundlagen 31<br />
mentalen Modelle kennt, sind Aufbauprozesse entsprechend zu planen, anzuleiten und zu evaluieren.<br />
Das begleitende Kontrollieren des Verstehensprozesses als ‚comprehension monitoring’<br />
wird als nötiges und geeignetes Vorgehen bezeichnet, „gegen die verheerende Additivität<br />
in der Verarbeitung von zu lernendem Material anzukämpfen und eine stärker auf integrative<br />
Behandlung des Lernstoffes ausgerichtete Instruktion durchzusetzen“ (ebd. S. 299). Wissen<br />
soll in vielfältigen potentiellen Anwendungsbereichen erworben und während dieses Erwerbsprozesses<br />
auch abstrahiert werden. Damit wird es nicht abstraktes, sondern von den<br />
Lernenden selbst abstrahiertes und damit leichter transferierbares (deklaratives) Wissen. Ein<br />
Streben nach Wissensstrukturierung im Unterricht steht nicht im Widerspruch zu situierter<br />
Kognition, da nicht die Darstellung fertiger Systeme und vorgegebener Strukturen das Ziel ist.<br />
Vielmehr betont ein strukturorientierter Ansatz ein Herausarbeiten der Tiefenstrukturen des<br />
Wissens (Einsiedler 1996, S. 188).<br />
Schelten (1997, S. 608ff.) sieht <strong>für</strong> die Anbahnung beruflicher Handlungskompetenz die Aufgabe<br />
der Berufsschule gegenüber betrieblichen Lernorten darin, in erster Linie Begründungswissen<br />
als deklarativen Wissensanteil im Verbund mit anderen Wissensarten zu vermitteln.<br />
Gruber und Mandl (1996, S. 603) kennzeichnen zwar prozedurales Wissen <strong>für</strong> konkrete Aufgaben<br />
als „wesentlich nützlicher als deklaratives, da es wegen der Verknüpfung mit spezifischen<br />
Kontextbedingungen immer richtig anwendbar ist“. Für Problemsituationen, <strong>für</strong> die<br />
kein solches Wissen vorliegt, muss jedoch auf einer elaborierten deklarativen Wissensbasis<br />
prozedurales Wissen neu generiert werden können. Kognitive Strukturen sind „kein Abbild<br />
der Realität, sondern ein flexibles Gebilde abstrakter Symbole, Pläne, Operationen, Regeln<br />
usw. Der Aufbau der internen Strukturen ist eine konstruktive, stark vom individuellen Vorwissen<br />
bestimmte Leistung“ (Einsiedler 1996, S. 174). Zu stark vorstrukturierte Lernsequenzen<br />
würden daher eigene Konstruktionsleistungen hemmen. Ein mittlerer Grad an Strukturierung<br />
und Schwierigkeit würde demnach in einer Art Entdeckungslernen dazu führen, die<br />
Strukturen selbst herauszufinden (ebd. S. 175). Bei dieser Globalthese wird jedoch weder die<br />
Bereichs- und Adressatenspezifität noch die Art der Strukturierungshilfen thematisiert. Aus<br />
der Forschung zur Unterrichtsqualität ist bekannt (Helmke, Weinert 1997), dass ein hoher<br />
Grad an Strukturierung verbunden mit Kleinschrittigkeit und Zusatzhinweisen ein sehr wirksamer<br />
Unterrichtsfaktor ist. Daraus abgeleitet erscheint es günstiger, Unterrichtsinhalte optimal<br />
zu strukturieren und diese gleichzeitig mit Fragen, Aufgaben und Problemstellungen zu<br />
verknüpfen, die widersprüchlich und konflikthaltig sind und ein selbstständiges Entdecken<br />
stimulieren (ausführlicher zur Strukturbildung ebd. S. 177f., Forschungsergebnisse zu hierarchischer<br />
Wissensstrukturierung ebd. S. 181). Auch hier ist es aus konstruktivistischer Sicht<br />
notwendig, Wissensstrukturen entlang konkreter Handlungen zu entwickeln. Dabei „sind Lernende<br />
anzuregen, die eigentlichen abstrakten semantischen Relationen zu extrahieren“ (ebd.<br />
S. 187). Lernende müssen jedoch mit den entsprechenden Techniken externer Hilfen und Darstellungen<br />
vertraut sein, damit diese helfen, logische Strukturen und interne Verstehensstrukturen<br />
aufzubauen (ebd. S. 185).<br />
3.2 Lernen mit Selbstlernmaterialien<br />
In konstruktivistischen Lehr-Lern-Prozessen wird den Lernenden ein hoher Grad an Selbststeuerung<br />
übertragen. Der Wissenserwerb erfolgt aktiv, situativ, konstruktiv und sozial (vgl.<br />
hierzu detailliert Reinmann-Rothmeier, Mandl 1998, S. 459ff.). Die Selbststeuerung der Lernenden<br />
wird im vorliegend untersuchten Unterricht durch Selbstlernmaterialien gestützt. Diese<br />
bestehen aus einem Leittext und dem dazugehörigen Informationsmaterial. Der Einsatz von<br />
Leittexten zur Führung selbstgesteuerter Lernprozesse in der technischen beruflichen Bildung