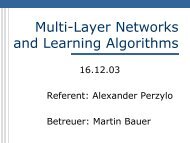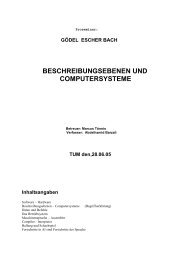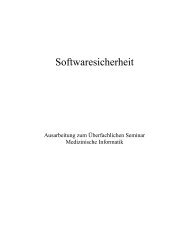Evaluierung von Usability durch standardisierte qualitative ...
Evaluierung von Usability durch standardisierte qualitative ...
Evaluierung von Usability durch standardisierte qualitative ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.3 Leitfadeninterviews<br />
mehrere Fragen aneinandergereiht werden. Gegen multiple Fragen spricht nach Gläser und<br />
Laudel [14, S. 142], dass erstens der Befragte verunsichert wird und Stress empfindet, dass<br />
zweitens, der Interviewer die Kontrolle über das Interview verliert, und drittens, dass die<br />
Antworten in verschiedene Richtungen gehen können.<br />
Durch offene Fragen wird versucht das Wissen des Interviewpartners und die Bedeutungen,<br />
die er diesem Wissen gibt, im Interview zu erfassen.<br />
„Maximale Offenheit bedeutet, dass die Frage so wenig Einfluss wie möglich<br />
auf den Inhalt der Antwort ausübt. Offene Fragen überlassen dem Gesprächspartner<br />
die Entscheidung über den Inhalt der Antwort. Das Ausmaß, in dem<br />
sie das tun, hängt <strong>von</strong> der Formulierung der Frage ab. Es gibt nicht schlechthin<br />
offene Fragen, sondern einen Grad an Offenheit, den wir jeweils mit der<br />
Formulierung festlegen.“ [14, S. 131]<br />
Nach Gläser und Laudel [14, S. 131] wird eine Frage um so ungenauer, je offener sie formuliert<br />
ist. Mit der Offenheit der Frage steigt die Gefahr, dass der Interviewpartner verunsichert<br />
wird, weil er nicht weiß, worauf eine Antwort erwartet wird. Aus einer Fehlinterpretation<br />
seitens des Befragten kann eine irrelevante Antwort resultieren. Außerdem<br />
kann eine sehr offen gestellte Frage bewirken, dass der Befragte den Eindruck bekommt,<br />
der Interviewer sei inkompetent.<br />
Zur Erhöhung der Spezifität der Antworten empfehlen Merton und Kendall [41] eine Technik<br />
namens Retrospektive Introspektion. Dabei wird Material zur Vergegenwärtigung einer<br />
bestimmten Situation, wie beispielsweise ein Bild, gezeigt, und entsprechende Fragen gestellt:<br />
„Wenn Sie zurückdenken, was war Ihre Reaktion . . . ?“ Außerdem unterscheiden<br />
sie Fragen im Hinblick auf ihren Strukturierungsgrad: Bei strukturierten Fragen werden<br />
sowohl Stimulus (Bezugspunkt), als auch Reaktion festgelegt, bei halbstrukturierten eines<br />
<strong>von</strong> beiden und bei unstrukturierten keines <strong>von</strong> beiden. Hier jeweils ein Beispiel 1 :<br />
• Unstrukturiert: „Was für einen Eindruck haben Sie <strong>von</strong> der Software?“<br />
• Halbstrukturiert: „Was war für Sie an der Software neu?“<br />
• Halbstrukturiert: „Wie finden Sie die interne Hilfefunktion der Software?“<br />
• Strukuriert: „Wie nützlich finden Sie die Hilfefunktion?“<br />
Die informelle Kommunikation im Alltag ist nicht <strong>durch</strong> offene Fragen, sondern <strong>durch</strong><br />
dichotome Fragen geprägt, die eine Ja/Nein-Antwort nahe legen. Gläser und Laudel [14,<br />
S. 132] warnen, dass dichotome Fragen leicht zu Suggestivfragen werden können und in<br />
Form einer Kettenreaktion zu weiteren dichotomen, sehr spezifischen Fragen führen können,<br />
die den Befragten in seiner Antwort stark beeinflussen. Ein deutlicher Hinweis darauf<br />
sei es, wenn der Interviewer mehr redet als der Befragte. Selbst eine an sich neutral formulierte<br />
Frage kann <strong>durch</strong> eine bestimmte Betonung auch suggestiv wirken.<br />
Eine dichotome Frage kann als Filterfrage dienen, deren Antwort darüber entscheidet, ob<br />
oder welche offene Frage folgt. Alternativ kann man auch eine unterstellende Frage verwenden.<br />
Eine solche Frage geht da<strong>von</strong> aus, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sind<br />
sie es nicht, so wirkt eine unterstellende Frage provozierend, ihr wird widersprochen.<br />
Man unterscheidet zwischen Fakt- und Meinungsfragen. Letztere dienen dazu persönliche<br />
Bewertungen, Handlungsziele und Motive zu ermitteln. Zu den Faktfragen zählen neben<br />
reinen Wissensfragen Hintergrundfragen, mit denen demographische Daten erfasst werden.<br />
Außerdem zählen Fragen nach den Erfahrungen des Interviewten zu den Faktfragen.<br />
1 In Anlehnung an die Beispiele in [41]<br />
8