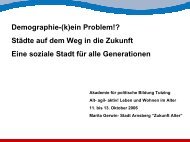Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forum <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong>:<br />
In der Verschiedenheit die Normalität entdecken<br />
Ansätze <strong>für</strong> politische <strong>Bildung</strong> und Pädagogik<br />
in der Einwanderungsgesellschaft<br />
Die Fernsehbilder von brennenden Autos und Gebäuden in französischen<br />
Vorstädten haben auch hierzulande die Frage nach der geglückten<br />
oder missglückten Integration von Migranten wieder „brennend“<br />
aktuell werden lassen. Und der Konflikt um die „Karikierbarkeit“<br />
des Propheten Mohammed führte zu hitzigen Debatten und<br />
gewaltsamen Auseinandersetzungen in Teilen der islamischen Welt.<br />
Ist unser Einwanderungsland vor solchen Exzessen der Gewalt gefeit?<br />
Droht jetzt der „Kampf der Kulturen“, wie ihn Samuel Huntington<br />
schon vor Jahren prophezeite? Entwickeln sich auch in<br />
Deutschland Parallelgesellschaften am Rande oder außerhalb unserer<br />
Werte und Normen? Entsteht ein soziales Pulverfass, dessen<br />
brisante Mischung aus <strong>Bildung</strong>snotstand, Armut und Kriminalität<br />
nur einen Funken braucht zur Explosion?<br />
Im Rahmen unseres „Forums <strong>Politische</strong><br />
<strong>Bildung</strong>“ fragten wir nach<br />
den Möglichkeiten, Chancen und<br />
Grenzen politischer <strong>Bildung</strong>sarbeit mit<br />
und <strong>für</strong> Migranten. Mit welchen Themen<br />
und Methoden kann politische<br />
<strong>Bildung</strong> einen Beitrag zur Integration<br />
leisten? Veronika Fischer, Professorin<br />
an der FH Düsseldorf, hat sich als Erziehungswissenschaftlerin<br />
seit langem<br />
mit dem interkulturellen Dialog beschäftigt.<br />
Sie betonte, es sei wichtig,<br />
sich im interkulturellen Dialog immer<br />
auf eine individuelle Beziehung einzulassen,<br />
den anderen Menschen zu akzeptieren,<br />
offen <strong>für</strong> sein Anderssein zu<br />
sein: „Dialoge nivellieren keine Unterschiede,<br />
sondern lassen ihr unterschiedliches<br />
Profil offen zu Tage treten.“<br />
Sie sind ergebnisoffen und prozesshaft,<br />
weil sich erst im Zuge des<br />
wechselseitigen Austauschens Resultate<br />
und Lösungen herauskristallisieren<br />
lassen.<br />
Fischer beschrieb Voraussetzungen <strong>für</strong><br />
das Gelingen politischer <strong>Bildung</strong> im<br />
Dialog:<br />
• einfühlsames Verstehen<br />
• das Aushalten von Enttäuschungen<br />
• die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel<br />
• das Aushalten von Meinungen,<br />
die den eigenen widersprechen und<br />
• kommunikative Kompetenz und<br />
Respekt.<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 2/2006<br />
Fischer forderte eine selbstreflexive<br />
Haltung, die die ethnozentrischen Haltungen<br />
und Selbstgewissheiten hinterfragt,<br />
die das Eigene zum Maßstab <strong>für</strong><br />
Veronika Fischer: „Einforderung<br />
gleicher Rechte setzt einen Wertekonsens<br />
voraus.“<br />
Fotos: Schröder<br />
die so genannte Normalität werden ließen:<br />
„Es gilt eine Haltung zu entwickeln,<br />
die in der Heterogenität der Lebensentwürfe<br />
die Normalität entdeckt.“<br />
<strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> müsse Vorurteile<br />
bearbeiten und Fremdenfeindlichkeit<br />
sowie Rassismus vorbeugen.<br />
Konkret nannte sie Programme, die<br />
sich als Erinnerungskultur mit Rassismus,<br />
Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-<br />
tismus und anderen Formen von Menschenrechtsverletzungen<br />
beschäftigen,<br />
und darüber hinaus Konzepte, die sich<br />
mit gegenwärtigen Tendenzen einer<br />
„gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“<br />
auseinandersetzen. Auch eine<br />
interkulturelle Konfliktmediation, die<br />
Regeln und Strategien anbietet, wie auf<br />
friedliche Weise ein Streit beizulegen<br />
ist, der Menschen einer anderen Ethnie<br />
herabwürdigt, habe hier ihren Platz.<br />
Wichtig sei eine Pädagogik der Anerkennung,<br />
die den interkulturellen Dialog<br />
pflegt und politische Tugenden<br />
vermittelt, die Sensibilität gegenüber<br />
Diskriminierung, Respekt und Akzeptanz<br />
beinhalten.<br />
Migration und<br />
Globalisierung<br />
Die vorhandenen Asymmetrien in der<br />
Gesellschaft hat eine politische <strong>Bildung</strong><br />
im interkulturellen Dialog aufzugreifen.<br />
Sie thematisiert zum Beispiel<br />
Migration als ein Phänomen von Globalisierung<br />
und impliziert daher globales<br />
Lernen. Sie hat darüber hinaus<br />
Einsicht in die bestehenden Machtund<br />
Herrschaftsstrukturen zu vermitteln,<br />
die in der Beziehung zwischen<br />
Majorität und den Minoritäten bestehen.<br />
Das Lernziel laute: solidarisch <strong>für</strong><br />
die gesellschaftlich Benachteiligten<br />
einzutreten und gleiche Rechte <strong>für</strong> sie<br />
einzufordern.<br />
Allerdings setze die Einforderung gleicher<br />
Rechte einen Wertekonsens voraus.<br />
Fischer schlug vor, die Menschenrechte<br />
als Basis zu nehmen, weil sie<br />
universelle Geltung besitzen und zunehmend<br />
Anerkennung im internationalen<br />
Rahmen finden. Sie favorisiert<br />
„<strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> als Menschenrechtsbildung“.<br />
Am Ende stehe eine<br />
von allen akzeptierte Gesellschaft, in<br />
der die Differenz zur Normalität werde.<br />
Die Referentin sieht aber auch die<br />
Grenzen des interkulturellen Dialogs<br />
und damit der Chancen von politischer<br />
�<br />
19