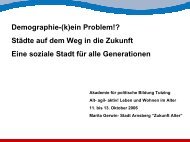Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der PISA-Schock sitzt den<br />
<strong>Bildung</strong>spolitikern noch<br />
immer tief in den Knochen.<br />
Seit im Dezember 2001<br />
zum ersten Mal die schlechten<br />
Noten <strong>für</strong> Deutschlands Schulwesen<br />
bekannt wurden, steht<br />
das gesamte System auf dem<br />
Prüfstand. Die Hiobs-Botschaften<br />
neuerer Studien reißen nicht<br />
ab: So wirft die OECD deutschen<br />
Lehrern vor, sie seien<br />
überaltert, schlecht ausgebildet,<br />
häufig überfordert und ausgebrannt.<br />
Laut neuester PISA-Stu-<br />
Der deutsche PISA-Koordinator Manfred<br />
Prenzel von der Universität Kiel<br />
rief die zentralen Ergebnisse der ersten<br />
beiden Studien in Erinnerung: Die<br />
Leistungen der Schüler aus Deutschland<br />
lagen 2003 in Mathematik, Lesen<br />
und Problemlösung im internationalen<br />
OECD-Durchschnitt. Die Befunde <strong>für</strong><br />
Deutschland lassen relative Stärken<br />
und Schwächen der mathematischen<br />
Kompetenz erkennen. Zwischen den<br />
Bundesländern gibt es einen Abstand<br />
von 60 Punkten zwischen dem Schlusslicht<br />
Bremen und dem Spitzenreiter<br />
Bayern. Das entspricht 18 Monaten<br />
Schulzeit. Prenzel sagte, es gäbe ausgeprägte<br />
Schwächen und zu wenig entwickelte<br />
Stärken: „Aber es ist vom Jahr<br />
2000 bis zum Jahr 2003 in Mathematik<br />
und Naturwissenschaften besser<br />
geworden.“ Die Zuwächse seien statistisch<br />
und praktisch bedeutsam. Ein<br />
hoher Anteil an Gymnasiasten sichere<br />
noch keine mathematische Kompetenz:<br />
Bayern hat einen relativ geringen<br />
Anteil (26,5 Prozent), aber die höchste<br />
Kompetenz; dagegen findet man die<br />
niedrigste Kompetenz in Bremen, Berlin<br />
und Hamburg mit jeweils 31, 34<br />
bzw. 33 Prozent Gymnasiastenanteil<br />
eines Jahrgangs.<br />
Bei der Lesekompetenz sind dagegen<br />
recht wenige Fortschritte gemacht<br />
worden zwischen den beiden Studien;<br />
auch nicht an den Gymnasien.<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 2/2006<br />
Schulpolitik: mangelhaft?<br />
Lernen aus dem PISA-Schock<br />
die haben Kinder aus sozial benachteiligten<br />
Schichten deutlich<br />
geringere Chancen auf eine gute<br />
Schulbildung. Die Förderung<br />
und Differenzierung benachteiligter<br />
Schüler ist unzureichend.<br />
In Deutschland wird deutlich<br />
weniger Geld <strong>für</strong> <strong>Bildung</strong> ausgegeben<br />
als in vergleichbaren Industrieländern<br />
und gerade in die<br />
Schularten mit den größten Problemen<br />
wird zu wenig investiert.<br />
Schüler in Deutschland erhalten<br />
deutlich weniger Unterricht und<br />
Deutschland erreicht 491 Punkte, den<br />
Spitzenplatz hält Finnland mit 543<br />
Punkten. Deutsche Jungen seien besonders<br />
schlecht. Nur im Problemlösen<br />
liegen deutsche Schüler mit 13<br />
Punkten signifikant über dem Durchschnitt.<br />
Risikogruppen<br />
In Mathematik sind 21,6 Prozent der<br />
15-jährigen Schülerinnen und Schüler<br />
in Deutschland in den beiden untersten<br />
Kompetenzstufen und stellen damit<br />
eine Risikogruppe dar, mit schlechten<br />
Aussichten <strong>für</strong> die weitere Schullaufbahn<br />
und berufliche Ausbildung.<br />
Im Bereich Lesen sind sogar 22,3 Prozent<br />
in dieser Risikogruppe. Hier ticke<br />
eine soziale Zeitbombe, denn „das<br />
beste Mittel gegen sozialen Abstieg<br />
sind kleine Anteile schwacher Schüler“,<br />
so Prenzel.<br />
Der internationale Vergleich zeigt interessante<br />
Beispiele: Es gibt nur eine<br />
schwache Kopplung zwischen Herkunft<br />
und Kompetenz, wenn im unteren<br />
Leistungsbereich konsequent gefördert<br />
wird.<br />
Der Zusammenhang zwischen der sozialen<br />
Herkunft und der schulischen<br />
Kompetenz ist in Deutschland relativ<br />
eng. Die Chancen ein Gymnasium zu<br />
besuchen, sind <strong>für</strong> die verschiedenen<br />
sozialen Schichten ungleich verteilt.<br />
Dem Erlernen der deutschen Sprache<br />
die Klassen sind größer als in den<br />
meisten anderen Industrienationen.<br />
Unsere Fachtagung „Schulpolitik:<br />
mangelhaft?“ unter Leitung<br />
von Heinrich Oberreuter und<br />
Michael Schröder versammelte<br />
namhafte Experten aus Wissenschaft,<br />
Politik und Schulpraxis.<br />
Die sehr große Teilnehmerzahl<br />
bewies, dass mit dem Thema offenkundig<br />
der Nerv der aktuellen<br />
Debatten rund um die Schule<br />
getroffen wurde.<br />
Manfred Prenzel beobachtet ausgeprägte<br />
Schwächen und zu wenig<br />
entwickelte Stärken bei deutschen<br />
Schülern.<br />
weist Prenzel eine Schlüsselrolle zu:<br />
die Schulleistung ist eindeutig abhängig<br />
vom Beherrschen der deutschen<br />
Sprache. Er sieht die zentrale Herausforderung<br />
darin, den derzeitigen hohen<br />
Anteil von Schülern mit einer Risikoprognose<br />
deutlich zu verringern. Eine<br />
entsprechende Förderung dürfe jedoch<br />
nicht zu Lasten weiterer Bemühungen<br />
um die oberen Leistungsstufen liegen.<br />
Die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund<br />
muss keineswegs<br />
mit Leistungseinbußen erkauft werden,<br />
wie der internationale Vergleich zeigt.<br />
�<br />
9