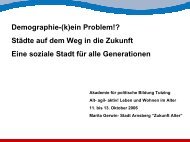Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Akademiereport 2-06.pmd - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussionen um die Menschenwürdegarantie<br />
des Artikel 1 des Grundgesetzes.<br />
Die „rhetorische Expansion des<br />
Begriffs bei dessen gleichzeitiger Entleerung“<br />
sei eine wesentliche Signatur<br />
unserer Zeit. Ob Hartz IV, rechtliche<br />
Begrenzungen der Gentechnologie<br />
oder die Einschränkung der betrieblichen<br />
Mitbestimmung: All zu schnell<br />
werde auf die Unantastbarkeit der<br />
Menschenwürde verwiesen. In der bioethischen<br />
Diskussion habe sich zwischen<br />
den „doppelten Konnex von<br />
Mensch und Würde und von Würde<br />
und Unversehrtheit“ die „Person“ geschoben.<br />
Zwar besitze jeder Mensch<br />
Würde, doch nur wer Mensch und Person<br />
sei, könne körperliche Unversehrtheit<br />
beanspruchen. An Stelle des umfassenden<br />
Würdekonzeptes tritt eine<br />
Menschenwürde, die an bestimmte Voraussetzungen<br />
und Interessen gebunden<br />
ist. Diese Vorstellung wird seit einiger<br />
Zeit auch in einem namhaften<br />
juristischen Kommentar geäußert.<br />
Kissler hob in diesem Zusammenhang<br />
die Bedeutung der Gerichte hervor,<br />
und fragte nach der Grundlage, auf<br />
welcher eine mögliche Abwägung vorgenommen<br />
werden soll.<br />
Der herrschende Begriff der Selbstbestimmung<br />
drohe in einen leitenden<br />
Grundsatz umzuschlagen: „Die Hypostasierung<br />
der Selbstbestimmung ist<br />
das verbindende Glied in den Debatten<br />
um Embryonenforschung, Sterbe-<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 2/2006<br />
hilfe, Menschenwürde, Vaterschaft und<br />
Willensfreiheit.“<br />
Quellen unserer Werte<br />
Geht man einen Schritt hinter den<br />
Wandel der Werte zurück, so stellt sich<br />
zunächst die Frage, woraus wir unsere<br />
Werte schöpfen – sofern es denn gemeinsame<br />
Werte gibt?<br />
Nach Dietmar Mieth, Tübinger Moraltheologe<br />
und Bioethiker, besteht die<br />
Gefahr, dass das Selbstverständnis der<br />
Religion durch die Wissenschaft und<br />
deren normative Kraft des Fiktiven<br />
ersetzt werden. Der wissenschaftlichtechnische<br />
Fortschritt sei Teil unserer<br />
Identität geworden und habe säkularreligiöse<br />
Züge angenommen. Das Sitt-<br />
Der Kulturjournalist Alexander Kissler (links) im Gespräch mit Hans Maier<br />
über Religion als politische Entscheidungshilfe. Fotos: Wolf<br />
liche werde gegenüber dieser Quasi-<br />
Religion und ihrer wertbildenden Kraft<br />
kleingeschrieben. Zwar gebe es Wertkonflikte<br />
mit und ohne Religion. Doch<br />
bestimmte Erfahrungen, so Mieth, könne<br />
nur die Religion bieten. Die Kontingenzerfahrung<br />
(Endlichkeit, Abhängigkeit,<br />
Fehlerfähigkeit etc.), die Erfahrung<br />
als Assistenten der Schöpfung,<br />
die Verortung Gottes in jedem Menschen,<br />
die Erfahrung von Caritas und<br />
Kompassion, sowie die Ununterschiedenheit<br />
des Religiösen vom Ethischen<br />
zählt Mieth dazu. Für ihn sind das Sittliche<br />
und das Religiöse keine alternativen,<br />
sondern reziproke Quellen unserer<br />
Werte.<br />
Diese Auffassung des Verhältnisses<br />
von Religiösem und Sittlichem scheint<br />
auch dem ehemaligen bayerischen<br />
Kultusminister Hans Maier, der von<br />
Alexander Kissler zur Rolle des Glaubens<br />
als politische Entscheidungshilfe<br />
befragt wurde, nicht fern zu liegen.<br />
Glauben als politische<br />
Entscheidungshilfe<br />
Auch wenn sich die kirchenförmige<br />
Religion auf niedrigem Niveau stabilisiere,<br />
hält Maier den christlichen<br />
Hintergrund der deutschen Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> breit genug, dass sich auch<br />
christliche Begründungen in der Politik<br />
verstehen lassen. Gleichwohl würde<br />
er es erwartungsgemäß begrüßen,<br />
wenn die christlichen Parteien ihre<br />
Basis wieder stärker offen legten und<br />
Hintergrundüberzeugungen von Politikern<br />
deutlich werden. Persönlich<br />
hält es Maier mit dem Heiligen Benedikt,<br />
der lehre, zunächst schweigend<br />
zuzuhören, dann zu beten und zu arbeiten.<br />
Dies könne er übrigens auch<br />
dem amerikanischen Präsidenten empfehlen,<br />
ergänzte Maier augenzwinkernd.<br />
Das Selbstverständnis der Kirchen als<br />
politische und gesellschaftliche Akteure<br />
beschrieb neben Kirchenrat Dieter<br />
Breit <strong>für</strong> die evangelische Kirche<br />
in Bayern auch der Präsident des Zentralkomitees<br />
der deutschen Katholiken<br />
(ZdK), Hans Joachim Meyer.<br />
Durch ihre Präsenz in der Gesellschaft<br />
ist <strong>für</strong> Meyer Kirche selbstverständlich<br />
auch gesellschaftlicher Akteur.<br />
Ob der christliche Glaube jedoch in<br />
einer Gesellschaft auch als eine Quelle<br />
von Antworten und Impulsen <strong>für</strong><br />
Gegenwart und Zukunft gilt, hänge<br />
nicht nur von dem Maß ab, in dem es<br />
der Kirche gelingt, sich in ihrer Verkündigung<br />
und Lebenspraxis der Gesellschaft<br />
zuzuwenden, sondern auch<br />
von den in einer Gesellschaft vorherrschenden<br />
Haltungen gegenüber Kirche<br />
und Glauben.<br />
Anhand ausgewählter Stationen zeichnete<br />
Meyer den Weg der deutschen<br />
Katholiken und ihrer Kirche in die<br />
freiheitliche Gesellschaft der Gegenwart<br />
nach. Heute zwingen die aktuellen<br />
Entwicklungen auch die Laienkatholiken<br />
zu „neuen oder neu zu be-<br />
�<br />
27