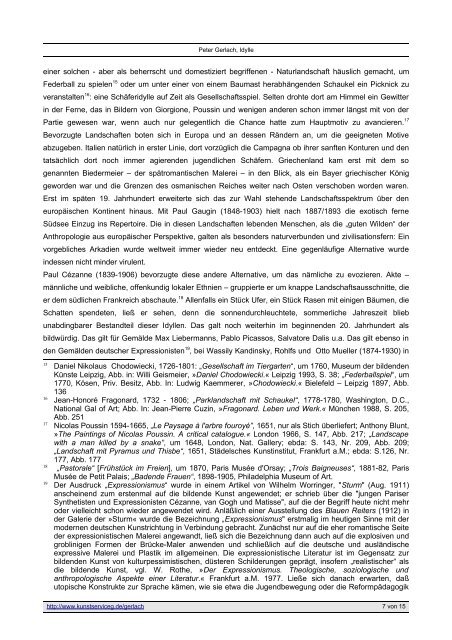Herunterladen als PDF
Herunterladen als PDF
Herunterladen als PDF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Peter Gerlach, Idylle<br />
einer solchen - aber <strong>als</strong> beherrscht und domestiziert begriffenen - Naturlandschaft häuslich gemacht, um<br />
Federball zu spielen 15 oder um unter einer von einem Baumast herabhängenden Schaukel ein Picknick zu<br />
veranstalten 16 : eine Schäferidylle auf Zeit <strong>als</strong> Gesellschaftsspiel. Selten drohte dort am Himmel ein Gewitter<br />
in der Ferne, das in Bildern von Giorgione, Poussin und wenigen anderen schon immer längst mit von der<br />
Partie gewesen war, wenn auch nur gelegentlich die Chance hatte zum Hauptmotiv zu avancieren. 17<br />
Bevorzugte Landschaften boten sich in Europa und an dessen Rändern an, um die geeigneten Motive<br />
abzugeben. Italien natürlich in erster Linie, dort vorzüglich die Campagna ob ihrer sanften Konturen und den<br />
tatsächlich dort noch immer agierenden jugendlichen Schäfern. Griechenland kam erst mit dem so<br />
genannten Biedermeier – der spätromantischen Malerei – in den Blick, <strong>als</strong> ein Bayer griechischer König<br />
geworden war und die Grenzen des osmanischen Reiches weiter nach Osten verschoben worden waren.<br />
Erst im späten 19. Jahrhundert erweiterte sich das zur Wahl stehende Landschaftsspektrum über den<br />
europäischen Kontinent hinaus. Mit Paul Gaugin (1848-1903) hielt nach 1887/1893 die exotisch ferne<br />
Südsee Einzug ins Repertoire. Die in diesen Landschaften lebenden Menschen, <strong>als</strong> die „guten Wilden“ der<br />
Anthropologie aus europäischer Perspektive, galten <strong>als</strong> besonders naturverbunden und zivilisationsfern: Ein<br />
vorgebliches Arkadien wurde weltweit immer wieder neu entdeckt. Eine gegenläufige Alternative wurde<br />
indessen nicht minder virulent.<br />
Paul Cézanne (1839-1906) bevorzugte diese andere Alternative, um das nämliche zu evozieren. Akte –<br />
männliche und weibliche, offenkundig lokaler Ethnien – gruppierte er um knappe Landschaftsausschnitte, die<br />
er dem südlichen Frankreich abschaute. 18 Allenfalls ein Stück Ufer, ein Stück Rasen mit einigen Bäumen, die<br />
Schatten spendeten, ließ er sehen, denn die sonnendurchleuchtete, sommerliche Jahreszeit blieb<br />
unabdingbarer Bestandteil dieser Idyllen. Das galt noch weiterhin im beginnenden 20. Jahrhundert <strong>als</strong><br />
bildwürdig. Das gilt für Gemälde Max Liebermanns, Pablo Picassos, Salvatore Dalis u.a. Das gilt ebenso in<br />
den Gemälden deutscher Expressionisten 19 , bei Wassily Kandinsky, Rohlfs und Otto Mueller (1874-1930) in<br />
15 Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1726-1801: „Gesellschaft im Tiergarten“, um 1760, Museum der bildenden<br />
Künste Leipzig, Abb. in: Willi Geismeier, »Daniel Chodowiecki.« Leipzig 1993, S. 38; „Federballspiel“, um<br />
1770, Kösen, Priv. Besitz, Abb. In: Ludwig Kaemmerer, »Chodowiecki.« Bielefeld – Leipzig 1897, Abb.<br />
136<br />
16 Jean-Honoré Fragonard, 1732 - 1806; „Parklandschaft mit Schaukel“, 1778-1780, Washington, D.C.,<br />
National Gal of Art; Abb. In: Jean-Pierre Cuzin, »Fragonard. Leben und Werk.« München 1988, S. 205,<br />
Abb. 251<br />
17 Nicolas Poussin 1594-1665, „Le Paysage à l'arbre fouroyé”, 1651, nur <strong>als</strong> Stich überliefert; Anthony Blunt,<br />
»The Paintings of Nicolas Poussin. A critical catalogue.« London 1966, S. 147, Abb. 217; „Landscape<br />
with a man killed by a snake”, um 1648, London, Nat. Gallery; ebda: S. 143, Nr. 209, Abb. 209;<br />
„Landschaft mit Pyramus und Thisbe“, 1651, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt a.M.; ebda: S.126, Nr.<br />
177, Abb. 177<br />
18 „Pastorale“ [Frühstück im Freien], um 1870, Paris Musée d'Orsay; „Trois Baigneuses“, 1881-82, Paris<br />
Musée de Petit Palais; „Badende Frauen“, 1898-1905, Philadelphia Museum of Art.<br />
19 Der Ausdruck „Expressionismus“ wurde in einem Artikel von Wilhelm Worringer, "Sturm" (Aug. 1911)<br />
anscheinend zum erstenmal auf die bildende Kunst angewendet; er schrieb über die "jungen Pariser<br />
Synthetisten und Expressionisten Cézanne, van Gogh und Matisse", auf die der Begriff heute nicht mehr<br />
oder vielleicht schon wieder angewendet wird. Anläßlich einer Ausstellung des Blauen Reiters (1912) in<br />
der Galerie der »Sturm« wurde die Bezeichnung „Expressionismus" erstmalig im heutigen Sinne mit der<br />
modernen deutschen Kunstrichtung in Verbindung gebracht. Zunächst nur auf die eher romantische Seite<br />
der expressionistischen Malerei angewandt, ließ sich die Bezeichnung dann auch auf die explosiven und<br />
groblinigen Formen der Brücke-Maler anwenden und schließlich auf die deutsche und ausländische<br />
expressive Malerei und Plastik im allgemeinen. Die expressionistische Literatur ist im Gegensatz zur<br />
bildenden Kunst von kulturpessimistischen, düsteren Schilderungen geprägt, insofern „realistischer“ <strong>als</strong><br />
die bildende Kunst, vgl. W. Rothe, »Der Expressionismus. Theologische, soziologische und<br />
anthropologische Aspekte einer Literatur.« Frankfurt a.M. 1977. Ließe sich danach erwarten, daß<br />
utopische Konstrukte zur Sprache kämen, wie sie etwa die Jugendbewegung oder die Reformpädagogik<br />
http://www.kunstserviceg.de/gerlach 7 von 15