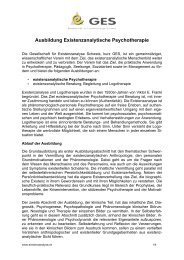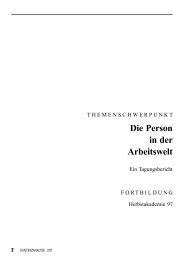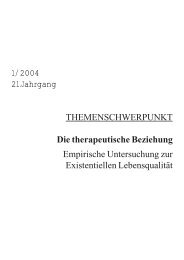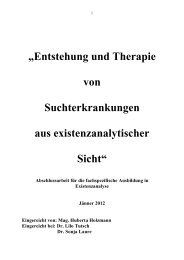PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zu verstehenden] Eidos' (Heidegger 1987, S. 126). Die damit von Heidegger geforderte<br />
'Umstellung in der Sensibilität für die Absolutheit der originären Evidenzen' (ebd.) bedeutet<br />
zugleich aber eine fundamentale Kritik an Husserls Ideal einer Philosophie als strenger<br />
Wissenschaft mit der darin intendierten radikalen Vorurteilslosigkeit. Ihm bescheinigt Heidegger<br />
eine methodische 'Naivität' (Heidegger 1993b, S. 29), die im Rückgang zu den 'Sachen selbst'<br />
wie er im Radikalismus der Phänomenologie oft ausgesprochen wird (ebd. S. 30), meint, sich<br />
damit aller Traditionsbezüge entledigen zu können, so als könne man 'heute und je in der<br />
Philosophie von vorne anfangen' (ebd. S. 29). In dieser Naivität spricht sich das aus, was<br />
Heidegger der Phänomenologie als 'Geschichtslosigkeit' (Heidegger 1988, S. 75) vorwirft. (...)<br />
Wenn Heidegger gleichwohl seinen eigenen Ansatz als phänomenologisch bestimmt sieht, so<br />
darum, weil ihm Phänomenologie zunächst ein 'wie der Forschung [ist], das sich die<br />
Gegenstände anschaulich vergegenwärtigt und sie nur, soweit sie anschaulich da sind,<br />
bespricht' (ebd. S. 72)" (vgl. Gander, 1999, S. 93).<br />
Weiters zeigt Heidegger auch klar die Grenzen der phänomenologischen Herangehensweise auf, die<br />
auch in Bezug auf ein phänomenologisches Arbeiten in der Psychotherapie immer mit bedacht<br />
werden müssen.<br />
"In kritischer hermeneutischer Reflexion muss demnach die Bestimmung der hermeneutischen<br />
Situation als Vollzugsbedingung der Interpretation geleistet werden, ohne dass dabei allerdings die<br />
Aussicht auf eine vollständig zu erzielende Transparenz als Ideal aufrecht erhalten werden könnte,<br />
womit aber zugleich auch die Möglichkeit einer Letztbegründung als in sich illusionär entlarvt und<br />
verabschiedet wird. Was in diesem Sinne als Aufgabenstellung zugleich auch die Grenze des<br />
Erkennens anzeigt, deutet zurück auf eine Endlichkeit, die konstitutionell faktisch gedacht werden<br />
muss und darin gründet, dass das Leben selbst in sich wesensmäßig durch Opazität bestimmt ist, die<br />
Heidegger (...) als 'Diesigkeit' (Heidegger, 1985, S. 88) anspricht" (vgl. Gander, 1999, S. 95). "Die<br />
verhüllte Faktizität soll sichtbar gemacht werden, um sie in Graden aufzuhellen, ohne sie darin<br />
völlig auflösen zu können, weil sie gleichsam der blinde Fleck für das hermeneutisch-<br />
phänomenologische Auge ist und bleibt" (Heidegger, 1985, S. 88).<br />
Auch Lleras (2000, S. 34) weist im "Lexikon der Logotherapie und Existenzanalyse" auf diese<br />
Begrenzung hin: "Dabei ist auch die privative Bestimmung von Erscheinung zu berücksichtigen,<br />
nach der sich etwas nie ganz zeigen kann, sondern nur so, wie es in Wechselwirkung mit dem<br />
Medium (teilverhüllt) in Erscheinung treten kann. Diese verdeckte Form des alltäglichen Seins gilt<br />
17