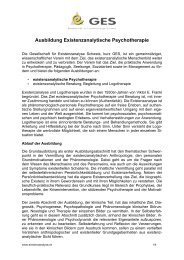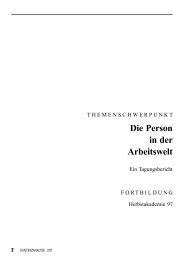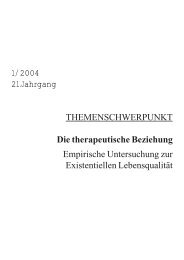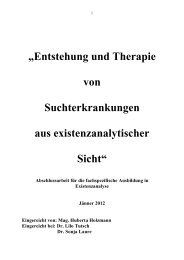PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anders zeichnet Strüber (1994, S. 566) die Wurzeln der Phänomenologie nach: Er setzt sie in der<br />
Farbenlehre Goethes und in der frühen Sinnesphysiologie von Johann Müller, Jan. E. Purkinje und<br />
Ewald Hering an. Auch die Beschreibung von Gestaltqualitäten von Ehrenfels zu Ende des 19. Jh.<br />
sieht er als wichtigen Schritt an, bevor Husserl seine Wirkung entfaltete.<br />
Bereits diese unterschiedlichen Darstellungen von Vetter und Strüber zeigen, dass es gar nicht so<br />
einfach ist, die frühen Wurzeln der Phänomenologie herauszuarbeiten. Einigkeit herrscht hingegen<br />
über die Bedeutung Edmund Husserls für die Konstituierung der Phänomenologie. Auch wenn sich<br />
die existenzanalytische Phänomenologie nicht vorrangig auf Husserl bezieht, soll hier aufgrund<br />
seiner zentralen Rolle innerhalb der Phänomenologie auf seine Arbeit eingegangen werden.<br />
2.1.1 Begründung der Phänomenologie durch Edmund Husserl<br />
Husserl begründete die Phänomenologie als philosophische Forschungsrichtung 1900/1901, als er<br />
die "Logischen Untersuchungen" veröffentlichte (vgl. Beyer, 1996). In den "Logischen<br />
Untersuchungen" entwickelte er die Theorie der Intentionalität, die er im Anschluss an seinen<br />
Lehrer Franz Brentano (1838-1917) zuerst noch deskriptive Psychologie nannte (vgl. Schneiders,<br />
1998, S. 71).<br />
Die ursprüngliche Wortbedeutung von "Phänomenologie", nämlich "Lehre von den<br />
Erscheinungen", gibt die Idee der Phänomenologie nach Husserl nur unzureichend wieder. Husserl<br />
hat die Bezeichnung der empirischen Psychologie seiner Zeit entnommen. In der Psychologie wie<br />
auch in anderen empirischen Wissenschaften wird darunter die erste Stufe des wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisprozesses verstanden, das Sammeln und Beschreiben von Daten, die dann induktiv zu<br />
Theorien verarbeitet werden (vgl. Fellmann, 2006, S. 24-25). "Die Beschreibung zielt auf ein<br />
Allgemeines, das Husserl 'Wesen' nennt" (Fellmann, F. 2006 S. 29). Das im Bewusstsein<br />
unmittelbar Gegebene soll theoriefrei beschrieben und jede intellektualistische Umdeutung der<br />
Bewusstseinsinhalte vermieden werden (vgl. Fellmann, 2006, S. 28). Die Beschreibung ist laut<br />
Vetter (2004, S. 71. ff) ein methodischer Grundbegriff phänomenologischen Denkens: "Statt über<br />
die gegebenen Phänomene hinauszugehen, um zu verallgemeinerbaren Aussagen über<br />
Verursachungsbeziehungen zu gelangen, zielt die phänomenologische Beschreibung auf die<br />
Erfassung dessen, was die Sache selbst ist, d.h. was im Wesensgehalt des Phänomens liegt.<br />
Möglicher Gegenstand einer Beschreibung ist, was erfahrbar ist."<br />
7