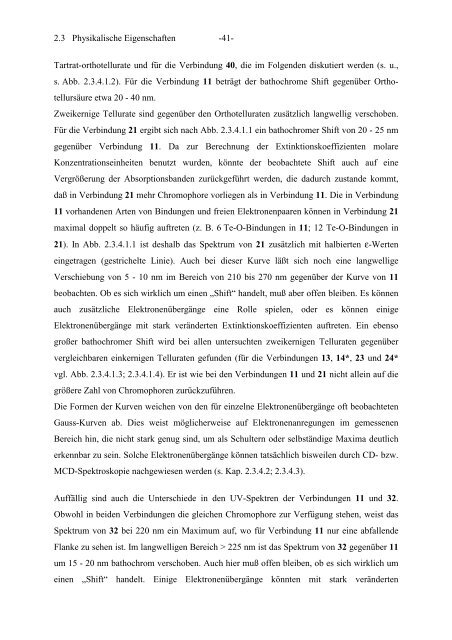Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.3 Physikalische Eigenschaften -41-<br />
Tartrat-orthotellurate und für die Verbindung 40, die im Folgenden diskutiert werden (s. u.,<br />
s. Abb. 2.3.4.1.2). Für die Verbindung 11 beträgt der bathochrome Shift gegenüber Ortho-<br />
tellursäure etwa 20 - 40 nm.<br />
Zweikernige Tellurate sind gegenüber den Orthotelluraten zusätzlich langwellig verschoben.<br />
Für die Verbindung 21 ergibt sich nach Abb. 2.3.4.1.1 ein bathochromer Shift von 20 - 25 nm<br />
gegenüber Verbindung 11. Da zur Berechnung der Extinktionskoeffizienten molare<br />
Konzentrationseinheiten benutzt wurden, könnte der beobachtete Shift auch auf eine<br />
Vergrößerung der Absorptionsbanden zurückgeführt werden, die dadurch zustande kommt,<br />
daß in Verbindung 21 mehr Chromophore vorliegen als in Verbindung 11. Die in Verbindung<br />
11 vorhandenen Arten von Bindungen und freien Elektronenpaaren können in Verbindung 21<br />
maximal doppelt so häufig auftreten (z. B. 6 Te-O-Bindungen in 11; 12 Te-O-Bindungen in<br />
21). In Abb. 2.3.4.1.1 ist deshalb das Spektrum von 21 zusätzlich mit halbierten ε-Werten<br />
eingetragen (gestrichelte Linie). Auch bei dieser Kurve läßt sich noch eine langwellige<br />
Verschiebung von 5 - 10 nm im Bereich von 210 bis 270 nm gegenüber der Kurve von 11<br />
beobachten. Ob es sich wirklich um einen „Shift“ handelt, muß aber offen bleiben. Es können<br />
auch zusätzliche Elektronenübergänge eine Rolle spielen, oder es können einige<br />
Elektronenübergänge mit stark veränderten Extinktionskoeffizienten auftreten. Ein ebenso<br />
großer bathochromer Shift wird bei allen untersuchten zweikernigen Telluraten gegenüber<br />
vergleichbaren einkernigen Telluraten gefunden (für die Verbindungen 13, 14*, 23 und 24*<br />
vgl. Abb. 2.3.4.1.3; 2.3.4.1.4). Er ist wie bei den Verbindungen 11 und 21 nicht allein auf die<br />
größere Zahl von Chromophoren zurückzuführen.<br />
Die Formen der Kurven weichen von den für einzelne Elektronenübergänge oft beobachteten<br />
Gauss-Kurven ab. Dies weist möglicherweise auf Elektronenanregungen im gemessenen<br />
Bereich hin, die nicht stark genug sind, um als Schultern oder selbständige Maxima deutlich<br />
erkennbar zu sein. Solche Elektronenübergänge können tatsächlich bisweilen durch CD- bzw.<br />
MCD-Spektroskopie nachgewiesen werden (s. Kap. 2.3.4.2; 2.3.4.3).<br />
Auffällig sind auch die Unterschiede in den UV-Spektren der Verbindungen 11 und 32.<br />
Obwohl in beiden Verbindungen die gleichen Chromophore zur Verfügung stehen, weist das<br />
Spektrum von 32 bei 220 nm ein Maximum auf, wo für Verbindung 11 nur eine abfallende<br />
Flanke zu sehen ist. Im langwelligen Bereich > 225 nm ist das Spektrum von 32 gegenüber 11<br />
um 15 - 20 nm bathochrom verschoben. Auch hier muß offen bleiben, ob es sich wirklich um<br />
einen „Shift“ handelt. Einige Elektronenübergänge könnten mit stark veränderten