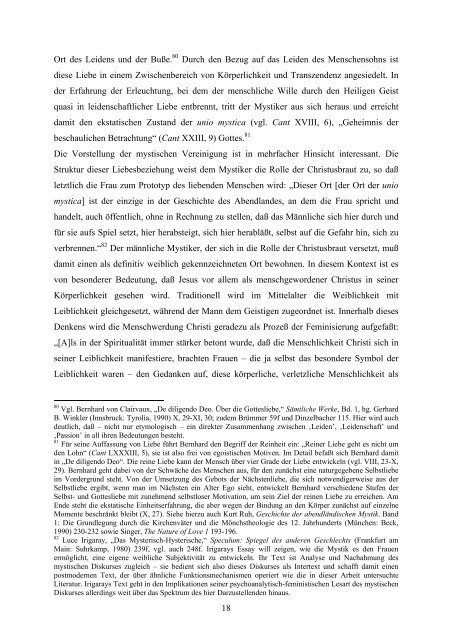Auseinandersetzungen mit der Liebe - TOBIAS-lib - Universität ...
Auseinandersetzungen mit der Liebe - TOBIAS-lib - Universität ...
Auseinandersetzungen mit der Liebe - TOBIAS-lib - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ort des Leidens und <strong>der</strong> Buße. 80 Durch den Bezug auf das Leiden des Menschensohns ist<br />
diese <strong>Liebe</strong> in einem Zwischenbereich von Körperlichkeit und Transzendenz angesiedelt. In<br />
<strong>der</strong> Erfahrung <strong>der</strong> Erleuchtung, bei dem <strong>der</strong> menschliche Wille durch den Heiligen Geist<br />
quasi in leidenschaftlicher <strong>Liebe</strong> entbrennt, tritt <strong>der</strong> Mystiker aus sich heraus und erreicht<br />
da<strong>mit</strong> den ekstatischen Zustand <strong>der</strong> unio mystica (vgl. Cant XVIII, 6), „Geheimnis <strong>der</strong><br />
beschaulichen Betrachtung“ (Cant XXIII, 9) Gottes. 81<br />
Die Vorstellung <strong>der</strong> mystischen Vereinigung ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Die<br />
Struktur dieser <strong>Liebe</strong>sbeziehung weist dem Mystiker die Rolle <strong>der</strong> Christusbraut zu, so daß<br />
letztlich die Frau zum Prototyp des liebenden Menschen wird: „Dieser Ort [<strong>der</strong> Ort <strong>der</strong> unio<br />
mystica] ist <strong>der</strong> einzige in <strong>der</strong> Geschichte des Abendlandes, an dem die Frau spricht und<br />
handelt, auch öffentlich, ohne in Rechnung zu stellen, daß das Männliche sich hier durch und<br />
für sie aufs Spiel setzt, hier herabsteigt, sich hier herabläßt, selbst auf die Gefahr hin, sich zu<br />
verbrennen.“ 82 Der männliche Mystiker, <strong>der</strong> sich in die Rolle <strong>der</strong> Christusbraut versetzt, muß<br />
da<strong>mit</strong> einen als definitiv weiblich gekennzeichneten Ort bewohnen. In diesem Kontext ist es<br />
von beson<strong>der</strong>er Bedeutung, daß Jesus vor allem als menschgewordener Christus in seiner<br />
Körperlichkeit gesehen wird. Traditionell wird im Mittelalter die Weiblichkeit <strong>mit</strong><br />
Leiblichkeit gleichgesetzt, während <strong>der</strong> Mann dem Geistigen zugeordnet ist. Innerhalb dieses<br />
Denkens wird die Menschwerdung Christi geradezu als Prozeß <strong>der</strong> Feminisierung aufgefaßt:<br />
„[A]ls in <strong>der</strong> Spiritualität immer stärker betont wurde, daß die Menschlichkeit Christi sich in<br />
seiner Leiblichkeit manifestiere, brachten Frauen – die ja selbst das beson<strong>der</strong>e Symbol <strong>der</strong><br />
Leiblichkeit waren – den Gedanken auf, diese körperliche, verletzliche Menschlichkeit als<br />
80 Vgl. Bernhard von Clairvaux, „De diligendo Deo. Über die Gottesliebe,“ Sämtliche Werke, Bd. 1, hg. Gerhard<br />
B. Winkler (Innsbruck: Tyrolia, 1990) X, 29-XI, 30; zudem Brümmer 59f und Dinzelbacher 115. Hier wird auch<br />
deutlich, daß – nicht nur etymologisch – ein direkter Zusammenhang zwischen ‚Leiden’, ‚Leidenschaft’ und<br />
‚Passion’ in all ihren Bedeutungen besteht.<br />
81 Für seine Auffassung von <strong>Liebe</strong> führt Bernhard den Begriff <strong>der</strong> Reinheit ein: „Reiner <strong>Liebe</strong> geht es nicht um<br />
den Lohn“ (Cant LXXXIII, 5), sie ist also frei von egoistischen Motiven. Im Detail befaßt sich Bernhard da<strong>mit</strong><br />
in „De diligendo Deo“. Die reine <strong>Liebe</strong> kann <strong>der</strong> Mensch über vier Grade <strong>der</strong> <strong>Liebe</strong> entwickeln (vgl. VIII, 23-X,<br />
29). Bernhard geht dabei von <strong>der</strong> Schwäche des Menschen aus, für den zunächst eine naturgegebene Selbstliebe<br />
im Vor<strong>der</strong>grund steht. Von <strong>der</strong> Umsetzung des Gebots <strong>der</strong> Nächstenliebe, die sich notwendigerweise aus <strong>der</strong><br />
Selbstliebe ergibt, wenn man im Nächsten ein Alter Ego sieht, entwickelt Bernhard verschiedene Stufen <strong>der</strong><br />
Selbst- und Gottesliebe <strong>mit</strong> zunehmend selbstloser Motivation, um sein Ziel <strong>der</strong> reinen <strong>Liebe</strong> zu erreichen. Am<br />
Ende steht die ekstatische Einheitserfahrung, die aber wegen <strong>der</strong> Bindung an den Körper zunächst auf einzelne<br />
Momente beschränkt bleibt (X, 27). Siehe hierzu auch Kurt Ruh, Geschichte <strong>der</strong> abendländischen Mystik. Band<br />
1: Die Grundlegung durch die Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts (München: Beck,<br />
1990) 230-232 sowie Singer, The Nature of Love 1 193-196.<br />
82 Luce Irigaray, „Das Mysterisch-Hysterische,“ Speculum: Spiegel des an<strong>der</strong>en Geschlechts (Frankfurt am<br />
Main: Suhrkamp, 1980) 239f, vgl. auch 248f. Irigarays Essay will zeigen, wie die Mystik es den Frauen<br />
ermöglicht, eine eigene weibliche Subjektivität zu entwickeln. Ihr Text ist Analyse und Nachahmung des<br />
mystischen Diskurses zugleich – sie bedient sich also dieses Diskurses als Intertext und schafft da<strong>mit</strong> einen<br />
postmo<strong>der</strong>nen Text, <strong>der</strong> über ähnliche Funktionsmechanismen operiert wie die in dieser Arbeit untersuchte<br />
Literatur. Irigarays Text geht in den Implikationen seiner psychoanalytisch-feministischen Lesart des mystischen<br />
Diskurses allerdings weit über das Spektrum des hier Darzustellenden hinaus.<br />
18