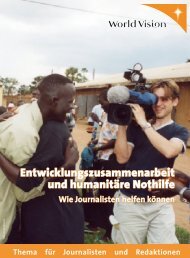Die historisch-kritische Methode – kritisch betrachtet - Kurt Bangert.de
Die historisch-kritische Methode – kritisch betrachtet - Kurt Bangert.de
Die historisch-kritische Methode – kritisch betrachtet - Kurt Bangert.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aber das sind Fragen, die zu entschei<strong>de</strong>n die Literarkritik weit überfor<strong>de</strong>rn wür<strong>de</strong>. Ihr<br />
geht es zunächst nur darum zu klären, welche <strong>de</strong>r drei Varianten die älteste sein könnte. Wie<br />
soll man sich entschei<strong>de</strong>n? Natürlich muss man sich nicht entschei<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn kann alle<br />
Varianten so stehen lassen, wie sie stehen. Aber Fragen stellen und Vermutungen anstellen<br />
muss erlaubt sein.<br />
Wenn wir davon ausgehen, was die meisten Theologen tun, dass das Markus-Evangelium<br />
das wahrscheinlich älteste <strong>de</strong>r Evangelien ist, dann spräche viel für die Markus-Version<br />
„Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ als <strong>de</strong>r ursprünglichen Variante. Ich<br />
halte das für plausibel. Eine Frage wäre, in welchem Sinne er Jesus als „Gottes Sohn“<br />
bezeichnet? Im jüdischen, römischen o<strong>de</strong>r griechischen Sinn. Alle drei Sprachen wur<strong>de</strong>n<br />
damals in Palästina gesprochen. Im jüdischen Sinne wäre dies gar nichts Anstößiges<br />
gewesen, son<strong>de</strong>rn hätte soviel be<strong>de</strong>utet wie: <strong>Die</strong>s war ein frommer, rechtschaffener Mann. 3<br />
Und diese Deutung wird <strong>de</strong>nn auch von <strong>de</strong>r Lukas-Variante bestätigt. Da <strong>de</strong>r Hauptmann<br />
aber ein Römer war, gehörte er zu <strong>de</strong>nen, die ihre Kaiser oft als „Söhne Gottes“ verehrten, so<br />
dass sein Ausspruch schon sehr ehrenvoll klingt. Und wenn wir <strong>de</strong>n Ausspruch im<br />
griechisch-hellenistischen Sinn werten, dann gewinnt er allerdings eine Qualität, die ihn in<br />
die Nähe <strong>de</strong>s griechischen Logos bringt, <strong>de</strong>r als Vermittlers zwischen Gott und <strong>de</strong>r Welt<br />
verstan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>.<br />
Doch so viele Gedanken wird sich ein römischer Hauptmann nicht gemacht haben, <strong>de</strong>m<br />
die Kreuzigung Jesu oblag. Aber er mag gespürt haben, dass während die zwei<br />
Gekreuzigten zur Linken und Rechten Jesu tatsächlich Verbrecher waren, die ihre Strafe<br />
verdient hatten, jener in <strong>de</strong>r Mitte offenbar unschuldig war. Mehr sollte man <strong>de</strong>m römischen<br />
Hauptmann nicht unterstellen. Mehr war (ursprünglich) kaum gemeint. Dass die christliche<br />
Kirche mehr in <strong>de</strong>n Ausspruch hineingelesen hat, ihn sozusagen theologisch erhöht hat, das<br />
wäre eine an<strong>de</strong>re Sache.<br />
Doch nun zu jenem Beispiel, das uns schon für die text<strong><strong>kritisch</strong>e</strong> Fragestellung<br />
diente: Das Jona-Zeichen. Wir gingen bei <strong>de</strong>r Textkritik ausführlich darauf ein, um nun auch<br />
anhand <strong>de</strong>r Literarkritik die methodischen Unterschie<strong>de</strong> und Gemeinsamkeiten<br />
herauszuarbeiten. Wir haben hier <strong>de</strong>n seltenen Fall, dass wir insgesamt sogar fünf<br />
Parallelstellen zur Verfügung haben, da die Begebenheit bei Matthäus gleich zweimal erzählt<br />
wird.<br />
3 Im Ju<strong>de</strong>ntum konnte <strong>de</strong>r Titel „Sohn Gottes“ sich auf je<strong>de</strong>n rechtschaffenen Menschen beziehen o<strong>de</strong>r auf Israel<br />
als Ganzes.