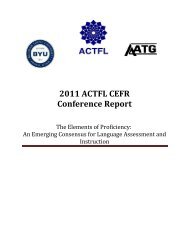Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
136<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
wäre bei hinreichender Kenntnis der menschlichen Biologie und Physiologie<br />
dann auch das Problem der Interpretation von Handlungen prinzipiell lösbar:<br />
Beweggründe (oder eben: die Ursachen) und Mechanismen individuellen Handelns<br />
sind als neurophysiologische Dispositionen verankert, interindividuelle<br />
Unterschiede und Verhaltensvariationen erklären sich aus der individuellen<br />
Lerngeschichte des Organismus und seines Gehirns. Damit scheint ein objektiver<br />
Interpretationsrahmen möglichen Verhaltens vorgegeben, ein archimedischer<br />
Punkt des Verstehens. An dieses Erklärungsmuster schließen, trotz der Betonung<br />
der Besonderheit des Menschen und der Vermeidung falscher Allgemeinheit mit<br />
Blick auf den Tier-Mensch-Vergleich, bei entsprechender evolutionärer Deutung<br />
dann auch Chomskys „<strong>Cartesianische</strong> Linguistik“ der grammatischen Universalien<br />
und seine Theorie der angeborenen „mentalen Organe“ oder Fodors „Sprache<br />
des Geistes“, d.h. des individuellen Bewusstseins, die im Grunde eine universale,<br />
d.h. in jedem Individuum instantiierte, Privatsprache ist, an.<br />
Akzeptiert man den Cartesianismus und die daran anschließende Theorie des<br />
Geistes und der Handlung, dann muss auch das Soziale individualistisch, genauer:<br />
atomistisch, erklärt werden. Wenn es Geist ausschließlich in Form individueller<br />
Bewusstseinszustände gibt, also Intentionalität und Handlung individualtheoretische<br />
Begriffe sind, dann müssen soziale Phänomene, die gewöhnlich als<br />
„geistig“ angesprochen werden, etwa kollektive Intentionalität, gemeinsames<br />
Handeln, soziale Gruppen und ihre Kultur, ihre Normen, Regeln, Praxen und Institutionen<br />
letztlich als Aggregation bzw. Superposition individueller Intentionen<br />
und Handlungen bzw. als deren Resultate aufgefasst werden, ggf. auf Basis biologisch<br />
festgelegter individueller Dispositionen zu sozialem Verhalten. M.a.W.:<br />
Es gibt nur die Individuen und deren Handlungen, nur eine Welt monadischer,<br />
d.h. auch: asozialer, Individuen, die jedes für sich, in ihrer privaten Welt von Ü-<br />
berzeugungen und Wünschen leben und entscheiden und die als solche nicht<br />
bzw. nur in ihnen äußerlichen Wechselbeziehungen stehen. Koordination und<br />
Kooperation sowie darauf beruhende soziale Einrichtungen sind daher reduktiv<br />
in Begriffen individueller Überzeugungen, Wünsche, Entscheidungen und Übereinkünfte<br />
zu beschreiben, d.h. in Begriffen, die zunächst nur für Individuen Anwendung<br />
haben und deren Zutreffen letztlich nur vom Individuum selbst beurteilt<br />
werden kann. 67<br />
sondere mit Blick auf nichtmenschliche Primaten. Aufgrund des genetischen Befundes, dass sich<br />
das Erbmaterial von Mensch und Affe nur in Bruchteilen unterscheidet, scheint auch die Interpretation<br />
der verhaltensbiologischen Daten auf der Hand zu liegen: Es liegt alles in den Genen, es gibt<br />
keinen evolutionären Bruch zwischen Tier und Mensch, folglich auch keinen kategorialen Unterschied<br />
der Verhaltensbeschreibung. Daher sei der Mensch vollständig mit den Mitteln der Naturwissenschaft,<br />
insbesondere denen der Evolutionsbiologie und Genetik sowie der Neurophysiologie,<br />
beschreibbar – des irreduzibel normativen, intentionalen Vokabulars der Geistes- und Kulturwissenschaften<br />
bedürfe es dazu nicht mehr.<br />
67 Wieder ist das Lewis-Modell aus Konventionen einschlägig, dem in der einen oder anderen Weise<br />
auch so verschiedene Positionen wie die von Tuomela, Gilbert und Bratman, aber auch die von<br />
Searle folgen. Zur Diskussion des Individualismus in der Sozialphilosophie s. auch <strong>Kannetzky</strong><br />
2004.