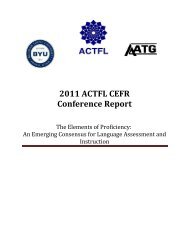Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
142<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Begriff der durch private Absichten individuierten Handlung. Es wäre irreführend,<br />
das Privatsprachenargument so zu deuten, als seien es nur die Empfindungen<br />
und die Empfindungsworte, die öffentlicher Kriterien bedürfen.<br />
Die Relevanz des Privatsprachenargumentes für die Philosophie des Geistes<br />
ergibt sich nun aus folgender Überlegung: Wenn gezeigt ist, dass das Vokabular<br />
unseres Empfindens, dann auch des Denkens und Handelns nur holistisch, d.h.<br />
im Rahmen gemeinsamer Handlungs- u. Praxisformen einen Unterschied macht,<br />
dann sind auch Schlüsse der folgenden Art blockiert, wie sie für das naturalistische<br />
Programm typisch sind: Wir empfinden x, also muss es „x-Empfindungen“<br />
(und deren neurologische Korrelate) als identifizierbare und einer Untersuchung<br />
mit naturwissenschaftlichen Methoden zugängliche Gegenstände geben. Wir<br />
denken, also gibt es ein „Denkorgan“, dessen Funktion intentionale Gehalte sind<br />
und dessen physiologische Gesetzmäßigkeiten diese Gehalte erklären können.<br />
Mit Wittgenstein kann man nun den Ort dieses Fehlschlusses lokalisieren, nämlich<br />
im Missverständnis des intentionalen Vokabulars selbst, sofern dieses als<br />
(individual-)psychologisches aufgefasst wird.<br />
Für die Sozialphilosophie bedeutet das, dass der methodologische Individualismus<br />
inadäquat sein muss, schlicht, weil das Individuum und seine Handlungen<br />
nur vor dem Hintergrund gemeinsamer Praxisformen verständlich sind, oder anders:<br />
weil das Ich nur als Teil eines Wir zu verstehen ist. Daraus folgt nun, dass<br />
der Individualismus als grundlegende methodische Orientierung prinzipiell zirkulär<br />
ist, denn er beansprucht, die Begriffe des Sozialen ausschließlich unter<br />
Verwendung von Begriffen zu definieren, die (zunächst) nur auf Individuen Anwendung<br />
haben. 77 Oder anders: Das Privatsprachenargument zeigt, dass die soziokulturelle<br />
Bedingtheit menschlicher Intentionalität eben nicht nur eine Frage<br />
der Prägung oder Überformung eines „an sich“ asozialen und akulturellen Wesen<br />
ist und daher nur das andere Ende eines Kontinuums darstellt, welches im Tierreich<br />
beginnt. Vielmehr macht die Bindung an gemeinsame Praxisformen und<br />
eine gemeinsame Sprache sowie die Einbindung in Kooperationen ihr Wesen<br />
aus, denn nur diese erklären die Formbestimmtheit möglicher Handlungen. Intentionales<br />
Vokabular ist daher prinzipiell irreduzibel und mittels naturwissenschaftlicher<br />
Beschreibungen nicht einzuholen. „Geist“ lässt sich folglich nur aus<br />
der Perspektive des Teilnehmers an gemeinschaftlichen Praxen erfassen, nicht<br />
aus der eines objektiven Beobachters. Vielmehr verkörpert die Idee der Perspektiveninvarianz<br />
selbst eine besondere kulturelle Praxis und hat nur in deren Rahmen<br />
Geltung.<br />
Ich werde im folgenden das Privatsprachenargument, seine handlungstheoretische<br />
Deutung und Verallgemeinerung sowie einige Konsequenzen für die im<br />
zweiten Teil genannten Probleme, insbesondere des Verstehens von Sprache und<br />
Handlung, skizzieren.<br />
77 Vgl. dazu <strong>Kannetzky</strong> 2004.