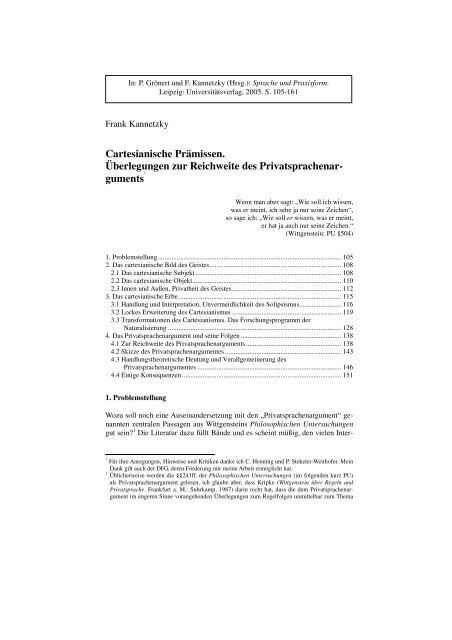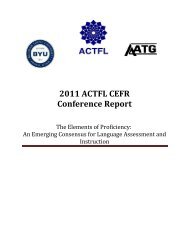Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In: P. Grönert und F. <strong>Kannetzky</strong> (Hrsg.): Sprache und Praxisform.<br />
Leipzig: Universitätsverlag, 2005. S. 105-161<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong>.<br />
Überlegungen zur Reichweite des Privatsprachenarguments<br />
*<br />
Wenn man aber sagt: „Wie soll ich wissen,<br />
was er meint, ich sehe ja nur seine Zeichen“,<br />
so sage ich: „Wie soll er wissen, was er meint,<br />
er hat ja auch nur seine Zeichen.“<br />
(Wittgenstein: PU §504)<br />
1. Problemstellung.......................................................................................................... 105<br />
2. Das cartesianische Bild des Geistes............................................................................ 108<br />
2.1 Das cartesianische Subjekt .................................................................................... 108<br />
2.2 Das cartesianische Objekt...................................................................................... 110<br />
2.3 Innen und Außen, Privatheit des Geistes ............................................................... 112<br />
3. Das cartesianische Erbe.............................................................................................. 115<br />
3.1 Handlung und Interpretation, Unvermeidlichkeit des Solipsismus........................ 116<br />
3.2 Lockes Erweiterung des Cartesianismus ............................................................... 119<br />
3.3 Transformationen des Cartesianismus. Das Forschungsprogramm der<br />
Naturalisierung .................................................................................................... 128<br />
4. Das Privatsprachenargument und seine Folgen .......................................................... 138<br />
4.1 Zur Reichweite des Privatsprachenarguments ....................................................... 138<br />
4.2 Skizze des Privatsprachenargumentes ................................................................... 143<br />
4.3 Handlungstheoretische Deutung und Verallgemeinerung des<br />
Privatsprachenargumentes ................................................................................... 146<br />
4.4 Einige Konsequenzen ............................................................................................ 151<br />
1. Problemstellung<br />
Wozu soll noch eine Auseinandersetzung mit den „Privatsprachenargument“ genannten<br />
zentralen Passagen aus Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen<br />
gut sein? 1 Die Literatur dazu füllt Bände und es scheint müßig, den vielen Inter-<br />
* Für ihre Anregungen, Hinweise und Kritiken danke ich C. Henning und P. Stekeler-Weithofer. Mein<br />
Dank gilt auch der DFG, deren Förderung mir meine Arbeit ermöglicht hat.<br />
1 Üblicherweise werden die §§243ff. der Philosophischen Untersuchungen (im folgenden kurz PU)<br />
als Privatsprachenargument gelesen, ich glaube aber, dass Kripke (Wittgenstein über Regeln und<br />
Privatsprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987) darin recht hat, dass die dem Privatsprachenargument<br />
im engeren Sinne vorangehenden Überlegungen zum Regelfolgen unmittelbar zum Thema
106<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
pretationen eine neue hinzuzufügen. Das ist auch nicht meine Absicht. Was mir<br />
in der Diskussion fehlt, ist eine Übersicht über die philosophischen Probleme,<br />
die vom Privatsprachenargument mittelbar oder unmittelbar betroffen sind. Und<br />
in dieser Hinsicht scheint die Diskussion entweder zu eng oder wenigstens nicht<br />
explizit genug geführt: Es mangelt an einem Überblick über die <strong>Prämissen</strong>, vor<br />
allem aber über die Konsequenzen des Argumentes, am Bezug auf konkurrierende<br />
Ansichten, sofern diese nicht Behauptungen aufstellen, die denen Wittgensteins<br />
explizit zuwiderlaufen, und an Gesamtdeutungen des Argumentes, d.h.<br />
seiner Einordnung in die philosophische Landschaft – und hier gehört es an einen<br />
systematisch zentralen Platz. Es ist ein gutes halbes Jahrhundert her, dass<br />
Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“ einem breiten Publikum zugänglich<br />
wurden. Befasst man sich aber mit der neueren philosophischen Literatur<br />
zu dem Themenkreis, der mit den Stichworten Sprache, Bedeutung, Kommunikation,<br />
Geist, Intentionalität, Rationalität, Handlung und Kooperation grob<br />
umrissen werden kann, so lässt sich konstatieren, dass Wittgensteins Argumente<br />
über die Möglichkeit einer Privatsprache, das Regelfolgen und angrenzende Fragen<br />
mit Ausnahme bestimmter Richtungen der Sprachphilosophie in weiten Teilen<br />
des gegenwärtigen Philosophierens folgenlos geblieben sind, mitunter so folgenlos,<br />
als hätte es Wittgenstein nie gegeben. 2<br />
Dafür gibt es mehrere, eng zusammenhängende Gründe. Erstens wird aufgrund<br />
der oft aphoristischen, am konkreten Beispiel operierenden Argumentation<br />
Wittgensteins leicht übersehen, dass seine Argumente ganze Gruppen bzw. Typen<br />
von Theorien betreffen und dass er Beispiele wählt, die für den Aufbau dieser<br />
Theorien konstitutiv sind, auch wenn dies nicht immer auf der Hand liegt, etwa<br />
wenn voneinander anscheinend weit entfernte Bereiche wie Mathematik und<br />
Psychologie in unmittelbare begriffliche Nachbarschaft gerückt werden. Zweitens<br />
entsteht aufgrund der Argumentation Wittgensteins, die scheinbar nur Empfindungen,<br />
Empfindungsausdrücke und ostensive Definitionen betrifft, der falsche<br />
Eindruck, dass hier nur spezielle Probleme der Bedeutungstheorie verhandelt<br />
werden. Die Übereinstimmung der <strong>Prämissen</strong> des Privatsprachenargumentes<br />
mit den Grundannahmen, oder genauer: mit dem begrifflichen Rahmens eines<br />
breiten Spektrums älterer und neuerer Theorien wird zudem durch den Stil und<br />
die Sprache Wittgensteins verdeckt, die gemessen am terminologischen Apparat<br />
und den Differenzierungen (und Scheindifferenzierungen) ‘moderner’ Theorien,<br />
auf den ersten Blick eher arm erscheint. Das gleiche gilt, drittens, für die Konsequenzen<br />
des Privatsprachenargumentes. Wittgenstein benennt diese nicht immer<br />
explizit, z.T. aus therapeutischen Gründen, z.T. weil es die Theorien, gegen die<br />
sich seine Argumente richten, zwar dem Typus nach, aber selbstverständlich<br />
nicht in ihrer gegenwärtigen Form und Terminologie gab. Wird nicht erkannt,<br />
gehören, auch wenn Kripkes Formulierung des Problems als „skeptisches Paradox“ oder als „Paradox<br />
des Regelfolgens“, wenigstens mit Blick auf textexegetische Standards, irreführend ist.<br />
2 Gleiches gilt für die verwandten, wenngleich nicht im gleichen Maße rezipierten Untersuchungen<br />
von G. Ryle in Der Begriff des Geistes.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 107<br />
dass es sich um dieselben oder wenigstens ähnliche <strong>Prämissen</strong> handelt, bleibt die<br />
Reichweite der Konsequenzen des Argumentes verborgen. Wird aber die Reichweite<br />
eines Argumentes nicht überblickt, dann bleibt es im Grunde unbegriffen.<br />
Mir scheint, dass dies beim Privatsprachenargument der Fall ist.<br />
Abgesehen davon gibt es in großen Teilen der gegenwärtigen Philosophie eine<br />
unausgesprochene, absichtlich oder jedenfalls nicht unabsichtlich in Ignoranz<br />
mündende Abstinenz gegenüber Wittgenstein: Seine Einlassungen seien rein destruktiv,<br />
sie lähmten jede theoretische Arbeit. Und das ist in gewissen Sinne richtig,<br />
sofern Wittgenstein aus guten, jedenfalls nachvollziehbaren Gründen einen<br />
bestimmten Theorietypus, nämlich den der deduktiv-axiomatischen Theorie, als<br />
allgemeinverbindliches Erkenntnisideal der Philosophie ablehnt. Die Einsichten<br />
der Philosophie sind anderer Art als die der formalen oder empirischen Wissenschaften,<br />
und wer sich in der Philosophie am Bild dieser Wissenschaften orientiert,<br />
der mag mit Wittgenstein nicht viel anfangen können. Aber Ignoranz ist<br />
kein Argument. Dass man nach Wittgenstein in der Philosophie nicht einfach so<br />
weitermachen kann wie bisher, scheint auch klar. Aber, und das hängt mit dem<br />
oben Gesagten zusammen, es bleibt offen, wie es weiter gehen soll. Mag sein,<br />
dass viele philosophische Fragen sich als unsinnig ausweisen lassen, aber deshalb<br />
geben sie noch lang keine Ruhe. Ignoranz ist zwar kein Argument, aber<br />
manchmal hilfreich.<br />
Es wird mit Recht behauptet, dass das Privatsprachenargument dem Cartesianismus<br />
den Boden entzieht. 3 Wenn das Privatsprachenargument also zutrifft, und<br />
das ist die These, für die ich im folgenden argumentieren will, dann verlieren<br />
damit auch alle die Theorien ihre Grundlage und Berechtigung, die in der einen<br />
oder anderen Weise auf cartesianischen <strong>Prämissen</strong> beruhen oder diese voraussetzen.<br />
Was das bedeutet, bleibt aber unklar in dem Sinne, dass die systematische<br />
Reichweite cartesianischen Denkens, d.h. eines noch näher zu charakterisierenden<br />
Typus des Philosophierens, und damit auch die des Privatsprachenargumentes,<br />
meist unterschätzt wird. Ich meine nun, cartesianische <strong>Prämissen</strong> überall dort<br />
zu finden, wo Begriffe des Handelns und des Sprechens mittels der Aktivität von<br />
im relevanten Sinne isolierten, „atomaren“ Individuen bzw. unter wesentlichem<br />
Bezug auf Leistungen des individuellen Bewusstseins (Geist, mind) erklärt werden<br />
sollen. Dies trifft insbesondere auf Lockes Theorie des Geistes und der Sprache<br />
und deren zahlreiche Ableger neueren Datums zu, ebenso auf naturalistische<br />
Theorien des Geistes, sowie auf Theorien des individuellen und kollektiven<br />
Handelns, die von dem Individuum (angeblich) unmittelbar zugänglichen Intentionen<br />
ausgehen. 4 Daran ändert sich auch durch eine pragmatische Rückführung<br />
3 Zum Beispiel in S. Schröder: Das Privatsprachen-Argument. Wittgenstein über Empfindung & Ausdruck.<br />
Paderborn: Schöningh, 1998.<br />
4 Ein markantes Beispiel für Gedanken Lockescher Art in neuer Terminologie ist Wayne A. Davis’<br />
letztes Buch (Meaning, Expression and Thought. Cambridge: Cambridge UP 2003), welches für eine<br />
„expression theory of meaning“ plädiert, generell steht die Gricesche Linie der Kommunikations-<br />
und Bedeutungstheorie (wie sie etwa von G. Meggle in Grundbegriffe der Kommunikation vertreten<br />
wird) in dieser Tradition. Cartesianisch-lockesches Gedankengut findet sich auch im Stan-
108<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
von Begriffen des Geistes, des Sinns und des Verstehens auf Handlungen nichts,<br />
solange man Handlungen (und damit auch Sprechhandlungen) wesentlich unter<br />
Bezug auf den subjektiven Handlungssinn, also auf individuelle Absichten erklärt.<br />
Die Beschäftigung mit Descartes und Locke zeigt, wie tief die Vorstellungen<br />
von Geist, Sprache und Bedeutung, die mit dem Privatsprachenargument zurückgewiesen<br />
werden, in der philosophischen Tradition verankert sind und wie<br />
weit entsprechende Beschreibungen die Reflektion auf unser Tun prägen. Es ist<br />
ein Irrtum zu glauben, nur weil wir heute eine andere Terminologie verwenden,<br />
hätten sich die Konzeptualisierungen wesentlich verändert. Dies nachzuweisen<br />
und den Typus der aufgrund des Privatsprachenargumentes problematischen<br />
Begriffsbildungen zu charakterisieren, dienen die beiden folgenden Abschnitte<br />
zum cartesianisch-lockeschen Bild des Geistes. Damit sollte die systematische<br />
Relevanz und die Reichweite des Privatsprachenargumentes über bedeutungstheoretische<br />
Fragen hinaus klar werden: Es betrifft die Philosophie überhaupt.<br />
Den Nachweis dafür will ich im vierten Abschnitt führen, indem ich das Privatsprachenargument<br />
skizziere und vorschlage, es nicht nur als i.e.S. sprachphilosophisches<br />
bzw. bedeutungstheoretisches, sondern v.a. als handlungstheoretisches<br />
Argument zu lesen und es entsprechend für Intentionen und Handlungen<br />
überhaupt zu verallgemeinern (Privathandlungsargument). Es zeigt, insbesondere<br />
in dieser Verallgemeinerung, ein grundlegendes Problem des Philosophierens im<br />
Rahmen cartesianisch-lockescher <strong>Prämissen</strong>. Bekanntlich verweigert sich Wittgenstein<br />
dem Aufbau einer „positiven“ Theorie, und dafür gibt es gute Gründe. 5<br />
Nun ist hier nicht der Ort, eine solche Theorie aufzubauen, selbst wenn sie möglich<br />
sein sollte. Ich beschränke mich daher auf die Darlegung einiger Konsequenzen<br />
und methodischer Anhaltspunkte, denen eine Theorie des Geistes und<br />
der Handlung gerecht werden muss, wenn sie dem, was das Privatsprachenargument<br />
ex negativo zeigt, gerecht werden will.<br />
2. Das cartesianische Bild des Geistes<br />
2.1 Das cartesianische Subjekt<br />
Descartes hält sich einiges darauf zugute, dass seine Auffassungen einfach sind<br />
und mit dem gesunden Menschenverstande übereinstimmen, 6 dass sie jeder, der<br />
dardmodell der Handlung als intentionales Verhalten und folgerichtig in allen Theorien, die auf diesem<br />
Handlungsbegriff ruhen, insbesondere in Theorien kollektiven Handelns und der neueren Sozialphilosophie.<br />
Beispiele dafür sind, trotz großer Unterschiede im Detail, die Theorien des gemeinsamen<br />
Handelns und des „Wir“, wie sie von R. Tuomela, M. Gilbert, M. Bratman und J. Searle<br />
vorgelegt worden sind. (s. dazu auch <strong>Kannetzky</strong> 2004).<br />
5 Vgl. Raatzsch, R.: Eigentlich Seltsames. Paderborn: Schöningh, 2002, ders.: Philosophiephilosophie.<br />
Ditzingen: Reclam, 2000.<br />
6 Vgl. R. Descartes: Abhandlung über die Methode (im folgenden: Abhandlung), VI/17, S. 64 und<br />
passim. Zum cartesianischen Bild des Geistes im allgemeinen vgl. auch Ryles Der Begriff des Geis-
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 109<br />
ihre Gründe prüft, anerkennen muss. Und tatsächlich gibt es – wenigstens für uns<br />
Heutige – kaum eine plausiblere und eingängigere Doktrin in der Geschichte der<br />
Philosophie, als die von der Unmittelbarkeit des Seelenlebens und der (epistemischen)<br />
Unfehlbarkeit des Selbstwissens und des Selbstbewusstseins. Man machte<br />
sich lächerlich, wollte man bestreiten, dass doch wohl der die wahren Absichten<br />
am besten kennt, der sie hat, dass jeder selbst die letzte Autorität für seine Seelenzustände<br />
und Empfindungen ist. Jeder weiß, dass man wohl andere, aber nicht<br />
sich selbst willentlich belügen kann. Dass man sich falsch erinnert, dass sich im<br />
Nachhinein manch tiefe Empfindung als flüchtig und seicht, manche Gewissheit<br />
als falsch und manche Wahrnehmung als Sinnestäuschung herausstellt, ist kein<br />
Einwand gegen die Selbstgewissheit meines gegenwärtigen Bewusstseins: Darin,<br />
was ich eben jetzt empfinde, glaube und will, kann ich mich nicht täuschen, und<br />
dies, so wird es später aufgefasst, gehört geradezu zur Definition des Selbstbewusstseins.<br />
7 Die Seele<br />
„findet [...] zwar zunächst in sich die Vorstellungen von vielen<br />
Dingen; aber so lange sie nur diese Vorstellungen betrachtet, ohne<br />
zu behaupten oder zu leugnen, daß etwas ihnen Ähnliches außerhalb<br />
ihrer bestehe, kann sie nicht irren.“ 8<br />
Der Kern des Cartesianismus, die Lehre von der Unmittelbarkeit des Selbstbewusstseins<br />
und seiner epistemischen Unfehlbarkeit hinsichtlich der seelischen<br />
Zustände seines Trägers, ist durch das tägliche Leben und Erleben nicht nur fundiert,<br />
sondern ist selbst Teil des Alltags, und an diese Plausibilität können die<br />
weiteren Lehren des Descartes anknüpfen. Insbesondere der Dualismus von Leib<br />
tes, der m. E. allerdings zu wenig auf die lebensweltlichen Motive dessen, was er „offizielle Doktrin“<br />
und „paramechanische Theorie“ nennt, eingeht und Descartes’ Theorie deshalb v.a. als epistemisches<br />
Problem mangelnder Kategoriendisziplin deutet. Die zentrale Frage ist aber, warum sich<br />
der Mythos so hartnäckig hält. Ryles Verweis auf Besonderheiten der (theoretischen) Sprachverwendung<br />
ist als Beschreibung des Sachverhaltes zwar richtig, aber damit ist nicht erklärt, warum<br />
dieser Mythos durch Aufklärung nicht aus der Welt zu schaffen ist. Es ist die lebenspraktische Signifikanz<br />
bestimmter Redeweisen, die hier zu Vereinseitigungen und falschen Verallgemeinerungen<br />
führt. In einer auf ökonomische Effizienz abgestellten Welt, in der eine gesunde Portion Misstrauen<br />
zum Alltag gehört, kann man oft nur im Nachhinein beklagen, dass man die wahren Absichten anderer<br />
hätte kennen müssen, um angemessen zu handeln, wie man es umgekehrt auch begrüßen mag,<br />
die eigenen Absichten verbergen zu können. Wir können ja tatsächlich nicht in den Geist des anderen<br />
hineinschauen, und es hilft im konkreten Fall nicht, dass man es „in the long run“ doch recht<br />
zuverlässig kann.<br />
7 Vgl. etwa den „frühen“ R. Rorty: Incorrigibility as the Mark of the Mental. Journal of Philosophy<br />
67 (1970), 406-424. Rorty beschreibt den Unterschied unserer Selbstauskünfte zu Berichten über<br />
„Physisches“ gerade mittels der Unkorrigierbarkeit der „Berichte“ über die eigenen geistigen Zustände.<br />
Diese Unkorrigierbarkeit wiederum erkläre die Privatheit des Mentalen, wenngleich sich die<br />
Privilegiertheit des Zugangs zur eigenen Seele nach Rorty mit dem Wachstum neurophysiologischen<br />
Wissens relativieren mag.<br />
8 Descartes: Prinzipien der Philosophie, I/13 (im folgenden: Prinzipien). Dem entsprechen die „Vorstellungen<br />
im Geiste“ (ideas) Lockes.
110<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
und Seele hat im Freiheitsproblem eine seiner wichtigen Quellen: 9 Mag ich in<br />
meinem Verhalten auch durch äußere Zwänge bestimmt sein – in meinem Innern<br />
bin ich autonom, hier bin ich Herr. Die Gedanken sind frei. Mag die Welt sein<br />
wie sie will – ich kann mir meinen Teil dazu denken. Mag mein Handeln aufgrund<br />
der Tücken der Welt ungewollte Folgen hervorbringen – meine wahre Absicht<br />
hängt davon nicht ab. Descartes folgert, dass die Substanz des Subjektes<br />
sein Bewusstsein ist, oder genauer: Das Subjekt ist Selbstbewusstsein, Denken.<br />
Denn<br />
„Daraus, daß ich von meiner Existenz weiß und dabei gar nichts<br />
anderes als zu meiner Natur oder meinem Wesen gehörig erkenne,<br />
als daß ich ein denkendes Ding sei, schließe ich mit Recht, daß<br />
mein Wesen allein darin besteht, daß ich ein denkendes Ding<br />
bin.“ 10 ,<br />
„... eine Substanz [...], deren ganze Wesenheit oder Natur nur im<br />
Denken besteht, und die, um zu sein, keines Ortes bedarf, noch<br />
auch von irgendeinem materiellen Dinge abhängt. Es ist demnach<br />
dieses Ich, d.h. die Seele, durch die ich bin, was ich bin, von meinem<br />
Körper gänzlich verschieden und selbst leichter zu erkennen<br />
als er; und wenn es gleich keinen Körper gäbe, so würde sie trotzdem<br />
genau das bleiben, was sie ist.“ 11<br />
Selbst der Leib wird zum Objekt, auf der Subjektseite bleibt allein das Bewusstsein.<br />
Damit macht Descartes auch die Empfindungen und den Willen, die<br />
traditionell als zum Leib gehörig konzipiert und im Gegensatz zur Klarheit der<br />
Ideen des Verstandes gesehen wurden, zur Sache der geistigen Substanz, des<br />
Denkens, unter das nun alles fällt, was irgend bewusst werden kann.<br />
„Unter Denken verstehe ich Alles, was mit Bewußtsein in uns geschieht,<br />
insofern wir uns dessen bewußt sind. Deshalb gehört nicht<br />
bloß das Einsehen, Wollen, Bildlich-Vorstellen, sondern auch das<br />
Wahrnehmen hier zum Denken.“ 12<br />
2.2 Das cartesianische Objekt<br />
Es wird oft vernachlässigt, dass Descartes nicht nur der Schöpfer des bewusstseinsphilosophischen<br />
Subjektbegriffs ist, sondern, als dessen begriffliches Gegenstück,<br />
auch den neuzeitlichen Objektbegriff entscheidend geprägt hat. Dieser<br />
9 Im Grunde stellen das Freiheitsproblem, so wie es üblicherweise formuliert wird, nämlich als Problem<br />
des Determinismus, und das Leib-Seele-Problem nur verschiedene Formulierungen derselben<br />
Frage dar (die als solche freilich schon falsch gestellt ist).<br />
10 R. Descartes: Meditationen über die Erste Philosophie. (übersetzt von G. Schmidt). Stuttgart: Reclam,<br />
1980 (im folgenden Meditationen), VI, S. 98.<br />
11 Abhandlung IV/4, S. 31<br />
12 Prinzipien I/9
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 111<br />
fällt weitgehend zusammen mit dem Begriff der Natur als mathematisch erfassbaren,<br />
maschinenhaften Bereich des Mechanischen. 13 Descartes Erkenntnisideal<br />
ist die Klarheit und Sicherheit der Mathematik und damit die vereinheitlichende<br />
„Mathematisierung“ der Naturerkenntnis. Diese wird, ganz im Sinne Galileis,<br />
nach dem das Buch der Natur bekanntlich in der Sprache der Mathematik geschrieben<br />
ist, zur modernen Naturwissenschaft, indem sie, von der Fülle der Bestimmungen<br />
der Dinge abstrahierend und diese idealisierend, ihren Gegenstand<br />
schafft, nämlich die Natur als Gesamtheit der mathematisierbaren nomologischen<br />
Zusammenhänge. 14 Die res extensa ist die (unbegriffene) Projektion der<br />
deduktiv-axiomatischen Darstellungsform auf die erfahrbare Welt, und nur in einem<br />
solchen Theoriezusammenhang hat auch die Rede von einer durchgehenden<br />
Notwendigkeit (etwa dem Kausalnexus) ihren Ort und ihren Sinn. Das mathematische<br />
Wissensideal, die schrittweise Konstruktion aus evidenten Elementen,<br />
wird als deren Wesen in die Welt der Erfahrung projiziert, die Natur erscheint<br />
nun als Maschine, womit in der Reflexion wiederum die mathematische Vereinheitlichung<br />
der Naturerkenntnis gerechtfertigt werden kann. Die Kategorien der<br />
„methodischen“, mathematisierten Wissenschaft werden aber nicht nur als Formen<br />
der Natur aufgefasst (die Gesetze der Mathematik und Physik legen fest,<br />
was ein natürlicher Gegenstand ist), sondern als Formen des Denkens zu allgemeinen,<br />
eingeborenen Ideen hypostasiert. Aufgrund dieser Übereinstimmung von<br />
Natur und Geist ist die Natur prinzipiell erkennbar. Was sich dieser Art der Erkenntnis<br />
dagegen vorerst entzieht, ist der Mensch selbst, sein Wesen, denn dieser<br />
ist substantiell Selbstbewusstsein, Denken – und dieses ist von der Körperwelt<br />
gänzlich unabhängig, d.h. es unterliegt nicht den Gesetzen, die mathematisch<br />
modelliert werden können. M.a.W.: Es ist als solches nicht determiniert wie die<br />
Vorgänge der Körperwelt. Ich komme darauf zurück.<br />
Der rationalen Erkenntnis, die als Kette jeweils intuitiv einsichtiger Konstruktionsschritte<br />
aus elementaren Bausteinen (nämlich den geometrischen Figuren,<br />
deren Verhältnisse dank Descartes Erfindung der analytischen Geometrie<br />
nun auch arithmetisch beschrieben werden können) aufgefasst wird, korrespondiert<br />
als Wahrheitskriterium die Evidenz, die sich auf die einfachen und intuitiv<br />
gewissen Ideen und Konstruktionsschritte bezieht. Komplexere Ideen erhalten<br />
Evidenz nur durch analytische Rückführung auf einfache Bestandteile und die<br />
daran anschließende konstruktive Synthese mittels einfacher, dem Verstand unmittelbar<br />
einleuchtender Schritte. Ganz analog sind Deduktionen nur dann beweiskräftig,<br />
wenn sie in elementare Schritte zerlegt und aus solchen wieder zu-<br />
13 Vgl. etwa Abhandlung V/16, S. 48<br />
14 Dieses Bild der Natur findet sich noch bei Kant (KdrV, Prolegomena) und ist bis heute das dominierende<br />
Bild. Bekanntlich ist dies aber nicht das letzte Wort, schon Hegel deutet dieses Bild im<br />
Sinne der Freiheit des Begriffs als eine Darstellungsform von Weltwissen, von Wright (1991, 71ff.)<br />
sieht in der nomologischen Kausalität eine Kategorie des (experimentierenden) Handelns, und in<br />
der jüngsten mir bekannten Arbeit zu Problemen der Kausalität wird diese als Anwendung generischer<br />
(nicht universeller!) Sätze auf Einzelfälle gefasst (C. Henning: Kausalität und Wahrheit.<br />
Diss, Leipzig 2004).
112<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
sammengefügt werden können. In diesem Sinne gibt es „keine anderen Wege zur<br />
sicheren Erkenntnis [...] außer der evidenten Intuition und der notwendigen Deduktion“.<br />
15 Intuitiv evident sind nun – das ist die Projektion des mathematisch<br />
(geometrisch) verfassten Methodenideals in die innere Welt des Denkens – in<br />
erster Linie räumliche, geometrisch erfassbare Vorstellungen, etwa die Ideen von<br />
Gestalt, Größe und dann auch Bewegung. 16 (Locke unterscheidet ganz analog<br />
zwischen primären und sekundären Qualitäten). Soweit nun die Natur mittels der<br />
Konstruktion aus solchen klar und deutlich einsehbaren Elementen 17 , die sich mit<br />
Blick auf diese elementaren Eigenschaften unterscheiden, theoretisch, d.h.: als<br />
Mechanismus, dargestellt werden kann, ist sie streng determiniert und bietet keinen<br />
Raum für den freien Willen und für menschliches Handeln. Damit wird eine<br />
Darstellungsform ontologisiert, d.h. der weiteren Analyse entzogen. Die Natur<br />
als geometrisch und mittels der analytischen Geometrie auch arithmetisch erfassbare<br />
Körperwelt wird zum Inbegriff eines Reiches strenger Notwendigkeit.<br />
2.3 Innen und Außen, Privatheit des Geistes<br />
Der phänomenologisch zunächst plausible und in entsprechenden Rede- und<br />
Handlungskontexten wichtige Unterscheidungen artikulierende cartesianische<br />
Dualismus von Leib und Seele wird vermittels der Projektion und Hypostasierung<br />
der „Methode“ zu einer Geist-Welt-Dichotomie vertieft. Die Welt zerfällt in<br />
eine kausal determinierte Natur, res extensa, zu der nicht nur die Bewegungen<br />
der Körper, sondern auch das Verhalten von Tier und Mensch (und damit auch<br />
die Gesellschaft) zählen 18 , und eine Welt des Geistes, res cogitans, die das Reich<br />
des freien und spontanen Denkens und Wollens darstellt und gerade dadurch definiert<br />
ist, dass sie der kausalen Notwendigkeit nicht unterliegt. Menschliches<br />
Handeln muss demnach seine Ursache im Geist haben, denn als freies Handeln<br />
durchbricht es die Naturnotwendigkeit. Dem entspricht die Erfahrung der Spontaneität<br />
menschlichen Handelns, das wohl mehr oder weniger gut, aber niemals<br />
mit letzter Gewissheit vorhergesagt werden kann. Umgekehrt gilt, „daß nichts<br />
gänzlich in unserer Macht steht, als unsere Gedanken“. 19 Das autonome Selbstbewusstsein<br />
scheint einer Welt gegenüberzustehen, die ausschließlich kausalmechanischen<br />
Gesetzen folgt. Erst vor dem Hintergrund dieses Naturbegriffs<br />
kann der Dualismus von Geist und Welt voll entfaltet werden: Wenn die Natur<br />
von der Notwendigkeit regiert wird, der Geist aber Spontaneität besitzt, dann<br />
15 Regeln XII/24, S. 121.<br />
16 Vgl. Prinzipien II/4; Meditiationen III, S. 64.<br />
17 S. etwa Abhandlung II/14ff., S. 20f. und Regeln V, VI, S. 84f.<br />
18 Der Mensch als Körper unterscheidet sich nicht vom Tier. Sofern es um sein äußerliches Verhalten,<br />
um Reaktionen auf Sinneseindrücke etc. geht, kann er als Maschine aufgefasst werden. Der eigentliche<br />
Unterschied besteht in der Vernunft, welche durch die Möglichkeit sinnvollen Sprachgebrauchs<br />
angezeigt wird (Abhandlung V/16f., S. 48ff.).<br />
19 Abhandlung III/4, S. 25.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 113<br />
kann der Geist nicht Teil der Natur sein. 20 Was ist er dann? Eine Substanz sui generis,<br />
die ihren eigenen, nichtnatürlichen Gesetzen folgt, ein nichträumlicher,<br />
nicht- bzw. überzeitlicher, demnach ein nichtgegenständlicher Gegenstand. Wäre<br />
er in Begriffen des Raumes beschreibbar, dann unterläge er dessen Gesetzen und<br />
wäre damit Teil der ausgedehnten Natur. An der Dichotomie von unausgedehntem<br />
Denken und ausgedehntem Körper ist richtig, dass Gedanken, Absichten u.a.<br />
„Dinge der Seele“ in gewissem Sinne überzeitlich und unräumlich sind – weder<br />
hat es Sinn zu sagen, ich hätte von 9 bis 12 Uhr den Gödelschen Beweis begriffen,<br />
21 noch könnte eine physiologische Untersuchung meines Körpers diese Ü-<br />
berzeugung ans Licht bringen – die Frage ist nur, wie diese Überzeitlichkeit, Unräumlichkeit,<br />
kurz: die Nichtnatürlichkeit der „Dinge der Seele“ bzw. des Geistes<br />
erfasst werden soll, insbesondere wenn Objektivität nur den Dingen der Natur<br />
zukommen soll.<br />
In der philosophischen Tradition wird die Auffassung der Dinge des Geistes<br />
als nichtgegenständlicher Gegenstand mit der Metapher von Innen und Außen<br />
verbunden, die auch Descartes verwendet. Hier die geistige, nichtgegenständliche<br />
Innenwelt, da die Außenwelt der ausgedehnten Körper im Raum. Dabei wird<br />
die geistige Innenwelt als der Bereich des Eigenpsychischen gedeutet. Damit ist<br />
unter der Hand eine wichtige begriffliche Entscheidung gefallen, denn das Reich<br />
des Geistes und der Subjektivität, d.h. der Totalität der menschlichen Handlungsund<br />
Denkmöglichkeiten, wird damit nicht nur gegen die physische Welt abgegrenzt,<br />
sondern primär als subjektives Bewusstsein, als Seele aufgefasst. Daraus,<br />
dass wir nur als Individuen wahrnehmen, denken, fühlen, wollen können, wird<br />
geschlossen, dass das individuelle Bewusstsein die Basis allen Denkens und<br />
Handelns ist. Zwei wichtige Konsequenzen daraus sind die folgenden: Erstens<br />
20 Lässt man mit Blick auf die Natur dagegen auch andere Redeformen, etwa eine eher qualitative<br />
und teleologische Sichtweise, als sinnvoll zu und damit auch verschiedene Gegenstandsbereiche<br />
sinnvoller Rede, etwa die einer „aristotelischen“ Natur, der es nicht um die Vereinheitlichung der<br />
Naturerkenntnis mittels mathematischer Modellierung geht und die damit den Dingen ihr je eigenes,<br />
irreduzibles Wesen lässt, dann lässt sich der Dualismus von Leib und Seele, von Naturwesen<br />
und Vernunftwesen, am Ende der von Notwendigkeit i.S. einer naturgesetzlichen Determination<br />
und Freiheit gar nicht sinnvoll formulieren. Wie könnte es einen Widerspruch zwischen Zweckmäßigkeit<br />
und Natur geben, wenn die Natur selbst nicht nur mechanistisch aus Ursachen gedacht<br />
werden kann, sondern mit Blick auf Verläufe und deren Finalität teleologisch gedacht werden<br />
muss, weil es andernfalls gar keinen Sinn hätte, von Verläufen zu sprechen? (Deshalb gilt mit Hegel:<br />
„Die Wahrheit des Mechanismus ist die Teleologie“). Ich will im folgenden nicht weiter auf<br />
diesen zweiten, für den Dualismus konstitutiven Aspekt des Cartesianismus eingehen, nur insofern<br />
er den Menschen betrifft, also den Hintergrund bildet a) für die Idee und dann auch die Kritik freischwebender<br />
Subjektivität und b) für das Standardmodell der Handlung als intentional „verursachtem“<br />
Verlauf.<br />
21 In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Verben des Mentalen gewöhnlich keine Abläufe benennen,<br />
sondern das Vorliegen von Zuständen bezeichnen. Identifiziert man Geistiges mit dem<br />
Mentalen, dann muss demzufolge alles Geistige ein Zustand der individuellen Seele oder des individuellen<br />
Bewusstseins sein, was nun wiederum mit der Unräumlichkeit und Überzeitlichkeit des<br />
Geistigen bzw. der Gehalte des Bewusstseins kollidiert (vgl. hierzu auch Freges Psychologismuskritik<br />
in „Der Gedanke“ und in Grundlagen der Arithmetik).
114<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
wird der Geist als Seele, als individuelles Bewusstsein des Ich aufgefasst. Der<br />
Cartesianismus führt damit zum Individualismus, zum Nominalismus in Fragen<br />
des Geistes. 22 Das notorische ontologische Problem des Geistes scheint damit gelöst:<br />
Geist ist Psyche. Zugleich wird damit eine Erklärungs- und Darstellungsnorm<br />
der Rede über Geistiges gesetzt: Überindividuelles ist auf Individuelles zurückzuführen,<br />
Objektivität auf Subjektivität. 23 Damit ist zweitens auf engste verknüpft,<br />
was man die Psychologisierung des Geistes nennen kann. 24 Das bedeutet,<br />
dass man, um die Gehalte, die Funktionsweise, die Reichweite und die Grenzen<br />
des Geistes zu erfassen, das Seelenleben der einzelnen Person(en) betrachteten<br />
muss. Die wichtigste (und in der Konsequenz einzige) Quelle der Kenntnis über<br />
den, nun auf das seelische Innenleben geschrumpften, Geist ist die Introspektion,<br />
die nach innen gerichtete Wahrnehmung: Ich weiß, was in meinem Inneren vorgeht,<br />
die Tätigkeiten meines Geistes sind mir unmittelbar bewusst, und ich kann<br />
meine Aufmerksamkeit darauf richten. Das Denken „wird deshalb eher und sicherer<br />
als die körperlichen Gegenstände erkannt; denn man begreift es schon,<br />
während man über alles Andere noch zweifelt.“ 25 Damit wird ein weiterer Zug<br />
des Cartesianismus deutlich: Der Geist ist privat – nur ich kann wissen, was in<br />
meinem Inneren vorgeht – und zwar aus begrifflichen Gründen. Denn die<br />
Introspektion, welche die Erkenntnisart der Vorgänge und Zustände des Geistes<br />
darstellt, ist als Selbstbeobachtung des Inneren anderen per definitionem nicht<br />
zugänglich. Deshalb ist das Individuum mit Blick auf sein Seelenleben erste und<br />
22 Gegen die Deutung des Cartesianismus als Individualismus spricht auch nicht, dass das cartesianische<br />
Ich als transzendentales Ich gedeutet werden kann. Denn worauf es ankommt ist, wie diese<br />
transzendentalen Bedingungen der Teilnahme an menschlichen Praxen realisiert sind: Als quasinatürliche<br />
Kompetenzen eines jeden einzelnen Subjektes, gewissermaßen als das natürliche oder angeborene<br />
Allgemeine beliebiger Ichs, oder als Resultat der Aneignung kultureller Formen? Sind sie<br />
mittels (im logischen Sinne) universeller oder mittels generischer Sätze zu beschreiben? Was eine<br />
transzendentale Bedingung von Subjektivität ist, gilt per definitionem für jedes einzelne Individuum,<br />
die umgekehrte Richtung der Implikation gilt nicht. Auch wenn die transzendentale Deutung<br />
interessanter ist, scheint mir, dass Descartes Behauptungen eher als universelle zu lesen sind.<br />
Ich will aber an dieser Stelle nicht um die Lesart streiten, weil es mir um die Charakterisierung eines<br />
Theorietypus geht, an dessen Tradition sich einflussreiche Hauptrichtungen des gegenwärtigen<br />
Philosophierens orientieren, und dieser Theorietypus zielt auf universelle Sätze.<br />
23 Als Ausweg aus dieser Ungereimtheit bietet sich an, Objektivität auf Intersubjektivität zurückzuführen.<br />
Die Frage ist dann allerdings, in welchem Sinne Intersubjektivität zu verstehen ist. Die<br />
bloß zufällige Allgemeinheit von Vorstellungen, Normen etc. in einer Population jedenfalls genügt<br />
nicht. Es bedarf vielmehr einer von den individuellen Vorstellungen unabhängigen, „idealen“ Intersubjektivität,<br />
an der sich die Richtigkeit faktischer Übereinstimmungen bemisst. Diese stellt<br />
sich nicht einfach ein, sondern muss vor dem Hintergrund gemeinsamer Traditionen gemeinsam<br />
hergestellt und anerkannt werden. Ich komme darauf zurück.<br />
24 Obwohl Individualismus und Psychologismus in der Philosophie des Geistes faktisch eng zusammenhängen,<br />
oft bis zur Unkenntlichkeit ihres Unterschiedes, ist es sinnvoll, sie zu unterscheiden.<br />
Der Individualismus betrifft die Form möglicher Erklärungen und Theorien, er entscheidet die<br />
Frage, was Explanans und was Explanandum ist; der Psychologismus bestimmt ihren materialen<br />
Gehalt. Der Mentalismus als prima facie plausibelste Verbindung dieser Theoriedimensionen verknüpft<br />
das individualistische Theorieformat mit dem Gehalt psychologischer Begriffsbildungen.<br />
Der Intentionalismus ist dann der ins Handlungstheoretisch-Pragmatische gewendete Mentalismus.<br />
25 Prinzipien I/8
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 115<br />
letzte Instanz – die vieldiskutierte Autorität der ersten Person ist deshalb nur eine<br />
andere Weise, Grundzüge der cartesianischen Konzeption des Geistes zu artikulieren,<br />
insbesondere die (nur scheinbar unproblematische) Unmittelbarkeit des<br />
Selbstbewusstseins und seiner Gehalte.<br />
Es kann nun eingewandt werden, dass es ein Unterschied sei, ob der Geist<br />
privat ist oder ob das Subjekt nur privilegierten Zugang zu seinem Geist hat, etwa<br />
per Introspektion. Der privilegierte Zugang folge aus der Privatheit, aber<br />
nicht umgekehrt. Deshalb wäre die These vom privilegierten Zugang schwächer<br />
als die der Privatheit des Geistes und würde deshalb bestimmte, noch zu benennende<br />
Konsequenzen nicht zulassen. Allerdings ist dieser Unterschied nicht<br />
plausibel zu machen, weil die Privatheit des Seelenlebens ja gerade über den privilegierten<br />
Zugang definiert wird – das ist der entscheidende Schritt, nicht die<br />
folgende Hypostasierung zur privaten Seelensubstanz. Entweder heißt „privilegiert“<br />
soviel wie „exklusiv“, dann macht es keinen Unterschied. Oder es heißt<br />
soviel wie: „Ich habe den ersten (primären) Zugriff, ich kann mich festlegen“,<br />
dann ist das zunächst eine grammatische Behauptung. Liest man sie als Behauptung<br />
über den Geist, dann präsupponiert die Rede vom privilegierten Zugang, es<br />
gäbe auch andere, ggf. weniger verlässliche Zugänge. Damit wären das Bewusstsein<br />
und seine Gehalte aber auch anderweitig, und das bedeutet auch: anderen,<br />
zugänglich, d.h. sie wären nicht privat, und das ist dann keine Frage des Grades<br />
der Gewissheit, sondern eine begriffliche Feststellung. Dann müsste es aber<br />
möglich sein, dass mich andere aufgrund externer Kriterien in meinen Festlegungen<br />
korrigieren können – dann habe ich im Widerspruch zur Voraussetzung<br />
aber keinen primären Zugriff, kein Privileg der Festlegung. Da im Rahmen des<br />
Cartesianismus jede Fremdzuschreibung von Intentionen, ja, von Bewusstsein<br />
überhaupt, notwendig ungewiss, bloßes Vermuten ist, artikuliert die These vom<br />
privilegierten Zugang im Rahmen des Cartesianismus keinen Unterschied zur<br />
Privatheit, weil er der einzig mögliche Zugang zum Bewusstsein bleibt. Ohne externe<br />
Kriterien der Identifikation geistiger Zustände fallen die Behauptung der<br />
Privatheit des Geistes und die Behauptung eines privilegierten Zugangs daher<br />
zusammen. Was bedeutet also die Rede von privilegierten Zugang, wenn es prinzipiell<br />
keinen gleichwertigen alternativen Zugang gibt? Sie ist im Rahmen des<br />
Cartesianismus tautologisch, Privatheit des Geistes und privilegierter Zugang<br />
zum Geist sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Sinnvoll ist die These<br />
vom privilegierten Zugang und damit von der Autorität der ersten Person erst<br />
vor dem Hintergrund anderer, ggf. konkurrierender Möglichkeiten der Zuschreibung<br />
intentionaler Gehalte zur Person, die mit der Privatheit des Geistes nicht<br />
vereinbar sind.<br />
3. Das cartesianische Erbe<br />
Im folgenden will ich einige Konsequenzen der cartesianischen Konzeption darstellen.<br />
Wie ich noch zeigen werde, handelt es sich dabei gleichermaßen auch um
116<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
das Erbe Lockes. Dabei geht es mir ausdrücklich nicht um eine Interpretation der<br />
Schriften Descartes’ oder Lockes. Vielmehr geht es mir um die Charakterisierung<br />
eines Theorietypus in der Philosophie und einiger seiner kaum beachteten Folgen<br />
auf Gebieten, zu denen sich Descartes nicht explizit bzw. unter einem anderen<br />
Interesse und v.a. vor einem anderen Hintergrund geäußert hat. Etwa ist für Descartes<br />
das Problem des Handelns vor allem ein Problem des „richtigen“ Handelns,<br />
also der Rationalität materialer Handlungsmaximen, nicht ein Problem der<br />
Identifikation und Möglichkeit von Handlungen selbst. Diese werden als unproblematisch<br />
unterstellt und stehen daher nicht im Fokus des Interesses. (So wird die<br />
Übereinstimmung von Einsicht und Handlung, ebenso wie die von Geist und<br />
Welt, also rationale Erkenntnis und rationales Handeln, letztlich von Gott garantiert.)<br />
Ähnlich unproblematisch ist für Descartes die Sprache und die sprachliche<br />
Verfasstheit des Geistes. Mich interessiert aber, was aus Descartes Konzeption<br />
wird, wenn diese Hintergrundsgewissheiten entfallen.<br />
3.1 Handlung und Interpretation, Unvermeidlichkeit des Solipsismus<br />
Wenn Geist und Welt, Inneres und Äußeres auseinanderfallen, dann hat das auch<br />
Konsequenzen für den Begriff der Handlung. Insbesondere erscheint die Übereinstimmung<br />
von Intention und Resultat der Handlung als bloß zufällig, als<br />
„Gnade des Schicksals“ (Wittgenstein). Intention und Handlungsergebnis sind<br />
logisch voneinander unabhängig. Wäre das Resultat von der Absicht des Akteurs<br />
abhängig, dann müsste die Absicht im Widerspruch zur Voraussetzung in den Bereich<br />
der Ursachen, also zur äußeren Welt gehören. 26 Eine Reaktion auf dieses<br />
Dilemma ist, den Dualismus anzugreifen und Absichten zu Ursachen des Handels<br />
zu erklären, also den Geist in die Kausalreihen der äußeren Welt einzuordnen,<br />
was der Freiheit und Spontaneität des Geistes widerspräche. 27 Mit der logischen<br />
Unabhängigkeit (bzw. der bloß empirischen Abhängigkeit) von Absicht<br />
und Ergebnis der Handlung lassen sich nun verschiedene lebensweltliche Erfahrungen<br />
in das cartesianische Bild integrieren. Zum einen, dass anscheinend jedes<br />
Tun auf verschiedene, teilweise sogar ausschließende Weisen gedeutet werden<br />
kann, also das Problem der richtigen Beschreibung oder „Rationalisierung“ 28 der<br />
Handlung, zum anderen die Erfahrung, dass Handlungen scheitern können. Beides<br />
wird zu notwendigen, aus begrifflichen Gründen geltenden, Eigenschaften<br />
von Handlungen. Auch daraus zieht der moderne Cartesianismus prima facie<br />
26 Zur Frage der Unabhängigkeit von innerem und äußeren Aspekt der Handlung s. auch G. H. v.<br />
Wright: Erklären und Verstehen. (3. Aufl.). Frankfurt a.M.: Hain.1991, S. 89ff.<br />
27 Die Lösung, „Kausalität aus Freiheit“ zu postulieren, ist ebenso fragwürdig, eine Scheinlösung, die<br />
das Problem nur verschiebt, indem anstatt zweier Substanzen zwei Redebereiche eingeführt werden,<br />
die nicht miteinander kompatibel sind. Bei Kant führt sie bekanntlich zur strikten Trennung<br />
von empirischen und intelligblen Charakter, zur Lehre vom Menschen als Bürger zweier Welten.<br />
28 Vgl. Davidsons Aufsatz „Handlungen, Gründe und Ursachen.“ Aufgrund seines die Fragestellungen<br />
der handlungstheoretischen Diskussion prägenden Einflusses, soll der Verweis auf Davidson<br />
hier als paradigmatisches Beispiel für die Lebendigkeit cartesianischen Denkens genügen.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 117<br />
Plausibilität, denn in der Tat kann jede einzelne Handlung scheitern oder nichtintendierte<br />
Nebenfolgen bis hin zur Verkehrung der Absicht in ihr Gegenteil hervorbringen.<br />
Dies gilt erst recht in sozialen Kontexten, in denen die Handlungsergebnisse<br />
vom Handeln anderer Personen abhängen.<br />
Um unter diesen Voraussetzungen noch sinnvoll von bestimmten Handlungen<br />
sprechen zu können, wird ein Element der Handlung zu ihrer Substanz erklärt,<br />
nämlich ihr innerer Aspekt, die Absicht. Damit wird die Handlung auf die Abwägung<br />
möglicher Resultate, die Festlegung auf eine Alternative und den Entschluss,<br />
die Handlung auszuführen, also auf die Intention des Akteurs, reduziert,<br />
weil die Handlungsresultate zur „äußeren Welt“ gehören und damit dem Zugriff<br />
des Subjektes entzogen sind. Was in der Urheberschaft und Verantwortung des<br />
Akteurs liegt und damit einzig zählt, ist seine Absicht, die als „geistige Ursache“<br />
den weiteren Verlauf in Gang setzt und die einzige Konstante inmitten der Vielfalt<br />
möglicher Handlungsverläufe, -resultate und -interpretationen darstellt. Sie<br />
macht demnach das Wesen der Handlung aus und ist das relevante Identifikations-<br />
und Individuationskriterium für Handlungen. 29 Das „Denken“ ist demnach<br />
die Substanz auch des Handelns. Da aber nur der Akteur weiß, was in seinem Inneren<br />
vorgeht, welche Absichten er verfolgt, welche Motive ihn zu einer Handlung<br />
bringen etc., kann letztlich nur der Akteur selbst wissen, welche Handlung<br />
er vollzogen hat. Unter dieser ‘psychologischen’ Deutung des Geistes werden<br />
Absichten zu (privaten) geistigen Zuständen, die Angabe der Absicht bzw. des<br />
Handlungsgrundes wird entsprechend als Bericht über einen inneren Zustand gedeutet,<br />
welcher der Handlung als ihre Ursache vorausgeht.<br />
Mit der Trennung der Absicht vom Vollzug und vom Resultat der Handlung<br />
wird der Begriff der Handlung aber unterminiert. Wenn Handeln wesentlich als<br />
(rationales) Entscheiden und der Vollzug der Handlung als kontingent, d.h. nicht<br />
als bestimmte Ausführung zur Handlung zugehörig betrachtet wird, dann fallen<br />
falsche Handlung und falsche Entscheidung zusammen. Eine falsche oder unrichtige<br />
Ausführung kann es dann nicht geben bzw. diese ist bloß kontingent,<br />
dem Modus des Handelns nicht wesentlich. Aber auch wenn Absicht und Vollzug<br />
bzw. Resultat jeder einzelnen konkreten Handlung auseinanderfallen können, ist<br />
es unsinnig anzunehmen, beliebige, d.h. alle Handlungen könnten in ihrer Ausführung<br />
scheitern, weil dann eine Zuordnung von Zweck bzw. Absicht und Ausführung<br />
bzw. Resultat der Handlung nicht mehr möglich wäre; es wäre dann unsinnig,<br />
von der Zweckmäßigkeit von Handlungen und damit vom Handlungssinn<br />
zu sprechen. Wenn das Resultat meiner Handlung H mit meiner Handlungsabsicht<br />
nur zufällig verbunden ist, d.h. wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass<br />
die Ausführung von H gewöhnlich zum gewünschten Resultat führt, dann ist H<br />
keine mögliche Handlung, weil das Resultat als realisierte Absicht bzw. vorweggenommene<br />
Erfüllung zur Handlung gehört. Da nach Voraussetzung aber für be-<br />
29 Noch Kant teilt diesen Handlungsbegriff: Was zählt, ist die Absicht.
118<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
liebige Handlungen gelten soll, dass Absicht und Resultat voneinander logisch<br />
unabhängig sind, ist der cartesianische Handlungsbegriff inkonsistent.<br />
Freilich werden die Konsequenzen der logischen Unabhängigkeit von innerem<br />
und äußerem Aspekt der Handlung gewöhnlich nicht in dieser Weise zugespitzt.<br />
30 Bleibt man aber, wie das bewusstseinsphilosophische Handlungsmodell<br />
von Descartes über Kant bis Davidson nahelegt, dabei, dass Handlungen durch<br />
Intentionen individuiert werden, die als geistige Zustände des handelnden Individuums<br />
zugleich die Ursache der Handlung darstellen sollen, dann ist es inkonsequent,<br />
diese Folgen des Modells zu ignorieren.<br />
Eine wichtige Konsequenz ist nun der Solipsismus, d.h. der Skeptizismus mit<br />
Blick auf die Existenz anderer Subjekte, also (selbst)bewusster und handelnder<br />
Wesen, der unmittelbar aus der Privatheit des Geistes und damit der Handlung<br />
folgt. Denn die äußere Wirklichkeit können wir nur mittelbar erkennen, sie ist<br />
deshalb ungewiss, während uns unser Bewusstsein unmittelbar gegeben ist. Das<br />
einzig Gewisse ist demnach unser Selbstbewusstsein. Auch wenn man von dieser<br />
generellen Skepsis gegenüber dem Weltwissen absieht und hier auf grundlegende<br />
Evidenzen und die Richtigkeit der analytisch-synthetischen Methode (sowie darauf,<br />
dass Gott kein Betrüger ist) vertraut, bleibt das Problem des Bewusstseins<br />
anderer akut. Denn das Handeln anderer ist uns zunächst nur als körperliches<br />
Verhalten gegeben. Als Handlung wird dieses nach dem oben skizzierten Handlungsmodell<br />
nur durch die Zuordnung entsprechender geistiger Zustände qualifiziert.<br />
Da uns das Bewusstsein anderer aber nicht direkt zugänglich ist, können<br />
wir hier nur analogisches Wissen haben, und zwar ohne dass es für dessen Richtigkeit<br />
ein Kriterium geben könnte. Denn die Tatsachen der Körperwelt können<br />
nichts über den Geist besagen. Folglich bleibt mir der Geist anderer Menschen<br />
verschlossen, denn von ihnen kenne ich ja nichts als ihre „Außenseite“, ihren<br />
Körper und dessen wahrnehmbares Verhalten. Da nun die Körperwelt vollständig<br />
„mechanisch“ beschrieben werden kann und auch der Mensch mit Blick auf sein<br />
äußeres Verhalten als „Maschine“ aufgefasst wird, ist die Annahme anderer Bewusstseine<br />
und damit auch anderer Subjekte nicht zwingend, selbst unter der<br />
Annahme vollständiger Kenntnis aller „äußeren“ Tatsachen. Es ist demnach nicht<br />
nur eine Frage der Interpretation, welche Handlung der andere ausführt, sondern<br />
auch, ob er überhaupt handelt. Der entscheidende systematische Ansatzpunkt für<br />
solipsistische Konsequenzen, nicht nur bei Descartes, ist demnach, dass die<br />
Richtigkeitskriterien für Behauptungen über seelische Zustände bewusstseinsimmanent<br />
sind, d.h. im behauptenden Subjekt selbst liegen, und dies ist eine direkte<br />
Folge der Bestimmung des Geistes als individuelles Bewusstsein.<br />
30 Bedenken sollte man dabei aber, dass Descartes den Zweifel selbst auf die Spitze treibt, zwar nicht<br />
mit Blick auf den Begriff der Handlung, die in seinen Überlegungen ohnehin nur eine untergeordnete<br />
Rolle spielt, wohl aber mit Blick auf das Subjekt selbst, welches sich als reines Bewusstsein<br />
nicht einmal seines Leibes sicher sein kann. Am Begriff der Handlung werden die bizarren Konsequenzen<br />
der Konzeption nur augenfällig, die akzeptabel oder jedenfalls nicht unsinnig erscheinen,<br />
solange man im Epistemischen verbleibt.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 119<br />
Die angebliche (Selbst)Widerlegung des Solipsismus durch den performativen<br />
Widerspruch seiner Mitteilung verfehlt ihren Gegenstand. Denn der Solipsismus<br />
als Artikulation einer Konsequenz der Privatheit des Geistes ist auch als<br />
Selbstverständigung des einsamen Subjektes denkbar. Er wird jedenfalls nicht<br />
dadurch erschüttert, dass er mitgeteilt und verstanden werden kann, solange nicht<br />
gezeigt ist, ob und wie kommunikatives Verstehen überhaupt möglich ist. Der<br />
Solipsismus kann nur dadurch erschüttert werden, dass gezeigt wird, dass das solipsistisch<br />
gedachte Subjekt sich selbst nicht verstehen kann, dass Bedeutung und<br />
intentionaler Gehalt vom Standpunkt eines isolierten Individuums her nicht verständlich<br />
zu machen sind. Gerade das wird vom Privatsprachenargument geleistet.<br />
Paradoxerweise gründet auf der Psychologisierung des Geistes ein ganzes<br />
Forschungsprogramm, welches mit den entsprechenden, von Descartes geerbten,<br />
Problemstellungen noch immer die Diskussion um Mensch, Geist und Gesellschaft<br />
dominiert. Ein zentraler Punkt ist dabei die Auseinandersetzung mit Fragen<br />
der Sprache, der Bedeutung und des Verstehens. Ich werde deshalb am Beispiel<br />
Lockes als einem der Ahnen der Sprachphilosophie darstellen, wie die begrifflichen<br />
Entscheidungen des Cartesianismus auf sprachphilosophische Positionen<br />
durchschlagen. Anschließend will ich auch für andere Gebiete der Philosophie<br />
skizzieren, wie das Descartes-Lockesche Paradigma deren Fragestellungen<br />
bis heute beeinflusst.<br />
3.2 Lockes Erweiterung des Cartesianismus<br />
John Lockes Ausarbeitung des Cartesianismus für das Problem der Bedeutung<br />
und der sprachlichen Verständigung 31 , ist bis heute ein, wenn nicht das, Paradigma<br />
des Verhältnisses von Geist, Sprache und Kommunikation. Dabei spielt es<br />
keine Rolle, dass Descartes den Sinnen misstraut, während Locke meint, dass die<br />
Sinne letztlich der einzige Garant der Wahrheit seien, dass Descartes die Existenz<br />
„angeborener Ideen“ annimmt, während Locke diese für Hirngespinste hält<br />
und dergleichen mehr. Dies sind nur Unterschiede der Deutung und Gewichtung<br />
von Phänomenen, die sowohl Descartes als auch Locke anerkennen, also unterschiedliche<br />
Positionen innerhalb eines Fragehorizontes mit gemeinsamen systematischen<br />
Präsuppositionen und Grundunterscheidungen.<br />
Bekanntlich überbrückt Locke die Kluft von Geist und Welt, indem die Erfahrung<br />
als deren Mittler an zentrale Stelle gerückt wird. Freilich wird Erfahrung<br />
bei Locke auf Empfindungen reduziert. Diese sollen einerseits sachhaltig sein,<br />
indem sie per Affizierung der Sinne durch die Dinge der Außenwelt (sensation)<br />
gerade diese Dinge „repräsentieren“ oder „vorstellen“, andererseits gehören sie<br />
zum Bewusstsein des Individuums. Zwar ist mir – ganz cartesianisch – nur mein<br />
31 J. Locke: Essay concerning human understanding (im folgenden: Versuch) (Zitiert nach der dt. Ü-<br />
bers. von J. H. von Kirchmann: Versuch über den menschlichen Verstand. Berlin: L. Heimann<br />
1872/73).
120<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Bewusstsein unmittelbar gegeben, entsprechend ist an der Objektivität der auf<br />
Basis der Empfindungen und deren Verarbeitung durch den Verstand (reflection)<br />
gebildeten „Vorstellungen im Geiste“ (ideas) zu zweifeln, aber gerade diese<br />
skeptische Not wird zur epistemischen Tugend erklärt: Ich mag mich darin täuschen,<br />
ob diese Rose wirklich rot ist oder darin, ob da wirklich eine Rose ist, a-<br />
ber ich kann mich nicht darin täuschen, dass ich die Vorstellung einer roten Rose,<br />
eine Rot-Empfindung oder ähnliches habe. Wie selbstverständlich wird dabei unterstellt,<br />
dass das Subjekt der Erkenntnis das einzelne Individuum ist, und entsprechend<br />
ist die zentrale Fragestellung der traditionellen Erkenntnistheorie bis<br />
heute, wie man vom individuellen Bewusstsein zu objektiver Erkenntnis gelangt.<br />
Der Ausgangspunkt bleibt die Unmittelbarkeit und Evidenz des Eigenpsychischen,<br />
das dem Individuum bewusste Wahrnehmen, Denken, Wollen. 32<br />
Wie kann unter diesen Voraussetzungen Sprache, Bedeutung und Verstehen<br />
konzipiert werden? Allein die Verwendung von Lauten reicht nach Locke „zur<br />
Sprache nicht hin; denn auch Papageien und anderen Vögeln kann das Bilden<br />
von artikulierten Lauten angelernt werden, obgleich sie auf keine Weise der<br />
Sprache fähig sind.“ 33 Vielmehr sei es „erforderlich, die Laute als Zeichen innerer<br />
Auffassungen zu gebrauchen und sie zu Zeichen von Vorstellungen zu machen,<br />
die Anderen dadurch erkennbar würden.“ 34 Da es Vorstellungen aber nur<br />
im individuellen Bewusstsein gibt, können „die Worte eigentlich und unmittelbar<br />
nur die Vorstellungen des Sprechenden bezeichnen“. 35 M.a.W.: Wörter erhalten<br />
dadurch Bedeutung, dass ihnen ein Individuum Bedeutung verleiht, indem es etwas<br />
mit ihnen meint. Da Bewusstsein bei Locke, gut cartesianisch, „die Wahrnehmung<br />
dessen, was in der eignen Seele vorgeht“ 36 ist, beruht sprachliche Bedeutung<br />
auf der privaten Zuordnung von Lauten zu Vorstellungen im Geiste. Dabei<br />
muss der Sprecher etwas Bestimmtes meinen, d.h. „klare und deutliche“ Vorstellungen<br />
mit den Wörtern verbinden, ansonsten ist deren Bedeutung unbe-<br />
32 Die „Sinnesdatentheorie“ ist eine Konstante der Erkenntnistheorie seit Locke. Insofern gibt es,<br />
vermittelt über Lockes Versuch der Bewältigung der cartesianischen Problemstellung, eine direkte<br />
Linie von Descartes bis zum Logischen Positivismus des Wiener Kreises und seinen „Basissätzen“,<br />
Carnaps „Konstitutionssystem“ in Der logische Aufbau der Welt, dem Versuch, die Welt vom<br />
Eigenpsychischen her zu rekonstruieren, über Quines Word and Object, dem Versuch, unsere<br />
Kenntnisse der Welt von den „sensorischen Reizungen der Körperoberfläche“ her verständlich zu<br />
machen, bis hin zu neueren Diskussionen des „Basisproblems“. Freilich wird Descartes’ „Rationalismus“<br />
gewöhnlich als „metaphysisch“ abgelehnt. Aber dabei wird übersehen, in welchem Maße<br />
diese Kritik sowohl von der Problemstellung als auch von den <strong>Prämissen</strong> Descartes’ abhängt. Das<br />
betrifft auch noch die Gegenentwürfe zum empiristischen Fundamentalismus, etwa die Kohärenztheorie<br />
des Wissens. In Descartes’ Terminologie könnte man sagen: Die Erfahrung legt uns nicht<br />
auf eine Theorie fest, und wenn Gott als Garant der Objektivität der Ideen und Axiome der Vernunft<br />
ausfällt, dann sind auf Basis derselben „Daten“ prinzipiell verschiedene Weltauffassungen<br />
möglich (vgl. dazu die sog. Quine-Duhem-These von der Unterbestimmtheit der Theorie durch die<br />
Daten, s. dazu auch Quine: Zwei Dogmen des Empirismus).<br />
33 Versuch III/1, §1<br />
34 Versuch III/1, §2<br />
35 Versuch III/2, §4<br />
36 Versuch II/1, §19
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 121<br />
stimmt, genauer: sie hätten keine Bedeutung, weil die Zuordnung zu genau einem<br />
geistigen Gegenstand scheitern würde. 37 Diese Zuordnungen liegen in der<br />
Willkür des einzelnen Individuums. Ihre Festigkeit hängt nun vom Gedächtnis<br />
ab, davon, dass sich der Sprecher der Zuordnung seiner inneren Vorstellungen<br />
(oder Vorstellungsbündel) zu den äußeren, öffentlich wahrnehmbaren Zeichen<br />
richtig erinnert.<br />
Diese Überlegungen Lockes zum Zusammenhang von Geist und Sprache,<br />
von Bedeutung und Zeichen, bilden den systematischen Hintergrund der Idee einer<br />
Privatsprache oder Sprache des Geistes. Diese ist nicht ein zusätzliches Konstrukt,<br />
sondern die systematische Voraussetzung des Modells. Nach Locke sind<br />
nur klare und deutliche, d.h. bestimmte Vorstellungen im Geiste tatsächlich I-<br />
deen. Die Bestimmtheit von Vorstellungen und Vorstellungsbündeln, d.h. die<br />
Möglichkeit von Ideen, ist aber daran gebunden, dass sie mit Wörtern als deren<br />
sinnlichen Ankerpunkten verknüpft sind, 38 zum einen aus mnemotechnischen<br />
Gründen, zum anderen als das Vehikel der Bildung komplexer und dann auch<br />
abstrakter Ideen, die, weil ihnen nichts sinnlich Wahrnehmbares entspricht, ohne<br />
sprachliches Zeichen keinen Halt hätten. Ohne Wörter keine bestimmten Ideen. 39<br />
In diesem (und nur in diesem) Sinne ist das Denken auch bei Locke an die Sprache<br />
gebunden. Da Denken aber nun ein innerer, privater Vorgang der Verknüpfung<br />
von Ideen ist und die Zuordnung von Wort und Idee in der Willkür des Individuums<br />
liegt, muss es sich bei der Sprache des Denkens bzw. des Geistes um<br />
eine Privatsprache handeln. Die Idee der Privatsprache ist demnach eine zentrale,<br />
wenn auch nicht explizit ausgesprochene Voraussetzung des cartesianischlockeschen<br />
Bildes. Als unproblematischer Sinnhintergrund des Modells steht sie<br />
für die Bestimmtheit der Ideen und damit die Möglichkeit rationalen Denkens.<br />
Nun können Ideen nicht direkt vermittelt werden, denn<br />
„wenn auch Jemand viele und solche Gedanken hat, die Anderen<br />
ebenso viel Nutzen und Vergnügen wie ihm selbst gewähren könnten,<br />
so sind sie doch alle in seiner Brust, unsichtbar, den Anderen<br />
verborgen und können sich äusserlich nicht zeigen.“ 40 „Es war also<br />
außerdem noch die Fälligkeit erforderlich, die Laute als Zeichen<br />
innerer Auffassungen zu gebrauchen und sie zu Zeichen von Vorstellungen<br />
zu machen, die Anderen dadurch erkennbar würden,<br />
37 Dies ist eine spezifische Art der Gegenstandstheorie der Bedeutung. Auf die Probleme dieser Theorie,<br />
soweit sie sich aus der Idee einer eindeutigen Zuordnung von Wörtern zu Gegenständen ergeben,<br />
will ich hier aber nicht weiter eingehen, weil, wie das Privatsprachenargument zeigt, schon<br />
die Prämisse, es gäbe solche privaten geistigen Gegenstände, nicht haltbar ist.<br />
38 S. Versuch III/2, §1<br />
39 Locke sieht dies so v.a. für Ideen gemischter Modi. Aber diese These gilt nach seinen <strong>Prämissen</strong><br />
auch für allgemeine Ideen, für beliebige Abstrakta (und alle Wörter beziehen sich auf Abstrakta)<br />
als Produkte des Verstandes, der die Wörter als Außenhalt und Stabilisator der Ideen braucht. (vgl.<br />
Versuch III/5, §10).<br />
40 Versuch III/2, §1
122<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
damit die Menschen ihre Gedanken einander mittheilen konnten.“<br />
(Hervorhebungen von mir) 41<br />
Die Notwendigkeit der Artikulation der Gedanken ergibt sich aus dem Bedürfnis<br />
der Kommunikation, die Sprache ist deren Instrument. Der Sprecher ordnet<br />
seinen Gedanken öffentlich, d.h. als Körperbewegungen, wahrnehmbare Zeichen<br />
der Sprache zu, der Hörer interpretiert diese Zeichen, um sich die Gedanken<br />
des Sprechers, das Gemeinte, aus dem Gehörten zu erschließen. Kommunikation<br />
ist demnach zweifache Übersetzung: Der Sprecher „übersetzt“ was er meint, also<br />
innere Zustände und Intentionen, in die öffentlich wahrnehmbare Zeichen (einer<br />
dann öffentlichen Sprache) 42 , der Hörer interpretiert diese Zeichen im Bereich<br />
seiner inneren Zustände und erschließt sich damit die Intentionen des Sprechers.<br />
Erfolgreich ist Kommunikation dann, wenn der Hörer die Intentionen des Sprechers<br />
richtig erschließt, wenn er versteht, was der Sprecher mit seinen Worten<br />
meint. Äußerungen haben Bedeutung, sofern sie eine Sprecherbedeutung vermitteln.<br />
Damit hat Locke ein Modell sprachlicher Verständigung etabliert, das in der<br />
einen oder anderen Form das Basismodell beinahe jeder neueren Kommunikationstheorie<br />
darstellt 43 und aufgrund seiner Entsprechung mit dem alltäglichen Erleben<br />
der sprachlichen Verständigung hohe prima facie Plausibilität beanspruchen<br />
kann. Denn gewöhnlich kann der Sprecher bei Missverständnissen korrigierend<br />
eingreifen: „Ich meinte x, nicht y“, und auch der Hörer erkundigt sich normalerweise<br />
nicht nach der konventionellen Bedeutung von Ausdrücken, sondern<br />
er fragt, wie der Sprecher etwas meint. (Aus dem Blick gerät dabei, dass diese<br />
Korrekturen und Vergewisserungen immer schon ein hohes Maß gelingender<br />
Verständigung voraussetzen.) Im Zentrum steht daher der Sprecher, nicht die Interaktion<br />
zwischen einem Sprecher und einem Hörer. Sprachliche Konventionen<br />
und Regeln werden als im Prinzip verzichtbares Hilfsmittel der Verständigung<br />
aufgefasst, sie sind ausgehend von Sprecherintentionen und Gewohnheitsbildung<br />
zu rekonstruieren, die intentionalen Gehalte sind der Kommunikation vorausgesetzt<br />
und deshalb grundsätzlich nicht an eine öffentliche Sprache gebunden. Gäbe<br />
es die Möglichkeit direkter Gedankenübertragung, wären sprachliche Formen<br />
im Grunde überflüssig. M.a.W.: In diesem Modell liegen Bedeutungen als je individueller<br />
geistiger Gehalt vor jeder Kommunikation und unabhängig von der<br />
Artikulation mittels einer gemeinsamen Sprache fest. 44<br />
41 Versuch III/1, §2<br />
42 Es ist klar, dass dieser Bezug auf eine Sprache, im Gegensatz zu Lockes Grundannahmen, mehr<br />
beinhalten muss, als bloß den Verweis auf vom Individuum willkürlich mit Bedeutung versehene<br />
Zeichen.<br />
43 Verweisen möchte ich hier nur auf das Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation von Shannon/Weaver,<br />
auf die Modelle von Grice, Meggle sowie Searle (etwa in Intentionalität). Ähnlich<br />
sieht A. Wellmer die Rolle Lockes in Sprachphilosophie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004.<br />
44 Genau diese Voraussetzung wird vom Privatsprachenargument als unsinnig ausgewiesen. Die zentrale<br />
Frage hierbei ist, wie die geistigen Gehalte unabhängig von einer öffentlichen Bewertungsund<br />
Kontrollpraxis individuiert werden können.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 123<br />
Am Beispiel Lockes wird der systematische Zusammenhang zwischen intentionalistischen<br />
bzw. mentalistischen <strong>Prämissen</strong>, einer instrumentalistischen Auffassung<br />
der Sprache und dem Interpretationsmodell des Verstehens deutlich:<br />
Wenn es nur einen äußerlichen, instrumentellen Zusammenhang gibt zwischen<br />
dem, was ein Sprecher meinen, und dem, was er sagen kann, und wenn Verstehen<br />
auf die Erkenntnis des Gemeinten hinausläuft, dann muss Verstehen in der<br />
einen oder anderen Weise als Interpretation der Äußerung des Gemeinten aufgefasst<br />
werden. Ein unmittelbares Verstehen (im Medium der Sprache) kann es<br />
nicht geben. Der Hörer erschließt sich das Gemeinte anhand des Gesagten, er ü-<br />
bersetzt in seine Sprache. Folglich setzt jede Interpretation eine Zielsprache voraus,<br />
die schon verstanden sein muss. 45 Da dies nach Voraussetzung nicht die gemeinsame<br />
Sprache sein kann – diese ist ja gerade interpretationsbedürftig –,<br />
muss es sich um die privaten Sprachen der Sprecher und Hörer handeln, letztlich<br />
um jeweils private Sprachen des Geistes. Und umgekehrt ist Interpretation als<br />
Modus des Verstehens erforderlich, wenn äußerer und innerer Aspekt der Handlung<br />
nicht systematisch miteinander verbunden sind, d.h. hier, wenn Sagen und<br />
Meinen prinzipiell auseinanderfallen können. Die Meinenstheorie der Bedeutung<br />
und Interpretationstheorie des Verstehens sind daher nur zwei Seiten derselben<br />
Medaille. Schon Lockes Hörer müssen radikale Interpreten sein. Daher hängt die<br />
systematische Rolle von Kommunikationsmaximen (Grice), des Nachsichtigkeitsprinzips<br />
(Davidson), der Aufrichtigkeitsbedingung (Davidson, Searle) u.a.<br />
Rationalitätsunterstellungen als grundlegende semantische Prinzipien (und nicht<br />
als bloß pragmatische Regeln bzw. Präsumtionen der Vermeidung oder Korrektur<br />
misslingender Kommunikation) von der Akzeptanz des cartesianisch-lockeschen<br />
Theorierahmens ab.<br />
Attraktiv ist Lockes Theorie der Bedeutung und des Verstehens, weil sie anscheinend<br />
mit minimalen <strong>Prämissen</strong> und einer sparsamen, nämlich individualistischen,<br />
Ontologie auskommt: Es wird nicht mehr gefordert, als dass Vorstellungen,<br />
oder allgemeiner: intentionale Gehalte, von dem, der sie hat, benannt werden<br />
können. Damit wird ein „drittes Reich“ der Bedeutungen bzw. Sinngehalte<br />
überflüssig, denn Bedeutungen sind Schöpfungen des individuellen menschlichen<br />
Verstandes, es gibt sie nicht unabhängig vom individuellen menschlichen<br />
Geist. Auch der Begriff des Verstehens als Herstellung der Korrespondenz der<br />
„Ideen“ von Sprecher und Hörer scheint plausibel: Verstehen ist ein aktiver Pro-<br />
45 Interpretation wird im Interpretationsmodell des Verstehens als „Übersetzen in ‚meine‘ Sprache“<br />
erklärt. (A. Wellmer: Verstehen und Interpretieren. In: H. J. Schneider/M. Kroß (Hrsg.): Mit Sprache<br />
spielen. Die Ordnungen und das Offene nach Wittgenstein. Berlin: Akademie-Verlag, 1999, S.<br />
65). Diese Idee ist auch für die Sprachphilosophie D. Davidsons zentral, der damit in der Tradition<br />
von Descartes und Locke steht. Davidsons Programm ist von besonderer Relevanz, weil er diese<br />
Tradition mit den Mitteln der analytischen Philosophie (in einem engeren Sinne, der sich v.a. über<br />
die Verwendung formaler Methoden und Modelle definiert), insbesondere unter Verwendung der<br />
Prädikatenlogik erster Stufe als universelles Analysemittel, fortsetzt. (Zu den Schwierigkeiten dieser<br />
Konzeption einer „Wahrheitstheorie der Bedeutung“ und der „radikalen Interpretation“ s.<br />
C. Henning: Kausalität und Wahrheit (Diss.), Leipzig 2004)
124<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
zess der Interpretation, der in der Kontrolle der Beteiligten steht und keiner weiteren<br />
Instanzen bedarf. Insbesondere ist er nicht an vorgegebene Formen oder<br />
Regeln gebunden. Zum Zeichen kann alles werden, dem von einem Sprecher mit<br />
der Absicht, etwas zu verstehen zu geben, Bedeutung verliehen wird. Auf diese<br />
Weise sollen dann auch sprachliche Konventionen zirkelfrei, d.h. ohne Rückgriff<br />
auf explizite Vereinbarungen, erläutert werden, nämlich per Gewohnheitsbildung<br />
aufgrund von Kommunikationserfolgen und darauf gründenden wechselseitigen<br />
Verhaltenserwartungen. 46 Die Idee einer handlungstheoretischen Semantik (Grice,<br />
Meggle), nach der sich Konventionalität aus dem wechselseitigen Bezug der<br />
Handlungen rationaler, intentionaler Akteure ergibt, kann nahtlos an Lockes Modell<br />
der sprachlichen Verständigung anschließen.<br />
Das Problem ist freilich, dass das Erfolgskriterium der Lockeschen Kommunikation,<br />
nämlich dass der Hörer versteht, was der Sprecher meint, keines ist,<br />
weil aufgrund der Basisannahmen keine sprecherunabhängigen Identifikationsund<br />
Individuationskriterien für geistige Zustände angegeben werden können.<br />
M.a.W.: Der Hörer kann allenfalls glauben, den Sprecher verstanden zu haben,<br />
ob er ihn tatsächlich versteht, kann er nach den Annahmen des Modells nicht<br />
entscheiden, ja, er kann nicht einmal gute Gründe für einen solchen Glauben geben.<br />
Denn in Lockes Theorie der Bedeutung und des Verstehens wiederholen<br />
sich die Muster des cartesianischen Handlungsbegriffs und der Trennung von Innen<br />
und Außen: Die der Sprache vorgängigen und unabhängig von ihr bestimmten<br />
geistigen Zustände der Person müssen aus ihrem äußeren Verhalten erschlossen<br />
werden. Und hier wie da gilt: Da es für die Zuordnung von Innerem und Äußerem<br />
keine logisch zwingenden Verfahren gibt, bleibt der Akteur bzw. der Sprecher<br />
die letzte Instanz des Sinns der Handlung bzw. der Bedeutung der Äußerung.<br />
47<br />
Für Lockes Modell, ganz allgemein: für jede intentionalistische bzw. mentalistische<br />
oder Meinenstheorie der Bedeutung und damit zugleich für jede Interpretationstheorie<br />
des Verstehens, ergibt sich daraus das Problem, dass die Möglichkeit<br />
des Verstehens nicht erläutert werden kann. Verstehen ist aufgrund der<br />
Privatheit des Geistes letztlich eine Sache des Zufalls, und selbst wenn der Hörer<br />
den Sprecher richtig versteht, kann er sich dessen nicht sicher sein. Denn, so Locke,<br />
jeder kann den Wörtern „offenbar nur seine eigenen Vorstellungen beilegen<br />
46 Das ist das einflussreiche Lewis-Modell sprachlicher Konventionen. Vgl. D. Lewis: Konventionen.<br />
Berlin; New York: de Gruyter, 1975.<br />
47 Gelegentlich werden zur Lösung des Problems Modelle der Induktion, der Wahrscheinlichkeitsbewertung,<br />
der Analogie- und Hypothesenbildung (Simulationstheorie bzw. Theorie-Theorie des<br />
Geistes), der besten Erklärung etc. als Hilfskonstruktionen angeboten, um die skeptischen Konsequenzen<br />
zu vermeiden. Aber: Diese Verfahren setzen immer schon eine Induktionsbasis, Regeln<br />
der Wahrscheinlichkeitsbewertung, sinnvolle Projektionsregeln etc. voraus, die doch gerade in<br />
Frage stehen – andernfalls sind die entsprechenden induktiven bzw. abduktiven Schlüsse wertlos.<br />
Die Ausarbeitung entsprechender detaillierter Kohärenzmodelle ist daher eher eine Verlegenheitslösung,<br />
die dem eigentlichen philosophischen Problem ausweicht – als ob man die Instandsetzung<br />
eines maroden Hauses beim Stuck statt bei den Fundamenten beginnen könnte.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 125<br />
und [sie] nicht als Zeichen einer Vorstellung, die er nicht hat, nehmen“ 48 , d.h.<br />
insbesondere nicht von Vorstellungen, die andere als er selbst haben. Die Wörter<br />
„bezeichnen die Vorstellungen des Menschen nur durch eine rein willkürliche<br />
Verknüpfung, wie daraus erhellt, dass sie bei Anderen (obgleich sie dieselbe<br />
Sprache sprechen) nicht immer dieselbe Vorstellung erwecken, für deren Zeichen<br />
sie gelten, und es kann Niemand die Freiheit genommen werden, Worte mit beliebigen<br />
Vorstellungen zu verbinden, deshalb vermag Niemand zu bewirken, dass<br />
Andere bei dem Gebrauch derselben Worte auch dieselben Vorstellungen haben,<br />
die er selbst hat.“ 49<br />
Die Willkür der sprachlichen Zeichen, ihre prima facie behauptete semantische<br />
Unselbständigkeit bzw. Neutralität gegenüber dem Gemeinten, lässt es<br />
demnach prinzipiell nicht zu, aus ihnen auf die Sprecherbedeutung zu schließen,<br />
d.h. allein anhand der Äußerung verstehen zu können, was der Sprecher meint,<br />
sowenig wie die das äußere Verhalten auf die „wirkliche“ Absicht schließen lässt.<br />
Locke sieht dies nur als marginale Schwierigkeit, nicht als ein Problem, welches<br />
den Ansatz selbst in Frage stellt. Etwa verweist er auf Üblichkeiten, an die sich<br />
zu halten hat, wer verstanden werden will, ohne zu sehen, dass diese Üblichkeiten<br />
erst unter Bezug auf regelmäßig gelingende Kommunikationen erklärt werden<br />
können, um deren Kriterien es gerade geht. An anderer Stelle sieht er im<br />
Problem des Verstehens vor allem ein Problem individueller Rationalität und<br />
terminologischer Disziplin, insbesondere der präzisen Definition der verwendeten<br />
Begriffe, die freilich, wenn sie für sprachliche Verständigungsprozesse von<br />
Nutzen sein sollen, eine gemeinsame Sprache und unproblematische Verständigung<br />
an anderer Stelle, insbesondere mit Blick auf seine einfachen und daher<br />
undefinierbaren einfachen Ideen, schon voraussetzen. Die prinzipiellen Schwierigkeiten<br />
der Annahme privater Intentionen und Bedeutungsfestlegungen sieht<br />
Locke nicht.<br />
Hier scheint sich eine Lösung anzubieten, die an den Instrumentalismus der<br />
Lockeschen Sprachauffassung anknüpft: Die Kommunikanten geben durch<br />
kommunikative Handlungen ihre Absichten zu verstehen, die Sprache ist dazu<br />
nur ein Mittel und muss als solches vom individuellen Handeln in sozialen Kontexten<br />
her verständlich gemacht werden, also als Mittel der Handlungskoordination<br />
und der Kooperation. Die Sprechhandlung ist in erster Linie eine Handlung,<br />
48 Versuch III, 2, §3<br />
49 Versuch III/2, §8, s. auch III/2, §4 und III/10, §22. Deshalb ist im Modell der Verweis auf konventionelle<br />
Bedeutungen nicht stichhaltig (vgl. P. Grice: „Sagen, Meinen, Intendieren“ sowie „Logik<br />
und Konversation“, s. auch Davidsons Begründung der „Autonomie der Bedeutung“ in „Konvention<br />
und Kommunikation“), auch wenn dabei ganz richtig gesehen wird, dass erst ein Standardgebrauch<br />
der Ausdrücke die Möglichkeit eröffnet, dass einer mit der Äußerung von x y meinen<br />
kann. Dabei muss die konventionelle Bedeutung aber selbst erst erklärt werden, und zwar ausgehend<br />
von den Sprecherintentionen, bevor sie in Anspruch genommen werden kann. Locke selbst<br />
sieht darin kein Problem: Konventionen müssten erlernt werden. Damit hat er zweifellos recht, allerdings<br />
in einem anderen Sinne, als er glaubt, sofern Konventionalität mit der willkürlichen Zuordnung<br />
gegebener Bedeutungen zu Zeichen nicht viel zu tun hat.
126<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
genauer: eine instrumentelle Handlung, die auf Resultate abzielt, die außerhalb<br />
der Kommunikation liegen. Kommunikation ist Mittel zum Zweck. Wir verstehen<br />
kommunikative Äußerungen demnach dann (und nur dann), wenn wir verstehen,<br />
was der Sprecher damit bezweckt, also ihren subjektiven Handlungssinn<br />
erkennen. Mithin verstehen wir Sprache, wenn wir Handlungen verstehen. In<br />
diesem Modell kann daher jedes Tun zum kommunikativen Handeln werden, sofern<br />
der Akteur mit seiner Handlung kommunikative Absichten verbindet, und<br />
entsprechend kann alles als Kommunikationsmittel dienen, wenn es vom Sprecher<br />
mit der Absicht verwendet wird, den Adressaten dazu zu bringen, aufgrund<br />
seiner Äußerung etwas zu tun oder zu glauben. 50 Wie die Äußerung zu verstehen<br />
ist, hängt nicht von der konventionellen Bedeutung der Äußerung ab. Vielmehr<br />
kann die Bedeutung einer Äußerung sogar im Gegensatz zu ihrer (im Rahmen<br />
des Konzeptes erst noch zu erläuternden) konventionellen Bedeutung stehen.<br />
Geht man von Lockes Theorie der Sprache und des Verstehens aus und vernachlässigt<br />
ihren cartesianischen Kern, erscheint die pragmatische Erweiterung<br />
des Theorierahmens zunächst plausibel. Vor dem Hintergrund des cartesianischen<br />
Handlungsbegriffs, der auch in diesem Modell unterstellt ist, wird aber<br />
deutlich, dass das Problem nur auf das allgemeinere Problem der Interpretation<br />
von Handlungen, d.h. hier: der Identifikation und Individuation von Intentionen,<br />
verschoben ist, und diese steht vor denselben Schwierigkeiten: dem Auseinanderfallen<br />
von inneren und äußeren Aspekten der Handlung, der Absicht einerseits,<br />
der Ausführung und den Resultaten andererseits. Wie schon bemerkt wurde,<br />
gibt es im Rahmen des cartesianisch-lockeschen Paradigmas aber keine Möglichkeit,<br />
vom äußeren auf den inneren Aspekt der Handlung zu schließen.<br />
Das Problem ist, dass im individualistisch-instrumentalistischen Rahmen<br />
Kommunikation keine gemeinsame Handlung (Kooperation) mit gemeinsamer<br />
Erfolgskontrolle darstellt, in der gemeinsame und daher den Kommunikaten gemeinsam<br />
verständliche Bedeutungen hervorgebracht werden. Vielmehr sind Bedeutungen<br />
der Kommunikation als geistige Gehalte im Bewusstsein der Individuen<br />
bereits vorausgesetzt, sie werden nicht im gemeinsamen Gebrauch der<br />
Sprache aktualisiert, produziert oder „ausgehandelt“, sondern müssen richtig erkannt<br />
werden. Das praktische Problem der kontextuell hinreichend guten, d.h.<br />
für die weitere Kommunikation und Kooperation anschlussfähigen Verständigung<br />
wird als Erkenntnisproblem der Absichten anderer konzipiert, als Problem<br />
der einsamen, ggf. höherstufigen Reflexion prinzipiell isolierter Subjekte darüber,<br />
was der andere mit Blick auf den Adressaten seiner Äußerung beabsichtigen<br />
bzw. meinen könnte. 51 Die „pragmatische Wende“, d.h. die Fokussierung auf<br />
50 Vgl. G. Meggle: Grundbegriffe der Kommunikation (2. Auflage). Berlin; New York: de Gruyter<br />
1997, S. 36 und passim; vgl. auch Searle, der meint, man könne ggf. auch mittels Möbelrücken<br />
kommunizieren (Sprechakte, S. 30f.).<br />
51 Paradigmatisch behandelt D. Lewis in Konventionen die Struktur des Problems der Erkenntnis von<br />
Absichten und Entscheidungen im individualistischen Theorierahmen unter dem Titel Replikation<br />
von Überlegungen und Bildung von Erwartungen höherer Ordnung. Dabei wird gut cartesianisch<br />
unterstellt, dass jeder der Teilnehmer für sich die Konsequenzen seiner Annahmen über sich und
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 127<br />
Begriffe des Handelns statt des Erkennens, insbesondere die Auffassung des<br />
Sprechens als (instrumentelles) Handeln, löst die genannten Probleme folglich<br />
nicht, solange die zugrundegelegten Intentions- und Handlungsbegriffe cartesianisch<br />
bleiben, d.h. vom individuellen Bewusstsein her erklärt werden. Zwar können<br />
auf diese Weise pragmatische Optimierungen schon vorausgegangener erfolgreicher<br />
Verständigungsprozesse, etwa mit Blick auf das „Problem des Rauschens“,<br />
oder die Kreativität des Verstehens im Falle der Verständigung über<br />
Sprachbarrieren hinweg modelliert werden. Das Grundproblem des Verstehens<br />
lösen derartige Theorien aber nicht, denn der soziale Charakter von Sprache und<br />
Geist, die Existenz eines Hintergrunds gemeinsamen Wissens, der ein gemeinsam<br />
anerkanntes und in diesem Sinne dann auch „richtiges“ Verständnis sprachlicher<br />
Äußerungen aufgrund gemeinsamer Erfolgskontrollen und wechselseitiger<br />
Korrekturen erst ermöglicht, muss im Rahmen des cartesianisch-lockeschen Programms<br />
notwendig eine äußerliche, akzidentielle Relation isolierter Individuen<br />
bleiben. Er ist im Modell keine Bedingung der Möglichkeit von Einsichten und<br />
Absichten, sondern tritt allenfalls als je besonderer mentaler Gehalt auf. Ist der<br />
Geist privat, dann ist seine Erkenntnisart die Introspektion, und diese kann per<br />
definitionem nur mein Bewusstsein zum Gegenstand haben. Aussagen über dein<br />
Bewusstsein und damit die Erkenntnis deiner Absichten, also Verstehen, ist für<br />
mich nicht möglich.<br />
Schellings Einschätzung des Cartesianismus und seiner Folgen ist daher ganz<br />
richtig. Sie gilt auch für Lockes Erweiterung und damit bis in unsere Zeit: Mit<br />
dem cogito ergo sum<br />
den anderen zieht: „Bei den Überlegungen aber, die wir dann anstellen, sind wir fensterlose Monaden,<br />
die sich nach Kräften bemühen, einander widerzuspiegeln, sich gegenseitig beim Widerspiegeln<br />
widerzuspiegeln usw.“ (Lewis: Konventionen, S. 32). M. E. gibt es keinen Weg aus solchen<br />
bedingten Zuschreibungen hinaus, gleichgültig wie hoch man in der Ordnung der Erwartungen<br />
geht. Denn diese liefern nur dann Gründe für eine richtige Zuschreibung, wenn man über zusätzliches<br />
Wissen verfügt. Nicht die Annahme eines unendlichen Regresses wechselseitiger Erwartungen<br />
ist das Problem (auch wenn menschliche Hirne schon nach wenigen Stufen scheitern mögen<br />
oder sich am eigentlichen Gehalt nichts ändert), sondern dass es keine Kriterien der Zuschreibung<br />
gibt, die über die subjektive Reflexion hinausgehen könnten. Etwa können Gründe der Ordnung n<br />
jederzeit durch Gründe der Ordnung n+1 ausgehebelt werden. Demnach können solche Überlegungen<br />
keine Zuschreibung festlegen. Ich glaube deshalb, dass Lewis nicht einmal mit Bezug auf<br />
seine idealen Modelle recht hat, wenn er meint: „Mit Hilfe eines Systems übereinstimmender gegenseitiger<br />
Erwartungen erster und höherer Ordnung über Handlungen, Präferenzen und Rationalität<br />
ist Koordination auf rationalem Wege erreichbar.“ (Lewis: Konventionen, S. 33) Dies gelingt<br />
nur dann, wenn man Begleitumstände einbezieht, die allen Beteiligten gleichermaßen Gründe für<br />
wechselseitige Erwartungen und die Zuschreibung von Absichten liefern, etwa die Beherrschung<br />
einer gemeinsamen Sprache, gemeinsamer Praxen und Konventionen, einen gemeinsamen epistemischen<br />
und normativen Hintergrund etc. In der Kommunikationstheorie finden sich, in Anschluss<br />
an Grice, ähnliche Strukturen bei Meggle, welcher um der Allgemeinheit seiner Kommunikationstheorie<br />
willen gerade keine speziellen Gründe für die Berechtigung der Erwartung des Sprechers,<br />
der Hörer werde ihn richtig verstehen, angeben will – dies sei dann Gegenstand logisch nachgeordneter<br />
„spezieller Kommunikationstheorien“ (vgl. dazu die Diskussion der „kommunikativen<br />
Reflexivität“ und der „absoluten Offenheit kommunikativer Absichten“ in Meggle: Grundbegriffe<br />
der Kommunikation, v.a. 3.2; 3.4.3; 6).
128<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
„war denn allerdings auf lange Zeit gleichsam der Grundton der<br />
neueren Philosophie angegeben [..] das wie ein Zauber gewirkt<br />
hat, durch den die Philosophie in den Umkreis des Subjektiven und<br />
der Tatsache des bloß subjektiven Bewußtseins gebannt war.“ 52<br />
„Die Philosophie bringt es also hier nicht weiter als zu einer bloß<br />
subjektiven Gewißheit [...] über die Existenz alles dessen, was außer<br />
dem Subjekt ist.“ 53<br />
Daran ändert sich auch nichts, wenn eine Gegenposition zu Descartes eingenommen<br />
wird, etwa im „Materialismus“ der neueren Philosophie des Geistes<br />
(die strenggenommen „Philosophie der individuellen Kognition“ genannt werden<br />
müsste). Denn das cartesianische Bild bestimmt hier These und Antithese, Geist<br />
und (soziale) Welt sind voneinander separiert und es gibt anscheinend keinen<br />
Weg, beide wieder zusammenzuführen. Zum einen verhindert der rein subjektive<br />
Ausgangspunkt anscheinend jede objektive Erkenntnis und jede Objektivität des<br />
Verstehens, zum anderen verwickelt sich die Theorie des Handelns in unauflösliche<br />
Schwierigkeiten.<br />
3.3 Transformationen des Cartesianismus. Das Forschungsprogramm der Naturalisierung<br />
Weder Descartes noch Locke ist Skeptiker, 54 aber die Art ihrer Fragestellung öffnet<br />
Raum für den Skeptizismus hinsichtlich des Gelingens von Kommunikation<br />
und der Möglichkeit des Verstehens. Als ein Ausweg, um im cartesianisch-lockeschen<br />
Rahmen die Möglichkeit des Verstehens plausibel zu machen und damit<br />
solipsistischen Konsequenzen auszuweichen, erscheint die Naturalisierung des<br />
Geistes. Statt kommunikativ produzierter Gemeinsamkeiten wird eine Allgemeinheit<br />
bestimmter Wahrnehmungsweisen, Antriebe, Intentionen, Dispositionen<br />
etc. angenommen. Der für das Verstehen notwendige gemeinsame Hintergrund<br />
wird nicht praktisch-kommunikativ (re)produziert, sondern als psychologische,<br />
biologische oder hirnphysiologische Eigenschaft aller Individuen der Art homo<br />
sapiens in die Individuen hineinpostuliert. Damit gibt es nun eine Basis für Analogieschlüsse<br />
von mir auf andere: Ich kann die Intentionen anderer erkennen,<br />
weil sie so funktionieren wie ich selbst. Aufgrund objektiv beschreibbarer, natürlicher<br />
Gemeinsamkeiten des Wahrnehmens und Urteilens können wir die<br />
Introspektion als Basis für Projektionen bzw. Analogieschlüsse benutzen, die es<br />
zulassen, etwas über andere herauszubekommen. Wir beginnen dabei beim Einfachen,<br />
bei einem Grundbestand etwa „einfacher Vorstellungen“, „eingeborener<br />
Ideen“ oder „natürlicher Ähnlichkeitsrelationen“ sowie Grundantrieben jedes<br />
52 F. W. J. Schelling: Zur Geschichte der neueren Philosophie. Leipzig: Reclam 1984, S. 34<br />
53 Ebd., S. 31.<br />
54 Descartes’ Zweifel ist ein methodischer Zweifel, es geht ihm gerade darum, den Ausgangspunkt sicherer<br />
Erkenntnis unter der Voraussetzung der Trennung von Subjekt und Objekt, von Geist und<br />
Welt zu bestimmen. Ein ganz ähnliches Projekt verfolgt Locke.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 129<br />
Menschen, etwa Lust und Unlust. Und dies scheint plausibel: Finde ich in der<br />
Wüste einen Verdurstenden, der mir die Hände entgegenstreckt und dabei etwas<br />
Unverständliches murmelt, dann wäre es angesichts seiner klar erkennbaren Absicht,<br />
Wasser zu erbitten, absurd, anzunehmen, er wolle mir mit seinem Gestammel<br />
seine Deutung der transzendentalen Einheit der Apperzeption verständlich<br />
machen. Zeigt einer auf eine Ulme und sagt dabei „Ulme“, dann kann man davon<br />
ausgehen, dass er mit dem Wort „Ulme“ die gleichen Vorstellungen verknüpft<br />
wie ich. Beobachtung und logischer (genauer: analogischer) Schluss, die Akkumulation<br />
von Erfahrung und die Ausbildung des Verstandes im Falle kontextuellen<br />
praktischen Verstehens, die Erweiterung des Wissens über die Funktionsweise<br />
des Erkenntnisapparates im Falle theoretischer Rekonstruktionen, sollen es<br />
dann erlauben, schrittweise zu komplexeren Zuschreibungen überzugehen bzw.<br />
im Zweifelsfall auf elementarere zurückzugehen. 55<br />
Die Auffassung des Geistes als individuelles Bewusstsein, seine Individualisierung<br />
und Psychologisierung, hat nun nicht nur eine inhaltliche Seite, sondern<br />
auch eine wichtige methodische Konsequenz: Sie fungiert als Erklärungs- und<br />
Darstellungsnorm. Einen anderen zu verstehen bedeutet, seine Absichten zu<br />
(er)kennen. Vorstellen, Wollen, Erinnern, Meinen und Verstehen etc. werden als<br />
geistige Vorgänge, Zustände oder Ereignisse aufgefasst, die je bestimmte Erlebnisqualitäten<br />
haben und wesentlich introspektiv zugänglich sind. Zwar werden<br />
sie durch ihre Manifestationen im Reich der Körperdinge angezeigt, allerdings<br />
können diese Manifestationen aus prinzipiellen Gründen keine zuverlässigen Indikatoren<br />
für das Vorliegen geistiger Zustände sein. Der Punkt ist nun nicht, wie<br />
die geistigen Tätigkeiten im einzelnen konzeptualisiert werden, sondern dass<br />
man sich darunter jeweils bestimmte und voneinander unterscheidbare Vorgänge<br />
im Geiste des Subjekts vorzustellen habe. 56 Meine ich mit dem Wort w einen Gegenstand<br />
g, so kann das etwa heißen, dass ich mir beim Aussprechen von w ein<br />
Vorstellungsbild von g vor den Geist rufe und meine Aufmerksamkeit darauf<br />
richte; will ich g, so richte ich meine Aufmerksamkeit auf g, wobei die Vorstellung<br />
von g mit Lust verbunden ist etc. Entscheidend ist nun nicht, welche geistigen<br />
Tätigkeiten und Zustände (etwa: Glauben und Wünschen) als Grundbegriffe<br />
gewählt werden, sondern dass Sätze wie „Jetzt habe ich es verstanden“, „Ich<br />
55 Dabei ist es nicht wesentlich, ob mittels einer Theorie des Geistes Hypothesen über die geistigen<br />
Zustände des anderen gebildet werden (theory-theory) oder ob die geistigen Zustände des anderen<br />
per Analogie zum Selbst erschlossen werden (simulation-theory). In beiden Fällen wird angenommen,<br />
dass das Problem der Erkenntnis von Absichten als Frage nach der richtigen Beschreibung<br />
individueller geistiger Zustände zu stellen ist und daher die Form von Tatsachenaussagen bzw.<br />
Prädikationen annehmen muss.<br />
56 Wittgenstein beschreibt dies wie folgt: „Wie kommt es nun zum philosophischen Problem der seelischen<br />
Vorgänge und Zustände und des Behaviourism? – Der erste Schritt ist der ganz unauffällige.<br />
Wir reden von Vorgängen und Zuständen, und lassen ihre Natur unentschieden! Wir werden<br />
vielleicht einmal mehr über sie wissen – meinen wir. Aber eben dadurch haben wir uns auf eine<br />
bestimmte Betrachtungsweise festgelegt. Denn wir haben einen bestimmten Begriff davon, was es<br />
heißt: einen Vorgang näher kennen zu lernen. (Der entscheidende Schritt im Taschenspielerkunststück<br />
ist getan, und gerade er erschien uns unschuldig.)“ (PU 308); vgl. auch PU 352.
130<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
meinte aber das da“, „Er hat die Absicht, Tomaten zu pflücken ...“ etc. als Konstatierungen<br />
innerer Vorgänge oder Zustände gedeutet werden, die objektive<br />
Wahrheitsbedingungen haben: Entweder hat das Subjekt das Vorstellungsbild g<br />
und seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet oder nicht, entweder ist die Vorstellung<br />
von g mit Lust verbunden oder nicht. Kurz: Entweder befindet sich das<br />
Subjekt in einem bestimmten geistigen Zustand z oder es befindet sich nicht im<br />
Zustand z, entweder es hat eine Intention i oder es hat die Intention i nicht. 57<br />
Damit ist per impliziter Definition durch entsprechende Postulate über geistige<br />
Zustände ein (logischer) Gegenstandstandsbereich etabliert 58 , der zumindest<br />
der Form nach wahrheitsfähige Aussagen zulässt, die auf das empirische Vorliegen<br />
oder Nichtvorliegen geistiger Zustände zielen, und daher den Methoden der<br />
nomologischen Wissenschaft zugänglich ist. Es lassen sich bspw. komplexere intentionale<br />
Zustände definieren oder Hypothesen über die Verknüpfung intentio-<br />
57 Im Vorgriff auf das Privatsprachenargument könnte man sagen, dass diese Auffassung geistiger Tätigkeiten<br />
oder Vorgänge irreführend ist, weil sie erstens unterstellt, dass Verben für geistige Vorgänge<br />
immer deskriptiv gebraucht werden, womit ihr Charakter als normativ gehaltvolle Zuschreibungen<br />
verkannt wird, zweitens, dass etwa beim Meinen, Verstehen oder Wollen immer je ein und<br />
derselbe Vorgang stattfindet (wenn auch auf je verschiedene Gehalte gerichtet), was eine unzulässige<br />
Verallgemeinerung darstellt, und drittens, dass es sich dabei um einen privaten inneren, geistigen<br />
Vorgang i.S. eines individuellen mentalen Ereignisses oder Zustandes handelt, womit die falsche<br />
Verallgemeinerung hypostasiert wird. Das ist die Konstitution des Gegenstandes „Intention“,<br />
die man dann auch „haben“ kann wie man einen Gegenstand haben kann. Das Interesse wird dabei<br />
von der überaus komplexen Struktur des „Habens einer Intention“ weggelenkt hin zur Frage nach<br />
der Natur des „Gegenstandes“, der dabei „gehabt“ wird – und darin liegt das Hauptproblem der<br />
Philosophie des Geistes, wie sie üblicherweise verstanden wird. Man kann sich diesen Perspektivenwechsel<br />
anhand der Unterschiede der Wahrheits- bzw. Richtigkeitsbedingungen von auf den<br />
ersten Blick synonymen Wendungen wie „ich bin/habe mich überzeugt, dass ...“ statt „ich habe die<br />
Überzeugung, dass...“ oder „ich nehme x wahr“ statt „ich habe eine x-Wahrnehmung“ deutlich<br />
machen, d.h. an den Unterschieden, die sich ergeben, wenn man versucht, ohne Nominalisierungen<br />
auszukommen. Noch deutlicher wird das im „kollektiven“ Fall: „wir sind überzeugt, dass ...“, „wir<br />
glauben, dass ...“, „wir haben x wahrgenommen“ etc. Was zunächst wie eine harmlose, bloß<br />
sprachliche Variation erscheint (und gewöhnlich auch ist), verdeckt die Reifizierung geistiger Vorgänge.<br />
58 Ohne weitere Belege verweise ich darauf, dass in der Literatur häufig über Intentionen, propositionale<br />
Gehalte etc. quantifiziert wird. Etwa sieht Searle weder in Sprechakte noch in Intentionalität<br />
ein besonderes Problem darin, die Struktur von Sprechakten bzw. Intentionen wie folgt anzugeben:<br />
F(p), wobei F für einen Modus, p für einen propositionalen Gehalt stehen soll. Meggle symbolisiert<br />
„x glaubt, dass p“ mit G(x, p), „x will mit seinem f-Tun bewirken, dass p“ mit I(x,f,p)<br />
(Grundbegriffe der Kommunikation, S. 116). Andere Beispiele lassen sich in der Literatur über<br />
kollektive Intentionalität finden, etwa in Tuomela/Miller 1988 oder Bratman 1999. Das Problem<br />
ist, dass keine Rechenschaft darüber abgelegt wird, wie die Bereiche verfasst sind, über deren Gegenstände<br />
(durch die Benutzung von Variablen) implizit quantifiziert wird (vgl. dazu das Streitgespräch<br />
von P. Stekeler-Weithofer & G. Meggle 2002). In diesem Zusammenhang von Bedeutung<br />
ist der Streit zwischen Frege und Hilbert über die Existenz der durch implizite Definitionen festgelegten<br />
Gegenstandsbereiche. Frege fordert, dass Definitionen nicht leer sein dürfen, zur Definition<br />
gehöre der Existenznachweis der definierten Sache, weil andernfalls die elementare Forderung der<br />
Nichtkreativität von Definitionen verletzt wäre, so dass aufgrund der impliziten Existenzbehauptung<br />
dann Sätze bewiesen werden können, die mit Wahrheitsanspruch auftreten, von denen aber<br />
nicht einmal gezeigt ist, dass ihr Gegenstandbereich nicht leer ist (vgl. Frege : Logik in der Mathematik).
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 131<br />
naler Zustände formulieren. Etwa könnte man Postulate aufstellen wie die folgenden:<br />
Glaubt x, dass p, dann gilt auch, dass x glaubt, dass er glaubt, dass p; o-<br />
der man kann definieren: x will p gdw. x wünscht p und x glaubt, dass p möglich<br />
ist; x fürchtet p gdw. x wünscht nicht-p und x glaubt, dass p möglich ist; x weiß p<br />
gdw. x glaubt p und p; x ist hat Gewissheit, dass p gdw. x glaubt p und x glaubt,<br />
dass unmöglich nicht-p; x hat Gründe für p gdw. x glaubt (q und q⊃p). Nun sind<br />
solche Symbolisierungen und die entsprechenden Postulate und Definitionen unproblematisch,<br />
solange sie nur als Explikationsvorschläge für normalsprachliche<br />
Redeweisen verstanden werden. Daraus, dass sie, wenigstens mit Blick auf die<br />
Wahl bestimmter Beispiele und wenigstens prima facie wichtige begriffliche Zusammenhänge<br />
erfassen, ziehen sie auch einen Großteil ihrer Plausibilität. Entscheidend<br />
ist aber, dass es auf diese Weise zugleich möglich erscheint, eine der<br />
naturwissenschaftlichen Behandlung zugängliche Ordnung in das Seelenleben zu<br />
bringen, indem das an der Mathematik orientierte cartesianische Methodenideal<br />
der deduktiv-nomologischen Theorie auf die Erkenntnis des Geistes projiziert<br />
wird. Vermittels der empirischen Deutung der (nun) theoretischen Begriffe kann<br />
man sich nun daran machen, eine empirische Theorie des Geistes aufzustellen,<br />
die der „Methode“ 59 entspricht.<br />
Wir beginnen beim Einfachen, Evidenten, unmittelbar Gegebenen, nämlich<br />
den allgemein bekannten und daher anscheinend unproblematischen „Tatsachen“<br />
des (Selbst-)Bewusstseins, die aufgrund ihrer Vertrautheit den Grundbegriffen<br />
und Definitionen der Theorie wie selbstverständlich zugeordnet werden können<br />
und damit deren empirischen Bezug herstellen. Da die individuelle Psyche physiologische<br />
Grundlagen hat – ohne Gehirn kein Gedanke, die Läsion bestimmter<br />
Hirnregionen ruft regelmäßig bestimmte Funktionsausfälle hervor, Wahrnehmungen<br />
variieren mit Sinnesreizen etc. – und umgekehrt das als Bewusstsein gedachte<br />
Subjekt handeln, d.h. etwas in der Welt bewirken kann, erscheint es möglich<br />
und notwendig, die Theorie des Geistes zu naturalisieren, d.h. geistige Phänomene<br />
mittels naturwissenschaftlicher Begriffe zu beschreiben und zu erklären.<br />
Dabei ergibt sich im Rahmen des cartesianischen Naturbegriffs aus der Möglichkeit<br />
naturgesetzlicher Erklärungen deren Notwendigkeit. Denn was sich als Ursache<br />
oder Wirkung, d.h. als Teil kausaler Vorgänge beschreiben lässt, gehört per<br />
definitionem zur res extensa, weil deren Gegenstände gerade dadurch bestimmt<br />
sind, dass sie naturgesetzlichen Zusammenhängen unterliegen. Wenn also Bewusstseinszustände<br />
des Individuums mit Einflüssen der Außenwelt variieren und<br />
umgekehrt, dann gehören sie zu den naturgesetzlich beschreibbaren Gegenständen.<br />
Die Psychologisierung des Geistes und der ihr entsprechende Typus von Aussagen<br />
über den Geist als Konstatierung geistiger Zustände des Individuums bildet<br />
gemeinsam mit dem cartesianischen Objektbegriff den Sinnhintergrund und<br />
die konstitutive Bedingung des naturalistischen Forschungsprogramms. Denn<br />
59 Vgl. Abhandlung II/14ff., S. 20f.; Regeln, insbes. V/VI.
132<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
nur wenn der Geist als Summe je individueller Bewusstseinszustände und<br />
-ereignisse gefasst wird, ist es möglich, ihn mit Vorgängen und Ereignissen der<br />
physischen Welt zu korrelieren. Und nur unter dieser Grundannahme erscheint<br />
eine über die Feststellung physiologischer Bedingungen des Bewusstseins und<br />
seiner Pathologien hinausgehende naturwissenschaftliche Untersuchung des<br />
Geistes in objektivierender, d.h. vom hermeutischen und normativen Blick des<br />
Teilnehmers gemeinsamer Praxen abgekoppelten Perspektive sinnvoll, ebenso<br />
wie die Unterstellung, dass ein Verständnis des Geistes letztlich nur durch dessen<br />
Rückführung auf objektive Vorgänge der Körperwelt möglich und dass das<br />
Geist-Welt-Problem folglich in das Leib-Seele- bzw. Gehirn-Geist-Problem zu<br />
transformieren ist.<br />
Damit bleibt das naturalistische Forschungsprogramm den <strong>Prämissen</strong> cartesianischen<br />
Philosophierens verhaftet, unter denen das Bewusstsein zum Rätsel<br />
werden muss. Denn der Wesenszug der cartesianischen Philosophie ist der Rückzug<br />
nicht auf den Geist (als Gesamtheit der humanen Lebensformen und ihrer<br />
Möglichkeiten), sondern auf die Seele qua je eigenes Bewusstsein. Nur dessen<br />
Gehalte können mir unmittelbar gewiss sein. Die Außenwelt, und damit auch das<br />
Bewusstsein anderer, ist dagegen nur vermittelt zugänglich und damit anfällig für<br />
Täuschungen. Die generelle Möglichkeit solcher Täuschungen führt zum Zweifel<br />
an der Existenz einer vom Denken unabhängigen Außenwelt. Diesen radikalen<br />
Zweifel meint Descartes nur dadurch überwinden zu können, dass er die Existenz<br />
Gottes beweist, der uns nicht täuscht, d.h. der die Übereinstimmung von innerer<br />
und äußerer Welt garantiert. 60 Für Descartes ist es Gott, der beide Welten zusammenhält<br />
und garantiert, dass unseren Ideen etwas in der Welt entspricht und,<br />
so muss man ergänzen, dass wir handelnd Ziele erreichen können. Gott wird zur<br />
erkenntnis- und handlungstheoretisch notwendigen Hypothese. Gerät diese<br />
Hypothese ins Wanken, dann führt der Dualismus in unlösbare Probleme, weil er<br />
Geist und Welt begrifflich auseinanderreißt. Will man gegen den Skeptiker und<br />
den Solipsisten dennoch an der Möglichkeit von Erkenntnis und Handlung festhalten,<br />
dann scheint die einzige Lösung ein Monismus zu sein, und wenn der I-<br />
dealismus in Misskredit kommt, dann bleibt nur der Materialismus, der, gegeben<br />
den cartesianischen Problemrahmen, nun vor der Aufgabe steht, die kategorial<br />
getrennten Sphären von Geist und Welt in der res extensa, dem Bereich naturgesetzlicher<br />
Zusammenhänge, zusammenzuführen (Physikalismus, Funktionalismus,<br />
Epiphenomenalismus, Emergenz- und Supervinienztheorie etc.). Der Naturalismus<br />
als Programm der Erklärung bzw. Rückführung des Geistes und seiner<br />
Gehalte durch bzw. auf Materielles ist kein Cartesianismus, aber er hat seine<br />
60 In neueren Lesarten Descartes’ wird die zentrale systematische Rolle der ersten Substanz und damit<br />
der Gottesbeweise häufig übersehen oder kleingeredet. Ich halte das für falsch, weil dann unterstellt<br />
werden müsste, dass Descartes die teils absurden Konsequenzen seines Dualismus ignoriert<br />
oder diesen – gewissermaßen in einem vorweggenommenen linguistic turn – statt als ontische als<br />
ontologische (und ontisch neutrale) Unterscheidung zweier inkompatibler Redebereiche konzipiert<br />
hätte. In beiden Fällen ist aber nicht verständlich zu machen, warum Descartes den Gottesbegriff<br />
überhaupt bemüht.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 133<br />
Wurzeln im Cartesianismus, von dem er nicht nur die <strong>Prämissen</strong>, Fragestellungen<br />
und Methoden, sondern auch die Schwierigkeiten erbt, insbesondere das<br />
Problem der Vermittlung zwischen dem privaten, subjektiv unmittelbaren Erleben<br />
und dem objektiven materiellen Geschehen. 61<br />
Dieses Forschungsprogramm einer nach ihrem Selbstverständnis „wissenschaftlichen<br />
Philosophie“ erhebt mit Blick auf das Humanum universelle Erklärungsansprüche.<br />
Es erstreckt sich von den Phänomenen des Bewusstseins, der<br />
Erkenntnis und des individuellen Handelns über Fragen des kollektiven Handelns,<br />
der sozialen Realität und der Moral bis hin zu Erklärung ihrer Genese und<br />
Veränderung. Die Grundlage des Naturalisierungsprogramms (der Theorie) des<br />
Geistes ist aber die Psychologisierung des Geistes, d.h. das Postulat, der Geist<br />
wäre theoretisch erfasst, wenn das individuelle Bewusstsein verstanden ist, bzw.<br />
die Überzeugung, jede rationale Erklärung dieser Phänomene müsse den Postulaten<br />
eines biologistisch gedeuteten methodischen Individualismus genügen. 62 Ich<br />
will an dieser Stelle nur einige Stichworte geben. Für die Theorie der Intentionalität<br />
und des Handelns scheint es auf der Hand zu liegen, dass für intentionale<br />
Zustände und Ereignisse eine Einbettung in den naturwissenschaftlichen Erklärungsrahmen<br />
möglich ist, weil das Bewusstsein an das Hirn gebunden ist und es<br />
demnach neurophysiologische Korrelate dieser Zustände und Ereignisse geben<br />
muss. Es wird unterstellt, dass Unterschieden des semantischen Gehalts unterschiedliche<br />
neuronale Muster entsprechen, wobei die neuronalen Aktivitäten als<br />
Ursache der mentalen gedeutet werden (was freilich durch die – nach wie vor nur<br />
61 Schon Descartes selbst scheint seinen Gottesbeweisen zu misstrauen, weshalb er nach einer anderen<br />
Vermittlung von Welt und Geist, genauer von Leib und Seele, sucht und diese – hierin ein Ahne<br />
des Materialismus der Hirnforschung – in der Tätigkeit der Zirbeldrüse zu finden meint, womit<br />
die Methoden der Naturwissenschaften auf die Dinge der Seele ausgedehnt werden. Denn in der<br />
Zirbeldrüse, also einem Teil des Gehirns, sieht Descartes das Organ, mit dem der Geist äußere Objekte<br />
wahrnehmen und über das der Wille Objekte (zunächst den Körper) bewegen kann (s. Descartes:<br />
Über die Leidenschaften). Die Trennung von Innen und Außen und die Möglichkeit ihrer<br />
„organischen“ Vermittlung ist die Grundannahme der Kognitionswissenschaft und der sog. Neurophilosophie,<br />
deren Problemhorizont in Descartes’ Theorien über die Rolle der Zirbeldrüse vorgezeichnet<br />
wird. Unter der Hand werden dabei die Seele und ihre Gehalte als materielle Gegenstände<br />
aufgefasst, andernfalls könnten sie weder Ursachen noch Wirkungen sein, was allerdings in Widerspruch<br />
zu ihrer vorausgesetzten Immaterialität steht. Dieser Widerspruch, die crux der Hirnforschung,<br />
resultiert aus dem Anspruch, Bewusstseinsinhalte bzw. deren Veränderungen durch materielle<br />
Veränderungen im Hirn zu erklären, mithin eine begriffliche Differenz mit empirischen Mitteln<br />
zu überbrücken.<br />
62 Searle geht sogar soweit, zu fordern, jede Theorie der Intentionalität müsse mit der solipsistischen<br />
Annahme vereinbar sein, ihr Träger sei ein Hirn im Tank (Searle 1990, S. 407; vergleichbare Überlegungen<br />
finden sich in Intentionalität, S. 286 und passim). Ein Korollar ist, dass Überlegungen<br />
zur Intentionalität davon auszugehen hätten, dass intentionale Gehalte unabhängig von der Außenwelt<br />
variieren können, mithin, dass die These von der Autorität der ersten Person mit Blick auf<br />
deren Bewusstsein und damit von dessen Privatheit gilt. Die Gegenposition in der Tradition Herders,<br />
Hegels, Humboldts u.a. ist, dass das individuelle Bewusstsein nur unter Voraussetzung des<br />
„objektiven Geistes“, d.h. der Gesamtheit der menschlichen Denk- und Handlungsformen, verstanden<br />
werden kann und daher nur als prinzipiell öffentliches, d.h. anderen prinzipiell zugängliches,<br />
möglich ist.
134<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
für die Zukunft versprochene – Feststellung einer Korrelation von semantischen<br />
und neuronalen Unterschieden allein noch gar nicht gedeckt wäre). 63 Wahrnehmung,<br />
Denken und Intellekt werden im Gehirn verortet. Die Rede davon, dass<br />
ein Mensch etwas wahrnimmt, denkt oder sich intelligent verhält, wird daher als<br />
uneigentliche Rede aufgefasst, alltagstauglich, aber vorwissenschaftlich: Es sei<br />
sein Hirn, das Organ des Denkens, welches wahrnimmt, denkt und intelligente<br />
Problemlösungen findet. Entsprechend wird Erkenntnis als neuronale Repräsentation<br />
der Umwelt auf Basis der Verarbeitung von Sinnesreizen durch evolutionär<br />
erworbene „kognitive Module“ erläutert. Zur Umwelt des Individuums gehören<br />
nun auch andere Individuen, symbolisch strukturierte, soziokulturelle Sinnzusammenhänge<br />
und Werte sowie deren Manifestationen in Artefakten und Institutionen.<br />
Auch diese werden als Objekte der individuellen Kognition aufgefasst.<br />
Unterschiede der Sozialisation, die Übernahme von unterschiedlichen kulturellen<br />
und normativen Bindungen und die Ausbildung entsprechender individueller<br />
Haltungen sollen sich, die prinzipielle Gleichheit der kognitiven Ausstattung aller<br />
Menschen vorausgesetzt, allein aus den interindividuell unterschiedlichen<br />
„Inputs“ und genetisch bedingten kognitive Kapazitäten (Aufmerksamkeit, Reizschwellen,<br />
Verarbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnis etc.) ergeben.<br />
Das Ziel ist dabei nicht notwendig, die Realität des Bewusstseins und intentionaler<br />
Gehalte zu leugnen (eliminativer Materialismus), sondern die entsprechenden<br />
Phänomene in einer Analysesprache zu erfassen, die ohne intentionale<br />
und normativ aufgeladene Ausdrücke auskommt oder diese als prinzipiell verzichtbare<br />
Beschreibungsebene darstellt, als Lückenbüßer eines vermeintlich<br />
vorwissenschaftlichen Verständnisses von Intentionalität und Geist (Emergenztheorien).<br />
Die Rolle unserer Selbstbeschreibungen ist dabei umstritten: Meinen<br />
die einen, die kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse würden über kurz<br />
oder lang zu neuen Selbstbeschreibungen führen (etwa Churchland und Dretske),<br />
so wie Anfang des 20. Jahrhunderts Freuds Theorie unser Selbstverständnis verändert<br />
hat, so meinen andere, unser Selbstverständnis als frei handelnde Wesen<br />
bliebe bestehen, aber würde in Zukunft vollständig erklärt werden können, etwa<br />
als evolutionär vorteilhafte Metarepräsentation der Stellung des Organismus in<br />
seiner Umwelt (etwa W. Prinz). Letztlich geht es um eine Metasprache, welche<br />
die Phänomene des auf das individuelle Bewusstsein reduzierten Geistes „more<br />
geometrico“, d.h. hier: als Teil naturgesetzlicher Regularitäten, erklärbar macht.<br />
Die Naturalisierung des Geistes stellt dessen Subsumtion unter die Kategorien<br />
63 Insofern sitzt etwa Searles Programm (s. dazu Intentionalität) einer kausalen, nicht aber ontologischen<br />
Reduktion des Mentalen auf das Physische, bei welcher der autonome Status intentionaler<br />
Rede beibehalten und sie zugleich auf das Physische zurückgeführt werden soll, einem logischen<br />
Fehler auf: Kausalität ist eine asymmetrische Relation. Eine bloße Korrelation verschiedener Phänomenreihen<br />
a und b besagt daher noch gar nichts über mögliche Verursachungen, sie lässt offen,<br />
ob a b oder aber b a verursacht. Ohne ontologische Reduktion, d.h. lückenlose Erklärung des einen<br />
Bereichs aufgrund der Gesetze des anderen, ist die Rede vom Bewusstsein als „Emergenzphänomen“<br />
des Physischen daher dogmatisch, denn bloß aufgrund einer Korrelation von Physischem<br />
und Mentalem könnte ebenso gut das Physische emergent sein.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 135<br />
des Kausalen dar. M.a.W.: Ein Modell der unbelebten Natur, die res extensa,<br />
wird zum Erklärungsmodell schlechthin, dem sich alles fügen muss – und was<br />
sich nicht fügt, wird zum irrationalen Rest oder zum Gegenstand künftiger, fortgeschrittenerer<br />
Wissenschaft erklärt. 64<br />
Mit dem Naturalisierungsprogramm wird die cartesianisch-lockesche Konzeption<br />
in ihrem wichtigsten Stück beibehalten: Das Grundphänomen ist das individuelle<br />
Seelenleben. Dass ich etwas Bestimmtes wahrnehme, glaube oder<br />
will, wird als unproblematisch vorausgesetzt, als erklärungsbedürftig zählt nur,<br />
wie dies in einer Welt letztlich physikalischer Tatsachen möglich ist. Die ursprünglichen<br />
Intuitionen des Cartesianismus werden dabei nicht außer Kraft gesetzt.<br />
Denn die eingangs besprochene Unmittelbarkeit des Selbstbewusstseins<br />
und seiner Gehalte und die Autorität der ersten Person bleiben als zu erklärende<br />
Phänomene des Bewusstsein ein zentraler Gegenstand und dem Naturalisierungsprogramm<br />
daher vorausgesetzt, selbst wenn sie dann als funktionale Illusionen<br />
oder evolutionäre Anpassungsleistungen des Organismus Mensch beschrieben<br />
werden. Entsprechend soll die Rede von Rationalität, der Bezug auf Gründe<br />
im Denken und Handeln, durch die Rede von Ursachen ersetzt werden. Denn sofern<br />
Gründe im individuellen Bewusstsein repräsentiert und wirksam sind, müssen<br />
sie, wie andere geistige Phänomene auch, durch neurologische Mechanismen<br />
einerseits ursächlich erklärt, andererseits als ursächlich wirksame Mechanismen<br />
beschrieben werden können. 65 Das naturalistische Programm kann an das cartesianische<br />
Handlungsmodell anknüpfen, indem Handlungsabsichten als individuelle<br />
Präferenzen (die sich auf beliebige Gegenstände richten können) unter den<br />
Begriff der Gerichtetheit des Verhaltens und damit unter biologische Kategorien<br />
subsumiert und kausal gedeutet werden. Gründe werden als individuelle „Rationalisierungen“<br />
letztendlich irrationaler, affektiver Verhaltensdispositionen und<br />
-präferenzen aufgefasst, die Vernunft als evolutionär herausgebildetes Instrument<br />
der biologischen Natur des Menschen, die als individuelles Vermögen zwar sozial<br />
überformt, aber nicht sozial konstituiert ist. Das cartesianische Modell der<br />
Handlung als individuelle Zwecktätigkeit bleibt dabei erhalten, nur dass die<br />
Zwecke und Motive des Handelns naturalistisch umgedeutet werden. 66 Damit<br />
64 Vgl. „Manifest“ der Hirnforscher (Gehirn & Geist, 6/2004, S. 31-37) („Auch wenn wir die genauen<br />
Details noch nicht kennen, können wir davon ausgehen, dass all diese Prozesse [nämlich sämtliche<br />
innerpsychische Prozesse – F.K.] grundsätzlich durch physikochemische Vorgänge beschreibbar<br />
sind.“ Und weiter: „Geist und Bewußtsein – wie einzigartig sie von uns auch empfunden werden –<br />
fügen sich also in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht.“ S. 33)<br />
65 Entsprechend wird die Freiheit des Handelns geleugnet bzw. zur (notwendigen) Illusion erklärt. Ein<br />
Kristallisationspunkt dieser Diskussion ist der Aufsatz von B. Libet „Do we have a free will?“<br />
(Journal of Consciousness Studies 6 (1999), No. 8/9, p. 47-57), der meint gezeigt zu haben, dass<br />
„Handlungen“ (i.S. von Basishandlungen) ihr neurophysiologisches Initialstadium (Bereitschaftspotential)<br />
schon erreichen, ehe sie uns bewusst und damit Entscheidungen aus Gründen überhaupt<br />
zugänglich werden.<br />
66 Hier setzen dann auch verhaltens- und evolutionsbiologische Erklärungen menschlichen Handelns<br />
an, dessen Besonderheiten – etwa Werkzeuggebrauch, Spiel, Sprache, Kommunikation und Kooperation<br />
– anscheinend Stück für Stück auch im Tierreich nachgewiesen werden können, insbe-
136<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
wäre bei hinreichender Kenntnis der menschlichen Biologie und Physiologie<br />
dann auch das Problem der Interpretation von Handlungen prinzipiell lösbar:<br />
Beweggründe (oder eben: die Ursachen) und Mechanismen individuellen Handelns<br />
sind als neurophysiologische Dispositionen verankert, interindividuelle<br />
Unterschiede und Verhaltensvariationen erklären sich aus der individuellen<br />
Lerngeschichte des Organismus und seines Gehirns. Damit scheint ein objektiver<br />
Interpretationsrahmen möglichen Verhaltens vorgegeben, ein archimedischer<br />
Punkt des Verstehens. An dieses Erklärungsmuster schließen, trotz der Betonung<br />
der Besonderheit des Menschen und der Vermeidung falscher Allgemeinheit mit<br />
Blick auf den Tier-Mensch-Vergleich, bei entsprechender evolutionärer Deutung<br />
dann auch Chomskys „<strong>Cartesianische</strong> Linguistik“ der grammatischen Universalien<br />
und seine Theorie der angeborenen „mentalen Organe“ oder Fodors „Sprache<br />
des Geistes“, d.h. des individuellen Bewusstseins, die im Grunde eine universale,<br />
d.h. in jedem Individuum instantiierte, Privatsprache ist, an.<br />
Akzeptiert man den Cartesianismus und die daran anschließende Theorie des<br />
Geistes und der Handlung, dann muss auch das Soziale individualistisch, genauer:<br />
atomistisch, erklärt werden. Wenn es Geist ausschließlich in Form individueller<br />
Bewusstseinszustände gibt, also Intentionalität und Handlung individualtheoretische<br />
Begriffe sind, dann müssen soziale Phänomene, die gewöhnlich als<br />
„geistig“ angesprochen werden, etwa kollektive Intentionalität, gemeinsames<br />
Handeln, soziale Gruppen und ihre Kultur, ihre Normen, Regeln, Praxen und Institutionen<br />
letztlich als Aggregation bzw. Superposition individueller Intentionen<br />
und Handlungen bzw. als deren Resultate aufgefasst werden, ggf. auf Basis biologisch<br />
festgelegter individueller Dispositionen zu sozialem Verhalten. M.a.W.:<br />
Es gibt nur die Individuen und deren Handlungen, nur eine Welt monadischer,<br />
d.h. auch: asozialer, Individuen, die jedes für sich, in ihrer privaten Welt von Ü-<br />
berzeugungen und Wünschen leben und entscheiden und die als solche nicht<br />
bzw. nur in ihnen äußerlichen Wechselbeziehungen stehen. Koordination und<br />
Kooperation sowie darauf beruhende soziale Einrichtungen sind daher reduktiv<br />
in Begriffen individueller Überzeugungen, Wünsche, Entscheidungen und Übereinkünfte<br />
zu beschreiben, d.h. in Begriffen, die zunächst nur für Individuen Anwendung<br />
haben und deren Zutreffen letztlich nur vom Individuum selbst beurteilt<br />
werden kann. 67<br />
sondere mit Blick auf nichtmenschliche Primaten. Aufgrund des genetischen Befundes, dass sich<br />
das Erbmaterial von Mensch und Affe nur in Bruchteilen unterscheidet, scheint auch die Interpretation<br />
der verhaltensbiologischen Daten auf der Hand zu liegen: Es liegt alles in den Genen, es gibt<br />
keinen evolutionären Bruch zwischen Tier und Mensch, folglich auch keinen kategorialen Unterschied<br />
der Verhaltensbeschreibung. Daher sei der Mensch vollständig mit den Mitteln der Naturwissenschaft,<br />
insbesondere denen der Evolutionsbiologie und Genetik sowie der Neurophysiologie,<br />
beschreibbar – des irreduzibel normativen, intentionalen Vokabulars der Geistes- und Kulturwissenschaften<br />
bedürfe es dazu nicht mehr.<br />
67 Wieder ist das Lewis-Modell aus Konventionen einschlägig, dem in der einen oder anderen Weise<br />
auch so verschiedene Positionen wie die von Tuomela, Gilbert und Bratman, aber auch die von<br />
Searle folgen. Zur Diskussion des Individualismus in der Sozialphilosophie s. auch <strong>Kannetzky</strong><br />
2004.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 137<br />
Dabei wird gewöhnlich nicht bestritten, dass soziale Gebilde wie Gruppen,<br />
Institutionen und andere soziale und kulturelle Größen eine Eigendynamik entwickeln<br />
und das Denken und Handeln der Individuen beeinflussen, indem sie<br />
dessen normativen Rahmen setzen. Aber, und das ist entscheidend, sie werden<br />
ebenso wie andere Individuen, als externe Faktoren nach dem Bilde der natürlichen<br />
Umwelt des Organismus konzipiert, auch wenn es Unterschiede in der<br />
Komplexität der sozialen Umwelt und ihrer Wechselwirkungen mit menschlichen<br />
Verhalten gibt, die durch eine längere Lern- und Sozialisationsphase kompensiert<br />
werden müssen. Die Aneignung von Kultur und Gesellschaft erscheint<br />
meist nur als Anpassungsleistung des Individuums an diese Umwelt, praktische<br />
Probleme des Gelingens von Kooperationen werden wesentlich als Probleme des<br />
Erkennens der Intentionen anderer Personen unter Voraussetzung unmittelbar<br />
gegebener eigener Intentionen aufgefasst. 68 Umgekehrt werden Handlungen als<br />
individuell zweckmäßige Manipulation von Gegenständen sowohl der natürlichen<br />
als auch der soziokulturellen Umwelt des Individuums gedacht. Die Dimension<br />
der Normativität und des Regelfolgens wird auf die Habitualisierung erfolgreichen<br />
Verhaltens und Sanktionsmechanismen zurückgeführt, soziales Handeln<br />
auf allgemeine, evolutionär herausgebildete und ggf. altruistische Dispositionen.<br />
Dabei spielen die Modelle der Evolutionslehre und der Soziobiologie eine<br />
zentrale Rolle, etwa das des „egoistischen Gens“, der „Verwandtenselektion“ und<br />
der „Gruppenselektion“. Diese Modelle gleichen in ihrer Struktur dem ökonomischen<br />
Verhaltensmodell, welches beansprucht, die Wechselwirkungen individuell<br />
präferenzrationalen Verhaltens und damit die Eigendynamik sozialer Systeme<br />
ohne Rückgriff auf „holistische“ Konzepte zu modellieren. Der Anschluss der<br />
Sozialphilosophie an eine naturalistische Anthropologie gelingt dabei über die<br />
naturalistische Deutung ihrer Grundfigur, des rationalen Egoisten, als naturgesetzlichen<br />
Zusammenhängen unterliegendes empirisches Individuum und seiner<br />
Handlungsantriebe (Präferenzen, Dispositionen, subjektiver Handlungssinn), denen<br />
unter evolutionstheoretischen, soziobiologischen, kognitionstheoretischen,<br />
psychologischen u.a. Aspekten ein naturalistisch beschreibbarer Gehalt gegeben<br />
wird.<br />
Es sind demnach der Individualismus, die Forderung, dass soziokulturelle<br />
Strukturen in Begriffen individuellen Erkennens und Handelns bzw. als deren<br />
Resultate zu beschreiben sind, und die Beschreibung von Überzeugungen und<br />
Absichten als Gegenstand von Psychologie und Kognitionswissenschaft, welche<br />
eine Einbettung traditionell philosophischer Fragen des Geistes und der Gesellschaft<br />
in die Naturwissenschaften ermöglichen sollen. Dieses Projekt scheint ohne<br />
ernsthafte Alternative. Denn ein Dualismus ohne „erste Substanz“ (wie etwa<br />
Descartes’ Gott) kann weder Erkenntnis noch Handlung verständlich machen,<br />
und holistische Ansätze, in denen gemeinsame Formen des Denkens und Han-<br />
68 Entsprechend nimmt in dieser Diskussion das Problem der Dekonditionalisierung wechselseitig<br />
bedingter Absichten breiten Raum ein, von psychologischer Seite wird dies als Problem des<br />
„mind-reading“ diskutiert.
138<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
delns, d.h. Praxisformen, die Funktion der ersten Substanz übernehmen, erscheinen<br />
angesichts ihrer vermeintlichen ontologischen Verpflichtungen obskur und<br />
unwissenschaftlich. Denn die modernen Wissenschaften scheinen uns zum einen<br />
auf einen materialistischen Monismus, zum anderen auf den Verzicht auf „Kollektivbegriffe“<br />
auf der „Basisebene“ der Ontologie festzulegen.<br />
4. Das Privatsprachenargument und seine Folgen<br />
4.1 Zur Reichweite des Privatsprachenarguments<br />
Ich möchte kurz zusammenfassen: Das Grundphänomen, das letztlich dem naturalistischen<br />
Forschungsprogramm und damit auch der neuerdings wieder in<br />
Mode gekommenen Idee einer wissenschaftlichen Philosophie (oder Weltanschauung<br />
samt ihrem Versprechen einer Entlastung von normativen Fragen) die<br />
Problemsstellung vorgibt, ist die Selbstgewissheit des cartesianischen Subjektes<br />
samt seiner Korollare, dem Intentionalismus (bzw. Mentalismus) und Interpretationismus<br />
in der Bedeutungs- und Kommunikationstheorie sowie in der Handlungstheorie<br />
und dem Atomismus in der Sozialphilosophie. Von Locke bis hin<br />
zum gegenwärtigen Empirismus in Handlungstheorie, Kognitionswissenschaft<br />
etc. wird in cartesianischer Tradition das folgende Bild intentionalen Geschehens<br />
gezeichnet: Meinen, Wollen, Verstehen und andere intentionale Begriffe bezeichnen<br />
psychische Zustände, Akte oder Tätigkeiten des Individuums. Intentionen<br />
sind demnach innere Zustände oder Vorgänge mit einer bestimmten Erlebnisqualität.<br />
69 Plausibel wird dieses Bild durch die Berufung auf allseits bekannte<br />
Phänomene, z.B. die Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit willentlich zu steuern<br />
und Erinnerungen und Vorstellungsbilder bewusst herbeizurufen oder durch charakteristische<br />
Erlebnisse wie das „Aha-Erlebnis“ beim Verstehen. Ich hatte diese<br />
Auffassung als Psychologisierung des Geistes charakterisiert, welche zu einer<br />
Reifizierung geistiger Vorgänge als deskriptiv erfassbare empirische Entitäten<br />
führt. Deren Identifikations- und Individuationskriterien sind bewusstseinsimmanent<br />
und liegen daher letztlich in der Autorität der ersten Person. Sie sind denen<br />
des naturalistischen Programms (etwa der Definition bestimmter Hirnzustände)<br />
vorausgesetzt, indem sie die Gegenstände der naturalistischen Erklärungen<br />
konstituieren. Das Naturalisierungsprogramm ist daher an die cartesianische<br />
Prämisse gebunden, dass Geist individuelles Bewusstsein ist – das ist seine<br />
Sinnbedingung. Denn andernfalls könnten uns weder Psychologie noch die Neurowissenschaften<br />
als empirische Disziplinen irgend etwas über den Geist sagen.<br />
Voraussetzung dafür war die Annahme einer Privatsprache bzw. einer Sprache<br />
69 „Und wir tun hier, was wir in tausend ähnlichen Fällen tun: Weil wir nicht eine körperliche Handlung<br />
angeben können, die wir das Zeigen auf die Form (im Gegensatz z.B. zur Farbe) nennen, so<br />
sagen wir, es entspreche diesen Worten eine geistige Tätigkeit. Wo uns unsere Sprache einen Körper<br />
vermuten läßt, und kein Körper ist, dort, möchten wir sagen, sei ein Geist.“ (PU 36)
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 139<br />
des Geistes, d.h. der privaten Zuordnung von Zeichen und Vorstellungen im<br />
Geiste.<br />
Dieses Modell des Geistes führt aufgrund der Trennung von Geist und Welt,<br />
Seele und Leib, notwendig zu skeptischen Konsequenzen, insbesondere mit<br />
Blick auf die Erkenntnis der geistigen Zustände anderer Personen. Sowohl<br />
Sprach- als auch Handlungsverstehen müssen folglich rätselhaft bleiben, letztlich<br />
ist der Solipsismus unausweichlich. Unter diesen <strong>Prämissen</strong> scheint nur die Beseitigung<br />
des Dualismus von Leib und Seele diese Probleme lösen zu können,<br />
d.h. die Ausweitung der Naturwissenschaften und ihrer Methoden auf die Dinge<br />
der Seele, also das Naturalisierungsprogramm, welches, ausgehend von den<br />
Selbstbeschreibungen des Subjektes mittels intentionalen Vokabulars, dessen<br />
geistige Zustände reduktiv beschreiben und dann auch (nomologisch) erklären<br />
soll.<br />
Das Ideal der deduktiv-axiomatischen Theorie wird damit auch zum Vorbild<br />
philosophischen Denkens. 70 Damit sind deren Fragestellungen aber schon a priori<br />
schief, denn man muss nun aufgrund der Ontologisierung einer Darstellungsform<br />
Ursachen und Erklärungen auch da suchen, wo es um die Orientierung des<br />
Denkens und Handelns vermittels der Beschreibung und Bewertung historisch<br />
gewachsener Praxisformen geht. Statt normativer Einsichten in die „logische<br />
Geographie“ (Ryle) unserer Begriffe des Geistigen und ihrer Präsuppositionen<br />
wird verifizierbares Wissen verlangt und damit eine falsche Alternative gestellt:<br />
Entweder die Theorie des Geistes erlaubt naturwissenschaftliche Erklärungen<br />
und Prognosen, oder der Geist kann rational nicht erfasst werden und bleibt mystisch.<br />
Das bedeutet: Was sich nicht vermittels bestimmter, letztlich meist physikalischer<br />
Gesetze rekonstruieren, erklären oder prognostizieren lässt, fällt der Irrationalität<br />
anheim. 71 Aber steht hier nicht einfach eine Position gegen die andere?<br />
Lässt sich dieser Streit mit Argumenten beilegen? Ich meine nun, dass das<br />
Wittgensteins Privatsprachenargument hier einschlägig ist. Es greift das Naturalisierungsprogramm<br />
in seinen wichtigsten <strong>Prämissen</strong> an.<br />
70 Die Wittgenstein immer wieder unterstellte Theoriefeindlichkeit bezieht sich m.E. auf diesen speziellen<br />
Theorietypus und seine kategorialen <strong>Prämissen</strong>, sofern dieser als methodisches Ideal der<br />
Philosophie aufgefasst wird. Gegen „übersichtliche Darstellungen“ und damit auch Systematisierungen<br />
hat Wittgenstein bekanntlich nichts einzuwenden. Gleiches gilt für Ryle.<br />
71 Diese Zerrissenheit zwischen überschäumenden Erkenntnisoptimismus und Kapitulation vor der<br />
‚Irrationalität‘ des Geistes findet sich beispielhaft im jüngsten „Manifest“ der Hirnforscher: „Nach<br />
welchen Regeln das Gehirn arbeitet; wie es die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung<br />
und frühere Erfahrung miteinander verschmelzen; wie das innere Tun als ‚seine‘ Tätigkeit erlebt<br />
wird und wie es zukünftige Aktionen plant, all dies verstehen wir nach wie vor nicht einmal in Ansätzen.<br />
Mehr noch: Es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit den heutigen Mitteln erforschen<br />
könnte. In dieser Hinsicht befinden wir uns gewissermaßen noch auf dem Stand von Jägern und<br />
Sammlern.“ (S. 33). Das ist zweifellos richtig, allerdings fragt sich dann, woraus die Autoren des<br />
„Manifests“, so sie es nicht einfach dogmatisch voraussetzen, ihre Gewissheit ziehen, dass der<br />
Geist qua Bewusstsein das Naturgeschehen nicht übersteigt und die Psyche prinzipiell durch physiko-chemikalische<br />
Prozesse beschreibbar ist (vgl. ebd.).
140<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Denn mit dem Naturalisierungsprogramm wird die cartesianisch-lockesche<br />
Konzeption in ihrem wichtigsten Stück beibehalten: Grundphänomen ist das individuelle<br />
Seelenleben, das als solches scheinbar keiner weiteren Erläuterung<br />
bedarf. Dass ich etwas wahrnehme, glaube oder will, wird als selbstverständlich<br />
bekanntes Phänomen vorausgesetzt – jeder weiß, worum es geht. Als erklärungsbedürftig<br />
zählt deshalb nicht, was es im gewöhnlichen Sinne bedeutet, etwas<br />
wahrzunehmen etc., sondern nur, wie dies in einer Welt von physikalischen Teilchen<br />
möglich sein kann. Genau diese Selbstverständlichkeit wird im Privatsprachenargument<br />
befragt: Etwas wahrzunehmen, zu empfinden, glauben oder wollen<br />
bedeutet, etwas Bestimmtes wahrzunehmen etc. Bevor man sich an die (kausale)<br />
Erklärung der fraglichen Phänomene machen kann, muss erläutert werden,<br />
was die Bestimmtheit geistiger Phänomene bedeutet (d.h. auch: was sie impliziert).<br />
M.a.W.: Es ist zunächst nicht erläuterungsbedürftig, dass ich etwas wahrnehme,<br />
glaube oder will, sondern dass ich etwas Bestimmtes wahrnehme, glaube<br />
oder will. 72 An der Bestimmtheit hängt alles! Denn ohne die Bestimmtheit der intentionalen<br />
Zustände, ohne Kriterien ihrer Identifikation und Individuation laufen<br />
naturalistische Erklärungen ins Leere, schlicht weil der Erklärungsgegenstand<br />
unterbestimmt wäre. Das heißt, die Individuations- und Identifikationskriterien<br />
für Intentionen müssen aus logischen Gründen unabhängig von naturalistischen<br />
Beschreibungen und Erklärungen geistiger Zustände festliegen, andernfalls<br />
wären letztere von vornherein unmöglich – schlicht mangels Gegenstand.<br />
Die Frage ist nun, welche Kriterien hier möglich sind. Die cartesianischlockesche<br />
Antwort ist nach dem Vorangegangenem klar: Die Selbstauskunft des<br />
Individuums, weil es hinsichtlich seines Bewusstseins die letzte Autorität darstellt.<br />
Das Modell setzt voraus, dass das Subjekt (sei es als Sprecher, sei es als<br />
Akteur), für sich schon weiß, was es meint oder will, und zwar unabhängig von<br />
der Interaktion und Kommunikation mit anderen. Folglich wird eine Art Privatsprache<br />
vorausgesetzt, andernfalls gäbe es im Modell keine Bestimmtheit von Intentionen.<br />
73 Das Privatsprachenargument zeigt nun, dass ein im cartesianischlockeschen<br />
Sinne isoliertes, d.h. ein monadisches Subjekt nicht über Identifikati-<br />
72 Es wird unterstellt, dass „etwas“ und „etwas Bestimmtes“ die gleiche Extension haben – was zweifellos<br />
richtig ist, aber eben erklärungsbedürftig. Reden wir von „etwas“, dann ist gewöhnlich der<br />
(Rede-)Bereich, auf den sich „etwas“ als eine Art unbestimmter Quantor bezieht, mehr oder minder<br />
klar bestimmt, jedenfalls so weit, wie es möglich und nötig ist. „Etwas“ steht dann für einen<br />
Gegenstand einer dieser Sorte oder dieses Typs von Gegenständen. Mithin sind, je nach Redekontext,<br />
nicht beliebige Einsetzungen möglich. Wellmer spricht hier von der Notwendigkeit „kategorialer<br />
Erläuterungen“ (Sprachphilosophie, S. 99). Das Problem der Bestimmtheit haben schon Herder,<br />
Fichte, Hegel und Humboldt als Zentralproblem jeder Beschreibung und Erklärung der Phänomene<br />
des individuellen Bewusstseins erkannt. Da Wittgensteins Argumente genau diesen Punkt<br />
thematisieren, ist es sinnvoll, die Philosophischen Untersuchungen trotz aller Unterschiede, etwa<br />
mit Blick auf die Möglichkeit einer „Systemphilosophie“, in deren Tradition zu stellen.<br />
73 Vgl. dazu auch Searles Prinzip der Ausdrückbarkeit in Sprechakte, nämlich „daß man alles, was<br />
man meinen, auch sagen kann.“ (Sprechakte, S. 34). Searle selbst meint, dass dies die Möglichkeit<br />
einer Privatsprache nicht ausschließt (Sprechakte, S. 35). Ich glaube aber, dass allein schon dieses<br />
Prinzip mit der Möglichkeit einer Privatsprache nicht kompatibel ist (vgl. dazu <strong>Kannetzky</strong> 2001).
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 141<br />
onskriterien für geistige Zustände verfügen kann. Diese hängen vielmehr an einer<br />
in gemeinsame Praxisformen eingebundenen Urteils- bzw. Zuschreibungsund<br />
Bewertungspraxis. Wenn das so ist, dann kann die Selbstauskunft der Person<br />
nicht das entscheidende Kriterium sein, womit die Autorität der ersten Person<br />
bezüglich ihrer Bewusstseinszustände unterminiert wird.<br />
Das Problem dabei ist nicht so sehr die Orientierung am (methodologischen)<br />
Individualismus und am Intentionalismus (i.S. des Mentalismus) als solchen,<br />
sondern dass die Analyse da abgebrochen wird, wo die Vertrautheit mit Phänomenen<br />
und Redeweisen die Illusion erzeugt, man hätte deren Verfasstheit schon<br />
durchschaut. Aber gerade das Selbstverständliche ist als solches noch unbegriffen.<br />
Die Frage ist daher nicht, ob wir bestimmte Überzeugungen, Wünsche und<br />
dann auch Absichten haben – das ist phänomenologisch vorauszusetzen –, sondern<br />
was es heißt, dass wir bestimmte, d.h. auf explizierbare oder empraktische<br />
Erfüllungsbedingungen festgelegte (und dann auch stabile und kriterial prüfbare)<br />
Empfindungen, Intentionen etc. 74 haben können und wie dies möglich ist. 75 Wittgensteins<br />
Argument läuft nun darauf hinaus, dass die Bestimmtheit von Empfindungen,<br />
Intentionen etc. (und damit deren Möglichkeit) von der Beherrschung<br />
einer Sprache als regelgeleiteter Praxis abhängt. Durch reductio zeigt er, dass die<br />
Sprachpraxis notwendig eine soziale Praxis sein muss, d.h. dass weder eine Privatsprache<br />
noch private Empfindungen, Intentionen etc. möglich sind, die Unmittelbarkeit<br />
des Selbstbewusstseins daher eine Illusion ist. Was das Argument<br />
so schwierig macht, ist die phänomenologische Plausibilität des Unmittelbaren<br />
(„Aber nur ich kann wirklich wissen, was ich fühle, denke und wünsche, und<br />
darin kann ich mich nicht irren“), die nur schwer zu erschüttern ist. Wittgenstein<br />
greift deshalb die Idee einer Privatsprache, und damit das cartesianisch-lockesche<br />
Bild des Geistes, an ihrer intuitiv stärksten Bastion an: den unmittelbar gewissen<br />
Empfindungen (oder auch: den Sinnesdaten, Lockes einfachen Ideen der<br />
Perzeption etc.) und Empfindungsausdrücken. 76 Wenn das cartesianische Bild an<br />
dieser Stelle zusammenbricht, dann taugt es auch nicht für den „Rest“, etwa den<br />
74 Im folgenden will ich aus Gründen der Ökonomie den Terminus „Intention“ als Sammelbegriff<br />
verwenden, der unterschiedliche Typen intentionaler Zustände und propositionaler Einstellungen<br />
umfasst, also weiter als den Begriff der Intention i.e.S. als Absicht.<br />
75 Gewöhnlich wird hier das Begriffspaar „explizit–implizit“ benutzt und damit nahegelegt, es ginge<br />
um explizierbares Wissen. Das ist aber nur teils richtig, teils irreführend, weil es eben nicht oder<br />
nicht primär um ein verborgenes Wissen im Sinne eines knowing that handelt, sondern um ein<br />
praktisches Wissen (knowing how), welches sich im Vollzug entsprechender Handlungen zeigt und<br />
die Kompetenz der Teilnahme an gemeinsamen Praxen voraussetzt (die freilich nicht notwendig<br />
im Fokus stehen müssen).<br />
76 Dies können die öffentlichen Ausdrücke sein, darauf kommt es nicht an, sondern darauf, dass im<br />
cartesianisch-lockeschen Modell die Bedeutung sprachlicher Zeichen die Empfindungen bzw. Vorstellungen<br />
sind, die der Sprecher damit verknüpft. Eine Privatsprache kann sich daher im Grunde<br />
auch öffentlicher Ausdrücke bedienen, ohne deshalb weniger privat zu sein, sofern deren Bedeutung<br />
vom Sprecher privat festgelegt werden. (Freilich wäre hier zu fragen, in welchem Sinne diese<br />
Ausdrücke öffentlich wären, im gewöhnlichen Sinne der Ausdrücke einer öffentlichen Sprache wären<br />
sie es gerade nicht.)
142<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Begriff der durch private Absichten individuierten Handlung. Es wäre irreführend,<br />
das Privatsprachenargument so zu deuten, als seien es nur die Empfindungen<br />
und die Empfindungsworte, die öffentlicher Kriterien bedürfen.<br />
Die Relevanz des Privatsprachenargumentes für die Philosophie des Geistes<br />
ergibt sich nun aus folgender Überlegung: Wenn gezeigt ist, dass das Vokabular<br />
unseres Empfindens, dann auch des Denkens und Handelns nur holistisch, d.h.<br />
im Rahmen gemeinsamer Handlungs- u. Praxisformen einen Unterschied macht,<br />
dann sind auch Schlüsse der folgenden Art blockiert, wie sie für das naturalistische<br />
Programm typisch sind: Wir empfinden x, also muss es „x-Empfindungen“<br />
(und deren neurologische Korrelate) als identifizierbare und einer Untersuchung<br />
mit naturwissenschaftlichen Methoden zugängliche Gegenstände geben. Wir<br />
denken, also gibt es ein „Denkorgan“, dessen Funktion intentionale Gehalte sind<br />
und dessen physiologische Gesetzmäßigkeiten diese Gehalte erklären können.<br />
Mit Wittgenstein kann man nun den Ort dieses Fehlschlusses lokalisieren, nämlich<br />
im Missverständnis des intentionalen Vokabulars selbst, sofern dieses als<br />
(individual-)psychologisches aufgefasst wird.<br />
Für die Sozialphilosophie bedeutet das, dass der methodologische Individualismus<br />
inadäquat sein muss, schlicht, weil das Individuum und seine Handlungen<br />
nur vor dem Hintergrund gemeinsamer Praxisformen verständlich sind, oder anders:<br />
weil das Ich nur als Teil eines Wir zu verstehen ist. Daraus folgt nun, dass<br />
der Individualismus als grundlegende methodische Orientierung prinzipiell zirkulär<br />
ist, denn er beansprucht, die Begriffe des Sozialen ausschließlich unter<br />
Verwendung von Begriffen zu definieren, die (zunächst) nur auf Individuen Anwendung<br />
haben. 77 Oder anders: Das Privatsprachenargument zeigt, dass die soziokulturelle<br />
Bedingtheit menschlicher Intentionalität eben nicht nur eine Frage<br />
der Prägung oder Überformung eines „an sich“ asozialen und akulturellen Wesen<br />
ist und daher nur das andere Ende eines Kontinuums darstellt, welches im Tierreich<br />
beginnt. Vielmehr macht die Bindung an gemeinsame Praxisformen und<br />
eine gemeinsame Sprache sowie die Einbindung in Kooperationen ihr Wesen<br />
aus, denn nur diese erklären die Formbestimmtheit möglicher Handlungen. Intentionales<br />
Vokabular ist daher prinzipiell irreduzibel und mittels naturwissenschaftlicher<br />
Beschreibungen nicht einzuholen. „Geist“ lässt sich folglich nur aus<br />
der Perspektive des Teilnehmers an gemeinschaftlichen Praxen erfassen, nicht<br />
aus der eines objektiven Beobachters. Vielmehr verkörpert die Idee der Perspektiveninvarianz<br />
selbst eine besondere kulturelle Praxis und hat nur in deren Rahmen<br />
Geltung.<br />
Ich werde im folgenden das Privatsprachenargument, seine handlungstheoretische<br />
Deutung und Verallgemeinerung sowie einige Konsequenzen für die im<br />
zweiten Teil genannten Probleme, insbesondere des Verstehens von Sprache und<br />
Handlung, skizzieren.<br />
77 Vgl. dazu <strong>Kannetzky</strong> 2004.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 143<br />
4.2 Skizze des Privatsprachenargumentes<br />
Das cartesianisch-lockesche Modell des Geistes, von Sprache, Bedeutung und<br />
Kommunikation unterliegt skeptischen Einwänden: Wie stellen es Sprecher und<br />
Hörer an, mit den sprachlichen Zeichen die gleichen Ideen zu verknüpfen? Wie<br />
ist Verstehen möglich, wenn Bedeutung intentionalistisch bzw. mentalistisch,<br />
d.h. unter Bezug auf die privaten geistigen Vorgänge der Sprecher definiert wird?<br />
Wittgenstein radikalisiert dieses Problem: Unter cartesianisch-lockeschen Voraussetzungen<br />
ist es fraglich, ob dem Sprecher überhaupt „Ideen“, d.h. bestimmte,<br />
in ihren Identitätsbedingungen klare Vorstellungen, zugeschrieben werden können.<br />
Das wird an der Frage nach der Möglichkeit einer Privatsprache diskutiert,<br />
einer Sprache, deren Wörter „sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende<br />
wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten, Empfindungen. Ein anderer kann<br />
diese Sprache also nicht verstehen.“ (PU 356) Die private Sprache ist dann eine<br />
Sprache, die der Repräsentation privater Empfindungen dient. Dabei können die<br />
Ausdrücke einer solchen Sprache durchaus öffentlich geäußert werden – worum<br />
es Wittgenstein geht, ist ihre Bedeutung, und diese sei dem Hörer prinzipiell<br />
nicht verständlich, weil sich die Ausdrücke auf nur dem Sprecher zugänglich<br />
private Erlebnisse, Empfindungen etc. beziehen, womit freilich die Verwendung<br />
einer solchen Sprache zur Verständigung witzlos und die Bezeichnung „Sprache“<br />
schon aus diesem Grunde fehlerhaft wäre. Gefragt wird nun, ob eine solche<br />
Sprache überhaupt möglich ist, d.h. ob es ohne Widerspruch denkbar ist, dass eine<br />
Sprache nur von einer einzigen Person verstanden werden kann. Wie oben gezeigt,<br />
ist dies im cartesianisch-lockeschen Modell des Geistes und der Sprache<br />
gerade nicht die Ausnahme, sondern Sinnbedingung und Standardfall, von dem<br />
aus die gemeinsame Verwendung sprachlicher Ausdrücke und ihre Bedeutung<br />
erst zu erklären ist. (Zur Erinnerung: Ein Zeichen hat in diesem Modell Bedeutung<br />
aufgrund der Tatsache, dass ein Sprecher ihm „Vorstellungen im Geiste“<br />
zuordnet. Die Notwendigkeit der zunächst privatsprachlichen Artikulation der<br />
„Ideen“ im Geiste ergab sich aus der Forderung der Bestimmtheit der Ideen. Ist<br />
die Annahme einer Privatsprache nicht widerspruchsfrei möglich, dann kann das<br />
cartesianische Subjekt auch keine bestimmten Ideen haben, nicht einmal im Falle<br />
prima facie privater Empfindungen.)<br />
Zur Illustration einer Privatsprache fingiert Wittgenstein (PU 258) den Fall<br />
eines Tagebuchschreibers, der jedesmal beim Auftreten einer E-Empfindung eine<br />
E-Eintragung vornimmt, deren Bedeutung per privater hinweisender Definition<br />
gerade im E-Erlebnis bzw. der E-Empfindung bestehen soll, also unter Bezug auf<br />
Gehalte des individuellen Bewusstseins definiert wird, die anderen per definitionem<br />
nicht zugänglich sein sollen. Wittgenstein zeigt, dass das Modell mit seinen<br />
Voraussetzungen kollidiert, es führt in Selbstwidersprüche. Insbesondere folgt<br />
daraus, dass kein anderer diese Sprache verstehen kann, dass sie für ihren Spre-
144<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
cher selbst unverständlich sein muss 78 – Privatus kann sich selbst nicht verstehen,<br />
weil er keine kontrollierbar stabilen Bedeutungen etablieren kann. Denn im<br />
beschriebenen Fall hieße das, dass der Sprecher irgendwie in der Lage sein muss,<br />
seine Empfindungen sicher als E-Empfindungen zu identifizieren, also mit Blick<br />
auf seine E-Empfindungen über der Zeit gültige Gleichheits- und Verschiedenheitsurteile<br />
zu fällen.<br />
Der Witz des Argumentes ist, dass unter den gegebenen Voraussetzungen<br />
nicht einmal von einer bestimmten Empfindung E (als diese und nicht jene Empfindung)<br />
gesprochen werden kann, weil dies schon den Bezug bestimmte Unterscheidungsmöglichkeiten<br />
und damit auf einen bestimmten Typ von Empfindungen<br />
(etwa Schmerz, Helligkeit) voraussetzt, der in einer gemeinsamen Sprachund<br />
Urteilspraxis verankert sein muss, die als Kontrollinstanz dient. Diese<br />
Schwierigkeit einer Privatsprache kann man sich am Beispiel des Behaltens und<br />
Prüfens von Passwörtern annäherungsweise verdeutlichen: Hat man völlig sinnfreie,<br />
aus allen gemeinsam kontrollierbaren Handlungszusammenhängen, also<br />
auch der schriftlichen Fixierung, gelöste „private“ Zeichenreichen, deren „Bedeutung“<br />
in nichts als ihrer gelegentlichen Abfrage besteht, dann mag man sich<br />
richtig erinnern – oder auch nicht. Im Falle einer echten Privatsprache entfällt allerdings<br />
die praktische Prüfung der richtigen Erinnerung, hier der Zugang zum<br />
geschützten Bereich. Man könnte sich aber eine Passwortabfrage vorstellen, die<br />
das Kriterium des Fehlens von Kontrollmöglichkeiten erfüllt, etwa dass ein (hinreichend<br />
langes) Passwort hinreichend oft in Folge richtig eingegeben werden<br />
muss, um Zugang zu erlangen. Wird dabei ein Fehler gemacht, dann wird der<br />
Zugang unwiderruflich gesperrt, so dass man sich im Falle der Sperrung nie sicher<br />
sein kann, ob man das richtige Passwort hatte, aber es nicht hinreichend oft<br />
richtig eingegeben hat, oder ob es das falsche war. Es gibt schlicht kein Kriterium<br />
der Identifikation des „richtigen“ Passworts.<br />
Ganz ähnlich muss der Tagebuchschreiber seine Empfindungen kontrollieren:<br />
Jetzt habe ich dieselbe Empfindung wie gestern, und das war eine E-Empfindung.<br />
Und das jetzt ist eine F-Empfindung, aber keine E-Empfindung usw. Die<br />
Frage ist: Woher weiß er das? Wie bestimmt er, welche Art Empfindung er gerade<br />
hat? Genauer: Welche Kriterien hat er dafür? 79 Das Kernproblem ist, dass es<br />
für die Identifikation seiner Empfindungen unter den gegebenen Voraussetzungen<br />
keine Kriterien geben kann: Privatus hat ja nur seine Empfindungen, er verfügt<br />
nicht über einen unabhängigen Vergleichsgegenstand. Sich auf seine Empfindungen<br />
zu berufen sei deshalb, „als kaufte Einer mehrere Exemplare der heutigen<br />
Morgenzeitung, um sich zu vergewissern, daß sie die Wahrheit schreibt.“<br />
(PU 364). Entsprechend hat die E-Eintragung keine Bedeutung, den ihr entspricht<br />
nichts bestimmtes.<br />
78 Ähnlich sieht dies Wellmer (Sprachphilosophie, S. 94).<br />
79 „Man vergißt aber, daß, was uns interessieren muß, die Frage ist: Wie vergleichen wir diese Erlebnisse,<br />
was legen wir fest als Kriterium der Identität des Geschehnisses?“ (PU 322)
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 145<br />
Dass sich die E-Empfindungen nicht identifizieren lassen, scheint nun auf eine<br />
bestimmte Art des cartesianischen Zweifels hinauszulaufen. Der Sprecher<br />
könnte sich ja prinzipiell immer täuschen oder sich falsch erinnern. Das Problem<br />
der Identifikation erwiese sich damit als ein Problem der Zuverlässigkeit der<br />
Sinne oder des Gedächtnisses. Aber das ist hier nicht das Problem – das Privatsprachenargument<br />
ist kein empirisches, sondern ein begriffliches Argument. Die<br />
faktisch bestehende Möglichkeit der Täuschung etwa aufgrund des Vergessens<br />
oder falschen Erinnerns ist gar nicht relevant.<br />
Vielmehr ist der Begriff der Täuschung in diesem Falle gar nicht anwendbar,<br />
denn täuschen kann man sich nur da, wo auch Korrekturen möglich sind, andernfalls<br />
wüsste man nicht, was Täuschung hieße. Im Falle der E-Eintragungen gibt<br />
es aber per Konstruktion keine Korrekturmöglichkeiten, was bedeutet, dass mit<br />
den E-Eintragungen beliebige Empfindungen vereinbar sind, d.h.: „richtig ist,<br />
was immer mir als richtig erscheinen wird“ (PU 258). Denn der Tagebuchschreiber<br />
hat nach Voraussetzung exklusive Deutungshoheit – er kann keinen Fehler<br />
machen!, schlicht, weil die E-Empfindungen nicht bestimmt sind, d.h. weil es<br />
keine Kontrolle der Richtigkeit der E-Eintragungen gibt. Es fehlen die Kriterien:<br />
Beliebige Empfindungen sind mit den E-Eintragungen vereinbar. Wo solche Kriterien<br />
fehlen, wo also „nichts ausgeschlossen wird“, da gibt es auch keine Regel,<br />
80 und wo es keine Regel oder Norm gibt, da hat weder Begriff der Richtigkeit<br />
noch der der Täuschung oder des Irrtums Anwendung und damit auch nicht<br />
der Begriff der Handlung (etwa der Bedeutungszuweisung). Das bedeutet aber,<br />
dass hier nicht der Fall verhandelt wird, dass der Sprecher sich in der Ausführung<br />
eines hinreichend klar bestimmten Handlungsschemas mit den entsprechenden<br />
Erfolgskontrollen und -kriterien gelegentlich auch täuschen kann, son-<br />
80 Kripkes Wittgenstein (S. Kripke: Wittgenstein über Regeln und Privatsprache. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp 1987, Kap. II, S. 22 und passim) stellt die Frage nach einer Tatsache, die garantiert, dass<br />
ich etwas Bestimmtes meine, dass ich einer bestimmten Regel folge (statt bloß zu glauben, dieser<br />
und keiner anderen Regel zu folgen), dass ich etwas richtig verstehe, und beantwortet diese Frage<br />
negativ: Es gibt keine solche Tatsache und es kann keine solche Tatsache geben – die Frage ist<br />
sinnlos. Hierzu muss man aber genauer unterscheiden, wonach gefragt wird: Gibt es überhaupt etwas,<br />
was der Fall sein muss, damit man sagen kann, ich hätte etwas verstanden, gemeint, befolgt?<br />
Oder wird danach gefragt, ob es eine nur mich betreffende Tatsache gäbe, die dies garantiert? Die<br />
erste Frage zu verneinen hieße, den genannten Begriffen jede Bedeutung zu nehmen – man müsste<br />
dann nämlich verneinen, dass es einen Unterschied macht, ob ich etwas meine, verstehe, beabsichtige<br />
etc. Das bedeutet, die Frage nach den Kriterien muss eine Antwort haben – auch wenn diese<br />
nicht die Form eine endgültigen und definitiven Liste von endgültigen und definitiven Merkmalen<br />
annehmen muss. Die zweite Frage kann man dagegen verneinen, ohne dass deshalb eine Antwort<br />
auf die erste Frage sinnlos wäre, denn wie das Privatsprachenargument zeigt, hängen die Kriterien<br />
des Verstehens eben nicht von nur mich betreffenden Tatsachen ab, etwa meinem Gefühl (oder Erlebnis,<br />
neurophysiologischen Zuständen etc.), dass ich nun glaube, verstanden zu haben. Die Verneinung<br />
der zweiten Frage ist damit zugleich die Verneinung des cartesianisch-lockeschen Bildes<br />
des Geistes. Das von Kripke fälschlich Wittgenstein zugeschriebene „Skeptische Paradox“ ist ein<br />
Paradox der cartesianischen <strong>Prämissen</strong> (genauer: Präsuppositionen) in Theorien des Geistes, und<br />
als solche falsifiziert es diese. Wenn man nicht leugnet, dass es geistige Vorgänge gibt, dann kann<br />
dies nur die Auffassung vom Geist als individuelles Bewusstsein sein, welches einer ihm fremden<br />
Außenwelt einsam gegenübersteht.
146<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
dern es gibt hier gar kein klar bestimmtes Handlungsschema. Folglich kann hier<br />
auch nicht von einer Sprache die Rede sein. Denn auch ein Empfindungsausdruck<br />
hat nur dann Bedeutung, wenn er einen (praktisch fassbaren) Unterschied<br />
markiert – die E-Eintragungen tun gerade dies nicht. Das Privatsprachenargument<br />
zeigt, dass es für ein im relevanten Sinne isoliertes Individuum unmöglich<br />
ist, eine Sprache zu sprechen, weil eine einzelne Person nicht über Kriterien der<br />
Befolgung sprachlicher Regeln verfügen kann, die sinnvolle Verwendung von<br />
Sprache aber an Regeln gebunden ist. Es zeigt damit auch, dass selbst die<br />
scheinbar privatesten, unmittelbar gewissen Empfindungen als solche sozial konstituiert<br />
und prinzipiell öffentlich zugänglich, wenngleich nicht in jedem Einzelfall<br />
öffentlich prüfbar, sind. 81<br />
4.3 Handlungstheoretische Deutung und Verallgemeinerung des Privatsprachenargumentes<br />
Ich schlage nun vor, das Privatsprachenargument nicht nur als sprachphilosophisches,<br />
i.e.S. bedeutungstheoretisches Argument zu lesen, sondern als ein handlungstheoretisches<br />
Argument, welches die begrifflichen Grundlagen jeder Theorie<br />
der Intentionalität und Handlung unmittelbar betrifft. Denn es lässt sich<br />
zwanglos verallgemeinern: Es gilt überall da, wo die Autorität der ersten Person<br />
hinsichtlich ihrer geistigen Vorgänge und Zustände Begründungs- oder Konstitutionslasten<br />
zu tragen hat, d.h. überall da, wo von individualpsychologischen Begriffen<br />
im genannten Sinne zur Erklärung sozialer Tatsachen wesentlich Gebrauch<br />
gemacht wird. Insbesondere erschüttert es den (intentionalistischen bzw. mentalistischen)<br />
Begriff der Handlung, sofern dieser wie im cartesianisch-lockeschen<br />
Modell unter wesentlichem Bezug auf Leistungen und Gehalte des individuellen<br />
Bewusstseins, insbesondere den „subjektiven Handlungssinn“, die Absicht, erklärt<br />
werden soll. 82 Denn eine Handlung zu verstehen bedeutet in diesem Modell,<br />
81 Dass man z.B. Schmerz vortäuschen, Mitleid heucheln etc. kann, setzt voraus, dass gewöhnlich<br />
nicht getäuscht und geheuchelt wird. Das Schmerzverhalten u.ä. verlöre sonst seinen Sinn, so wie<br />
die Lüge nur vor dem Hintergrund der Aufrichtigkeit bestehen kann. (vgl. auch G. Ryle: Der Begriff<br />
des Geistes, Kap. 6, sowie Kant zur Lüge). Aber auch wenn Aufrichtigkeit als pragmatische<br />
Präsumtion vorausgesetzt werden kann, sollte mit Blick auf die Rolle von Selbstauskünften über<br />
Empfindungen, Absichten etc. zwischen der Frage der Konstitution ihrer Gehalte einerseits, der<br />
Frage ihrer Verifikation andererseits unterschieden werden. Im Privatsprachenargument geht es um<br />
die Konstitution der Gehalte. Die Möglichkeit von authentischen Selbstauskünften der Teilnehmer<br />
gemeinsamer Praxen ist damit nicht bestritten, wenngleich immer die Möglichkeit einer Differenz<br />
von Selbst- und Fremdzuschreibung besteht, die nur kommunikativ aufgelöst werden kann. Denn<br />
ein Sprecher kann sich, entgegen den Annahmen des Cartesianismus, in seinen Selbstauskünften<br />
irren, er hat deshalb auch in Bezug auf seine „geistigen Zustände“ nicht notwendig das letzte Wort.<br />
82 M. Weber allerdings kennt neben der am subjektiven Handlungssinn ausgerichteten instrumentellen<br />
Rationalität (die gewöhnlich als Präferenzmaximierung gedeutet wird) noch andere Rationalitätstypen.<br />
Abgesehen von der Wertrationalität könnte man auch von einer „Formrationalität“ sprechen,<br />
wenn es um die an tradierten Handlungs- und Praxisformen ausgerichtete Handlung geht – und<br />
diese Art der Rationalität scheint für unseren Handlungsbegriff grundlegend zu sein, denn sie erlaubt<br />
die Identifikation und Bewertung der Handlung prima facie unabhängig von der Kenntnis der
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 147<br />
ihren primär nur dem Handelnden selbst zugänglichen Handlungssinn, ihren individuellen<br />
Zweck zu erkennen, so wie im Privatsprachenargument das Verständnis<br />
der E-Eintragung die Erkenntnis der E-Empfindung bedeutet. Die begrifflichen<br />
<strong>Prämissen</strong>, die im Privatsprachenargument als irreführend und unsinnig<br />
herausgestellt werden, finden sich demnach auch im gängigen Modell der<br />
Handlung als Verwirklichung des subjektiven Handlungssinnes. Zentraler Kritikpunkt<br />
ist dabei, dass private Intentionen und damit die private Festlegung und<br />
Identifikation des Sinns eines Verhaltens als eine bestimmte Handlung nicht<br />
möglich sind, sowenig wie die private ostensive Definition die Bedeutung eines<br />
Ausdruckes festlegen kann. Der Grund hierfür ist, wie dort auch, dass die bloß<br />
individuelle Festlegung auf eine Absicht, der bloß subjektive Handlungssinn ohne<br />
den Bezug auf einen objektiven Rahmen guter, d.h. im Blick auf reale Handlungsmöglichkeiten<br />
allgemein anerkannter Handlungsgründe, nichts ausschließt:<br />
Beliebige Absichten sind mit beliebigen Verhaltensweisen vereinbar – letztere<br />
sind demnach als Handlungen interpretierbar –, sofern der Akteur nur glaubt,<br />
diese erfüllten jene. 83 Von richtig und falsch, von angemessen oder unangemessen,<br />
kann demnach auch hier nicht die Rede sein. Die so verstandene Absicht<br />
macht für die Handlung keinen Unterschied, weil es bloß vom Subjekt her keine<br />
Kriterien, kein unabhängiges Maß der Erfüllung seiner Absicht gibt. Das bloße<br />
Gefühl der Befriedigung ist kein solches Kriterium, denn es könnte sich bspw.<br />
schon einstellen, bevor die ursprüngliche Absicht erfüllt ist. Analoges gilt für die<br />
handlungsrelevanten Überzeugungen. Auch hier gilt: „richtig ist, was immer mir<br />
als richtig erscheinen wird“ (PU 258). Wird die Deutungshoheit der ersten Person<br />
unterstellt, dann ist die Möglichkeit des Fehlers ausgeschlossen.<br />
Dazu wäre der im cartesianischen (d.h. individualistisch-mentalistischen)<br />
Handlungsmodell per definitionem ausgeschlossene Bezug möglicher Absichten<br />
auf gemeinsame Praxisformen und eine gemeinsame Urteilspraxis notwendig, in<br />
deren Licht Handlungen in verschiedenen Bewertungsdimensionen, etwa der<br />
Richtigkeit der Ausführung und der sachlichen oder normativen Angemessenheit<br />
Absichten, die der Akteur mit seinem Tun verbindet. Nur auf ihrer Basis ist eine Differenz zwischen<br />
Selbst- und Fremdzuschreibungen von Handlungen und dann auch Absichten (oder auch<br />
Werten) überhaupt möglich.<br />
83 Dies wird in der Literatur als Frage nach (den Kriterien) der richtigen Handlungsbeschreibung breit<br />
diskutiert. Etwa wurde vorgeschlagen, komplexere Handlungen auf schon verstandene „Basishandlungen“<br />
zurückzuführen, was daran scheitert, dass dieselben „Basishandlungen“ im Kontext<br />
ganz verschiedener Handlungen vorkommen. Auch Kripkes Wittgenstein (vgl. Wittgenstein über<br />
Regeln und Privatsprache, S. 17) setzt hier (wegen der Rollenverteilung zwischen Wittgenstein<br />
und seinem fiktiven Diskussionspartner in den PU fälschlich) an, nämlich an PU 201: „Unser Paradox<br />
war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen, da jede Handlungsweise mit<br />
der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei.“ Die Frage wäre demnach, wie eine Regel, oder e-<br />
ben meine Absicht, einer Regel zu folgen, ihre Anwendung festlegt, wenn meine vergangenen Absichten<br />
oder Regelanwendungen keinen Hinweis darauf geben können, was ich gegenwärtig darunter<br />
verstehe, eine bestimmte Handlung auszuführen. Das Privatsprachenargument (in dem nun<br />
tatsächlich Wittgenstein spricht) zeigt nun gerade, dass hier kein Paradox vorliegt, sondern eine<br />
inkonsistente Auffassung des Regelfolgens bzw. des Handelns, nämlich als privat mögliches Regelfolgen<br />
oder Handeln.
148<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
der gewählten Handlungsform, richtig oder falsch sind. Da dem Akteur des individualistischen<br />
Handlungsmodells diese Bezüge fehlen, ist er nicht in der Lage,<br />
einen Fehler zu machen, weil nach Voraussetzung das einzige Kriterium sowohl<br />
der Identifikation als auch der Richtigkeit der Handlung seine Absicht ist und<br />
seine Überzeugung, dass er seine Absicht mit dieser oder jener Verhaltensweise<br />
realisieren kann. 84 Denn ganz analog zur Unbestimmtheit der privaten E-Empfindungen,<br />
kann ohne den Bezug auf gemeinsame Handlungsformen nicht einmal<br />
von einer bestimmten Absicht die Rede sein. Ist die Absicht aber nicht bestimmt,<br />
etwa wenn sie sich in einem bloßen vagen Gefühl eines Mangels oder eines<br />
Wunsches ohne die (wieder gemeinsamen Praxisformen zugehörige) instrumentelle<br />
Struktur möglicher Handlungen erschöpft, dann läuft auch der Begriff des<br />
Fehlers ins Leere. Die Möglichkeit des Fehlers gehört aber zum Begriff der<br />
Handlung (andernfalls wäre sie ein Widerfahrnis oder Ablauf).<br />
Der Witz des Privatsprachenargumentes hängt demnach nicht am Bezug auf<br />
Sprache und Empfindungen, sondern allgemeiner am Bezug jedes Handelns auf<br />
Handlungsformen bzw. -typen und die entsprechenden (generischen) Absichten.<br />
Es spezifiziert eine allgemeine These für den Fall sprachlichen Handelns und<br />
lässt sich deshalb zwanglos für beliebige Formen des Handelns verallgemeinern.<br />
In seinem Kern zielt es nicht auf Sprache und Bedeutung, sondern auf allgemeine<br />
Merkmale jedes, nicht nur des sprachlichen Handelns. Es zeigt, dass ein isoliertes<br />
Individuum keine Kriterien der Erfüllung seiner Intentionen hat, insbesondere<br />
taugt das Gedächtnis ohne „äußere“, gemeinschaftliche Erfolgskontrolle<br />
nicht dazu, einem Ausdruck oder Tun Bedeutung bzw. Sinn zuzuschreiben oder<br />
es als regelkonform zu bewerten, sowenig wie die private Absicht ohne den Bezug<br />
auf gemeinsame Handlungsformen eine bestimmte Absicht – und damit ü-<br />
berhaupt eine Absicht – sein kann. Ohne die Rückbindung an gemeinschaftliche<br />
Praxen und Institutionen, d.h. nur psychologisch und vom Individuum her gedacht<br />
(oder etwas salopper formuliert: nur der Einbildung nach), gibt es keine<br />
Erfolgskontrolle des Handelns und damit auch kein Handeln, denn dieses umfasst<br />
seinem Begriff nach den Handlungserfolg und damit auch die Möglichkeit<br />
84 In diesem Zusammenhang wird oft darauf verwiesen, dass Gründe keine guten Gründe sein müssten,<br />
um eine Handlung zu rationalisieren. Es genüge, dass der Akteur glaubt, seine Wünsche und<br />
Überzeugungen rationalisierten sein Handeln (s. etwa D. Davidson: Handlungen, Gründe und Ursachen,<br />
S. 19) Das mag im Einzelfall so sein, für ein allgemeines Handlungsmodell ist es aber untauglich.<br />
Denn dann wäre der Erfolg der Handlung, der zu ihrem Begriff gehört, bloß „eine Gnade<br />
des Schicksals“ (Wittgenstein, Tractatus 6.374). Darüber hinaus gilt, wieder in Analogie zum Privatsprachargument:<br />
Definiert man den Begriff des Grundes allein mittels subjektiver Überzeugung,<br />
dann gibt es weder gute noch schlechte Gründe. Denn es gibt dann mangels öffentlicher<br />
Kontrollmöglichkeiten auch keine Bewertungsmöglichkeiten, d.h. wieder: es wird nichts ausgeschlossen.<br />
Die Berufung auf meine bloß subjektive Überzeugung oder Präferenz ist deshalb nicht<br />
nur kein guter Grund, sondern gar kein Grund – eine Fehlberufung. Einen Grund anzugeben bedeutet<br />
vielmehr, sich auf schon allgemein Anerkanntes zu berufen, setzt also wieder gemeinsame<br />
Praxen und geteilte Urteile voraus. Abgesehen davon schließt das Privatsprachenargument schon<br />
die Voraussetzung dieser Argumentation aus, nämlich dass man i.S. einer Privatsprache private<br />
Wünsche und Überzeugungen haben könnte.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 149<br />
des Scheiterns. Die private Tagebucheintragung kann diese Erfolgskontrolle so<br />
wenig leisten, wie die Festlegung auf eine private Absicht. Sie ist als Handlung<br />
zwecklos, und zwar nicht, weil dem Tagebuchschreiber nicht irgend ein subjektiver<br />
Handlungssinn dabei „vorschweben“ würde, sondern weil die Erfüllungskriterien<br />
von Handlungen nicht privat festgelegt und kontrolliert werden können. Im<br />
Falle der Handlung ist die Schwierigkeit, zu erklären, ob und woher ich als Bündel<br />
von (ggf. unkontrollierbar wechselnden) Präferenzen und Überzeugungen<br />
wissen kann, wann meine Präferenzen erfüllt sind. Das gilt eben auch, als besonderer<br />
Fall, von elementaren Urteils- und Aussagehandlungen, etwa den E-<br />
Eintragungen beim Vorkommen von E-Empfindungen in Wittgensteins Beispiel.<br />
Jede Handlung setzt solche Erfüllungsbedingungen und ein Mindestmaß an (potentiell<br />
öffentlicher) Erfolgskontrolle voraus, die privatim, d.h. unter Bezug auf<br />
individuelle Bewusstseinszustände als Wesenskern von Handlungen, eben nicht<br />
zu haben sind. So wie der individuelle Sprecher des Rückhaltes in einer Sprachgemeinschaft<br />
bedarf, braucht der individuelle Akteur den einer kollektiven Praxis<br />
und der gemeinsamen Erfolgskontrolle, den Bezug auf Handlungs- bzw. Praxisformen<br />
(als System von Handlungsformen und deren Schemata). Wer eine<br />
Person als Handelnden beschreibt, ihr Tun als richtig oder falsch, als angemessen<br />
oder unangemessen, als geglückt oder misslungen, bezieht sich daher, mehr oder<br />
weniger vermittelt, notwendig auf kollektive Praxen und Institutionen, in denen<br />
die entsprechenden Handlungsformen und deren Normen und Regeln verankert<br />
sind. Erst in diesem Rahmen machen die Selbstbeschreibungen des Individuums<br />
einen Unterschied, und erst in diesem Rahmen ist es überhaupt möglich, eine<br />
Absicht zu bilden, d.h. sich auf mögliche Handlungen festzulegen. Ohne den Bezug<br />
auf solche Handlungs- und Praxisformen und die öffentlichen Formen ihrer<br />
Normierung und Kontrolle ist die Rede vom subjektiven Handlungssinn so unverständlich,<br />
wie die E-Eintragungen ohne ein zugehöriges Sprachspiel. 85<br />
Der Sinn von Handlungen und das Handlungsverstehen, und unter der Voraussetzung,<br />
dass Sprechen Handeln ist, auch die Bedeutung von Äußerungen und<br />
das kommunikative Verstehen, generell die Begriffe des Geistes, müssen daher in<br />
normativen Begriffen der Teilnahme an gemeinschaftlichen Praxen expliziert<br />
werden. Das hat Konsequenzen. Etwa kann die Fremd- und Selbstzuschreibung<br />
85 Eine häufige Fehldeutung des Argumentes ist die Behauptung, es liefe darauf hinaus, einer allein<br />
könne weder sinnvoll sprechen noch handeln. Für den Fall der konkreten Einzelhandlung ist dies<br />
offensichtlicher Unsinn, allerdings der Deutung, nicht des Argumentes. Denn dieses besagt als präsuppositionslogisches<br />
Argument nur, dass individuelle Akte und intentionale Gehalte nur unter Bezug<br />
auf generische Handlungen und deren generische Zwecke bzw. als deren Aktualisierung verständlich<br />
gemacht werden können. In einem anderen, auf den Begriff der Absicht und der Handlung<br />
bezogenen Sinne besagt das Argument allerdings genau das: Es ist nicht möglich, dass einer<br />
nur einmal gehandelt oder eine Absicht gefasst hat, eben weil Handlungen und Absichten (im Unterschied<br />
zu bloßem Verhaltungen und Begierden) nur als Teil kollektiver Praxen möglich sind. (S.<br />
auch PU 199: „Es kann nicht ein einziges Mal nur ein Mensch einer Regel gefolgt sein. Es kann<br />
nicht ein einziges Mal nur eine Mitteilung gemacht, ein Befehl gegeben, oder verstanden worden<br />
sein, etc. – Einer Regel folgen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine Schachpartie<br />
spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen).“)
150<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
von Absichten und Überzeugungen nicht als Konstatierung geistiger Zustände<br />
oder Vorgänge aufgefasst werden. Denn sie ist nicht monologisch, sondern „dialogisch“<br />
verfasst, 86 hängt also von der Möglichkeit kommunikativen Verstehens<br />
und damit von entsprechenden öffentlichen, v.a. sprachlichen Artikulationsmöglichkeiten<br />
ab. (Ob eine Handlung geglückt ist, hängt nicht davon ab, dass der Akteur<br />
glaubt, sie sei geglückt, sondern von der potentiell öffentlichen Bewertung<br />
als Aktualisierung einer bestimmten Handlungsform, der entsprechend dann auch<br />
Absichten und Überzeugungen zugeschrieben, und als Kompetenz ihrer Aktualisierung,<br />
auch „gehabt“ werden.) Die Frage nach dem subjektiven Handlungssinn,<br />
danach ob und welche Überzeugungen oder Absichten einer hat oder nicht<br />
hat, taugt folglich nicht zur Basisfrage einer Handlungstheorie – das Privatsprachenargument<br />
zeigt, dass der Bezug auf ein (impersonales) Wir, auf gemeinschaftliche<br />
Praxisformen und Institutionen für das Haben von Absichten konstitutiv<br />
ist. Der wesentliche Bezugsrahmen der Rede von Handlungen, Absichten<br />
und Überzeugungen ist deshalb nicht das monadische Individuum und sein Bewusstsein,<br />
sondern das sozialisierte und akkulturierte Individuum und damit die<br />
Praxisformen der Gemeinschaft. Diese Verallgemeinerung des Privatsprachenargumentes<br />
nenne ich das Privathandlungsargument, es bezieht sich auf beliebige<br />
intentionale Gehalte, auf beliebige Denk- und Handlungsmöglichkeiten des<br />
Menschen, also das, was im Unterschied zu naturgesetzlichen Verläufen gewöhnlich<br />
der Sphäre des Geistes zugeordnet wird, und es zeigt, dass diese nicht primär<br />
als personale Kompetenzen oder dem Individuum „natürlich“ gegebene, wenngleich<br />
„kulturell überformte“ Vermögen, etwa des Wahrnehmens, des (vernünftigen)<br />
Urteilens, Sprechens und Wollens, zu konzipieren sind. 87<br />
86 Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass das Individuum Entschlüsse fassen, sich auf Handlungen<br />
festlegen etc. kann. Aber: Es kann dies nur als kompetenter Teilnehmer gemeinsamer Praxen,<br />
d.h. als Person, die sich gemeinsame Handlungsformen (einschließlich ihrer Normen) angeeignet<br />
hat, welche den Gehalt möglicher Absichten bilden. Entsprechend ist auch der innere Monolog<br />
dialogisch verfasst, z.B. als Abwägung (potentiell) gemeinsam anerkannter Handlungsgründe<br />
(Soll ich dieses oder jenes tun? Was bin ich für ein Mensch, wenn ich das begehre?) oder als Wahl<br />
der im Lichte kollektiver Bewertungen richtigen Beschreibungen der eigenen Handlungen. (Wird<br />
das als Notwehr durchgehen? Werde ich als Gimpel dastehen? Verhindert mein Tun künftige Kooperationen,<br />
weil ich dann als Trittbrettfahrer gelte?) Der innere Monolog ist seinem Gehalt nach<br />
kein Monolog, sondern Selbstvergewisserung im Lichte allgemein geltender Normen, er ist Darstellung<br />
und Rechtfertigung möglichen Handelns vor einer im Laufe des Erwerbs von Handlungskompetenzen<br />
internalisierten Öffentlichkeit bzw. vor einem imaginären, potentiellen Publikum.<br />
87 Dies gilt analog auch für die Überlegung, normative Praxen wie die Sprachpraxis (und dann auch<br />
Begriffe wie Sprachgebrauch, Sprache, Bedeutung, propositionaler und intentionaler Gehalt etc.)<br />
auf das empirisch erfassbare Sanktionsverhalten der in einer Gruppe organisierten Individuen zurückzuführen<br />
(etwa in E. von Savignys Zum Begriff der Sprache oder auch in R. Brandoms Making<br />
it explicit). Dabei muss man, um zirkuläre Erklärungen zu vermeiden, von „privat“, d.h. unabhängig<br />
von den fraglichen Praxen, sanktionierenden Individuen ausgehen. Damit ergibt sich a-<br />
ber sofort das Problem, dass diese, weil sie nach Voraussetzung nicht normgebunden entscheiden<br />
(individuelle Normen sind nach dem Privatsprachenargument nicht möglich), rein dezisionistisch,<br />
nach kontingenten individuellen Präferenzen sanktionieren. Eine normative Praxis setzt aber geteilte<br />
normative Erwartungen voraus, und erst in diesem Rahmen ist es sinnvoll, überhaupt von<br />
Sanktionen, also von Reaktionen auf Regelverstöße im Unterschied zu bspw. intrinsisch aggressi-
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 151<br />
4.4 Einige Konsequenzen<br />
Damit ist auch der Geist-Welt-Dualismus hinfällig – es gibt nicht da die äußere<br />
Welt, hier das einsame Subjekt, welches der äußeren Welt nur durch individuelle<br />
kognitive Leistungen, etwa des Empfindens, Wahrnehmens, rationalen Schließens<br />
und Entscheidens verbunden ist. Vielmehr sind diese scheinbar individuellen<br />
Vorgänge und Vollzüge nur als Teil gemeinsam kontrollierter, diskursiver<br />
Praxen möglich. Der Dualismus von Geist und Welt verschwindet damit als prinzipielles<br />
Problem, weil uns die Welt nicht anders als im Rahmen gemeinsamer<br />
Sprach- und Praxisformen zugänglich ist, und die Frage nach einer Welt an sich,<br />
d.h. jenseits dieser Formen, unsinnig ist. 88 Die Fragestellung des Cartesianismus<br />
löst sich auf, wenn man einerseits Denken und Handeln nicht als bloße Manifestation<br />
oder Äußerung des bloß individuellen Geistes bzw. Bewusstseins versteht,<br />
sondern die individuelle Aneignung gemeinsamer und gemeinsam kontrollierter<br />
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsformen als Wesenmerkmal und konstitutives<br />
Element jedes individuellen Bewusstseins auffasst, was die Auffassung<br />
geistiger Gehalte als intrinsische Zustände eines monadischen Bewusstseins ausschließt,<br />
und andererseits die Konstitution der Welt als Welt bestimmter Gegenstände<br />
(nicht an und für sich, sondern für uns) in gemeinsamen (Urteils)Praxen<br />
anerkennt, in denen Identifikations- und Individuationskriterien der Dinge festgelegt<br />
werden. In diesem Sinne ist die Welt nicht unabhängig vom Geist: Nicht<br />
in ihrer Existenz, aber in ihrer Bestimmtheit hängt sie von der Art und Weise ab,<br />
in der wir uns auf sie beziehen. (In diesem Sinne ist dann auch die Hegelsche<br />
Rede von der „Freiheit des Begriffs“ aufzufassen.) Das schließt die Eigengesetzlichkeit<br />
und Widerständigkeit der Welt nicht aus, im Gegenteil. Gerade wegen<br />
dieser haben Handlungs- und Denkformen sachlichen Gehalt: Sie fixieren und<br />
vem Verhalten, zu sprechen. Sofern nämlich Sanktionen Handlungen darstellen, können sie nicht<br />
unabhängig von entsprechenden gemeinsamen Praxis- und Handlungsformen und deren Normen<br />
verstanden werden. Andernfalls wäre es unsinnig, von berechtigten bzw. unberechtigten, von angemessenen<br />
oder unangemessenen und damit überhaupt von Sanktionen zu sprechen. Nur Sanktionen,<br />
welche in diesen Dimensionen bewertet werden können, zählen als Sanktion und können eine<br />
normative Praxis charakterisieren. Sie zeigen die Geltung von Normen an, konstituieren diese aber<br />
nicht. Deshalb dann kann eine Theorie normativer Praxen nicht um den Begriff individuellen<br />
Sanktionsverhaltens aufgebaut werden, sofern dieses nicht selbst schon als Handlung gemäß einer<br />
Praxisform aufgefasst wird. Die Idee, eine Theorie normativer Praxen aufgrund eines quasinatürlichen<br />
elementaren Sanktionsverhaltens aufbauen zu können, sitzt der Illusion auf, es gäbe so<br />
etwas wie Sanktionen aufgrund rein individueller Maßstäbe und Erwartungen. Ohne Bezug auf geteilte<br />
und gemeinsame kontrollierbare Regeln und Kriterien tragen sie zur Etablierung einer normativen<br />
Praxis so viel bei, wie die private ostensive Definition zur Konstitution von Bedeutungen.<br />
(Vgl. dazu auch <strong>Kannetzky</strong> 2003).<br />
88 Als empirisches Problem, etwa des Erwerbs oder der Wiederherstellung von Handlungskompetenzen<br />
einer Person, der individuellen Teilhabe am „Geist“, bleibt das Leib-Seele-Problem freilich bestehen,<br />
aber eben nicht als philosophisches des Verhältnisses von Geist und Welt. Psychologie,<br />
Hirnforschung und die „Kognitionswissenschaft“ untersuchen demnach notwendige Bedingungen<br />
individueller Kompetenzen, ihren Gehalt können sie dagegen nicht explizieren, sondern müssen<br />
ihn voraussetzen.
152<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
tradieren kollektive Problemlösungen und optimierte Verläufe des Umgangs mit<br />
der natürlichen und der sozialen Welt. 89 Und umgekehrt ist die Welt nichts anderes,<br />
als die Gesamtheit der Gegenstände möglicher Handlungen. Insofern ist der<br />
Geist a priori „welthaltig“ und unsere Welt nicht „geistlos“, die Unterscheidung<br />
von Geist und Welt ist keine absolute Unterscheidung, sondern eine innerhalb<br />
unserer Praxisformen.<br />
Im Tractatus schreibt Wittgenstein „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten<br />
die Grenzen meiner Welt“, und weiter, dass der Solipsismus das richtige meint<br />
(Tractatus 5.6). Ist Wittgenstein hier in die gleiche Falle getappt wie die von<br />
Descartes und Locke begründete philosophische Tradition? Im Lichte des Privatsprachenargumentes,<br />
d.h. der Unmöglichkeit einer Privatsprache, besagt dies<br />
nichts weiter, als dass individuelle Erfahrungen und Handlungen an gemeinschaftliche<br />
Praxisformen als deren Präsuppositionen gebunden sind. „Die Grenzen<br />
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ heißt dann: „Meine Welt<br />
ist durch die Handlungs- und Praxisformen der (Sprach-)Gemeinschaft festgelegt,<br />
der ich angehöre.“ 90 Für mein Empfinden, Denken, Wollen und deren Weltbezüge<br />
bedeutet dies, dass sie, obwohl es individuelle Vorgänge sind, durch öffentliche<br />
Vorgänge und Institutionen, insbesondere sprachliche Repräsentationen,<br />
in ihren Gehalten bestimmt sind, denn wofür es keine Artikulationsmöglichkeiten<br />
und damit auch keine öffentliche Kontrolle gibt, das macht keinen Unterschied,<br />
es existiert nicht für das Denken und Handeln.<br />
Das Privatsprachenargument gibt damit auch einen methodischen Hinweis,<br />
wie das notorische Problem des Verstehens angegangen werden kann. Es legt eine<br />
radikale Blickwendung nahe. Denn die Frage des Verstehens wird unter cartesianisch-lockeschen<br />
<strong>Prämissen</strong> falsch gestellt: Man verstehe sich und die eigenen<br />
(Sprech-)Handlungen unmittelbar, weil man seine eigenen Überzeugungen und<br />
Absichten kenne. Die Überzeugungen und Absichten anderer kenne man aber<br />
nicht, jedenfalls nicht unmittelbar, also verstehe man ihre Handlungen nicht, jedenfalls<br />
nicht unmittelbar, sondern nur vermittels immer fallibler Interpretationen<br />
und Zuschreibungen. Hier hakt das (verallgemeinerte) Privatsprachenargument<br />
an zwei eng miteinander verbundenen Stellen ein: Erstens wird bezweifelt,<br />
dass man eine Handlung versteht, wenn man die subjektive Absicht des Akteurs<br />
kennt. Genauer: Zwecke und damit auch Absichten sind nur im Rahmen geteilter<br />
89 Vgl. dazu A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur. Teil I: Institutionen, S. 202 und passim. Gehlen<br />
spricht statt von Handlungs- und Praxisformen von Institutionen; hier werden Institutionen eher als<br />
deren Vergegenständlichung bzw. Verobjektivierungen aufgefasst.<br />
90 In gewisser Weise wird damit Kants Einsicht wiederholt, dass es jenseits unserer Anschauungsformen<br />
und Begriffe keine Realität „an sich“ gibt. Kants ‚Fehler‘ (oder der seiner Interpreten) ist,<br />
dass diese Anschauungs- und Urteilsformen nicht als gemeinsame und generische konzipiert sind,<br />
sondern als universelle (im Sinne der logischen Universalität, dass eine Eigenschaft auf beliebige<br />
Individuen des universellen Gegenstandsbereiches zutrifft oder nicht zutrifft). Der Unterschied ist,<br />
dass gemeinsame Formen in Anerkennungsprozessen etabliert werden, sie sind normativ. Aus der<br />
Perspektive des urteilenden Individuums erscheinen sie aber als universelle, quasi objektive Formen,<br />
schon aus dem Grund, dass sie als vorgegebene Formen erlernt und eingeübt werden müssen.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 153<br />
Praxen überhaupt als mögliche Zwecke verständlich zu machen. Daraus folgt<br />
nun zweitens, dass man sich selbst unmittelbar, d.h. ohne den Bezug auf anderes,<br />
etwa Handlungs- und Praxisformen, nicht verstehen kann. Da Handlungs- und<br />
Praxisformen aber nicht nur die Möglichkeit von Absichten und Handlungen<br />
konstituieren, sondern als reale Formen unserer Praxen nur in und durch Handlungen<br />
und deren gemeinsame Erfolgskontrolle, Bewertung und Anerkennung<br />
existieren, folgt, dass man sich selbst nicht ohne den Bezug auf andere verstehen<br />
kann. Ich kann mich selbst und mein Tun nur dann verstehen, wenn ich andere<br />
und ihr Tun verstehe und vice versa. Es gibt daher keinen prinzipiellen Unterschied<br />
zwischen Selbst- und Fremdverstehen, der etwa per Analogieschluss oder<br />
Einfühlung überbrückt werden müsste, sondern beides setzt die Kompetenz zur<br />
Teilnahme an den Praxen einer Gemeinschaft (oder, wenn man so will, die Teilhabe<br />
am objektiven Geist) voraus. Erst aus dem Verständnis des Wir und seiner<br />
Strukturen kann man das Ich begreiflich machen – kein Individuum ohne Dividuum,<br />
das Wir ist eine konstitutive Voraussetzung der Möglichkeit der Ausbildung<br />
eines Ich. 91<br />
Die Sprache ist dabei nicht ein (ggf. durch andere Mittel ersetzbares) Instrument<br />
der Verständigung, sondern wir verstehen etwas oder uns im Medium der<br />
Sprache, weil Handlungs- und Praxisformen immer auch sprachlich verfasst sind<br />
und sprachlicher Repräsentationen bedürfen. 92 Dies gilt selbst im Falle gegenständlich-herstellender<br />
Handlungen (etwa des Handwerks), deren Sprachlichkeit<br />
zunächst bezweifelt werden könnte, weil sie anscheinend sprachunabhängigen,<br />
instrumentellen Erfolgskriterien unterliegen. Aber: Die Bewertung des Erfolgs<br />
liegt niemals in der Handlung selbst. Was als Erfolg zählt, was als richtig und<br />
was falsch, kunstgerecht oder stümperhaft, berechtigt oder unberechtigt, ange-<br />
91 Hier sind verschiedene Fragen und Frageebenen zu unterscheiden, die in der Diskussion gewöhnlich<br />
vermengt werden: Zum einen die nach dem Träger von Überzeugungen, Absichten etc. – und<br />
das ist das Individuum, zum anderen die Frage nach den Konstitutionsbedingungen und dem Gehalt<br />
dieser Überzeugungen, Absichten etc. – und zu deren Bestimmung muss auf gemeinsame<br />
Handlungs- und Praxisformen verwiesen werden. Das Privatsprachenargument richtet sich auf die<br />
zweite Frage, ohne sich weiter um eine Antwort auf die erste zu kümmern. Vermittelt werden beide<br />
Dimensionen durch Lehren und Lernen, welche notwendige Bestandteile menschlicher Praxen<br />
ausmachen. Weiterhin muss man zwischen Fragen der Geltung und der Genese unterscheiden, wobei<br />
die methodische Ordnung gebietet, zunächst die Strukturen dessen zu explizieren, dessen Entstehung<br />
erklärt werden soll. Dass es menschlichen Individuen sind, die Praxisformen in ihren<br />
Handlungen hervorbringen, spricht deshalb nicht dagegen, dass sowohl das Individuum als auch<br />
sein Tun nur vor dem Hintergrund gemeinschaftlicher Praxisformen verständlich gemacht werden<br />
können.<br />
92 Das schließt Deutungsspielräume und die Möglichkeit von Missverständnissen natürlich nicht aus.<br />
Von Missverständnissen kann aber nur dann sinnvoll gesprochen werden, wenn man die Möglichkeit<br />
des Verstehens und damit die Möglichkeit, Missverständnisse zu beheben, als Normalfall unterstellt.<br />
Dass Missverständnisse prinzipiell lokal und korrigierbar sind, ist daher eine begriffliche<br />
Feststellung. Es ist deshalb unsinnig, Sprache und kommunikatives Verstehen von der Möglichkeit<br />
prinzipiellen Missverständnisses her konzipieren zu wollen, wie dies die cartesianisch-lockesche<br />
Tradition letztlich versucht. Auf der Grundlage bloß zufälligen Verstehens kann von Sprache nicht<br />
die Rede sein.
154<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
messen oder unangemessen, kurz: der Korpus der Zwecke, Erfüllungsbedingungen<br />
und Normen der Handlungsform, kann nur sprachlich (wenn auch nicht in<br />
jedem einzelnen Fall als explizites Regelwissen) repräsentiert werden, denn es<br />
hängt von den realen Bewertungen des jeweiligen Tuns als diese oder jene bestimmte<br />
Handlung, den entsprechenden Stellungnahmen und normativen Konsequenzen<br />
ab. Damit hängt zusammen, dass Verstehen keine primär epistemische<br />
Frage der Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens bestimmter geistiger<br />
Zustände ist, sondern eine praktische Frage der letztlich gemeinsamen, kommunikativen<br />
Festlegung und Anerkennung eines Tuns als Handlung eines bestimmten<br />
Typs. 93 Präsident werde ich nicht, oder nur in meiner Einbildung, wenn ich<br />
mir eine bunte Schärpe um den Bauch binde, den Eid spreche etc.; zum Versprechen<br />
gehört nicht nur das Versprechengeben, sondern auch die Annahme des<br />
Versprechens durch den Adressaten u.a.<br />
Vor diesem Hintergrund kehrt sich das gesamte Bild des intentionalen Geschehens<br />
um: Die Privatheit geistiger Zustände erweist sich als Mythos. Sie ist<br />
nicht der „Standardfall“, sondern bezieht sich auf Beispielfälle von Personen, die<br />
an bestimmten fundamentalen Praxen gerade nicht teilnehmen und daher nicht<br />
unter deren Rationalitätsstandards fallen. Daher sind reale Beispiele für die „echte“<br />
Privatheit von Intentionen im Grunde nur als (relativ zu unseren Praxen) „pathologische“<br />
Fälle möglich, etwa als „idealtypischer“ Autismus oder rein affektives<br />
Verhalten wie im Wutausbruch etc., also als Modi des Verhaltens, die sich<br />
unseren „Gepflogenheiten“ und deren interner Rationalität entziehen. Wo sie dies<br />
nicht tun, sind uns die geistigen Zustände anderer nicht nur prinzipiell zugänglich,<br />
sondern es kann erst unter dieser Bedingung überhaupt von Absichten gesprochen<br />
werden. (Im Falle des nichtkalkulierten Wutausbruchs z.B. sprechen<br />
nämlich weder wir noch der Wüterich von einer absichtlichen Handlung.) Im<br />
Lichte des Privatsprachenargumentes erscheint die Möglichkeit skeptischer und<br />
dann auch solipsistischer Folgerungen mit Blick auf die Möglichkeit des Verstehens<br />
anderer daher als negatives Adäquatheitskriterium für Theorien des Geistes,<br />
des Verstehens, der Kommunikation und des individuellen wie des kollektiven<br />
Handelns: Dass eine Theorie skeptische, insbesondere aber solipsistische Konsequenzen<br />
als Normalfolgerungen zulässt, zeigt, dass sie dem Privatsprachenargument<br />
und seiner Verallgemeinerung als Privathandlungsargument nicht gerecht<br />
wird.<br />
Das Privatsprachenargument benennt damit ex negativo die Bedingungen<br />
sinnvoller Rede über „den Geist“, d.h. über Wahrnehmen und Handeln, Sprechen<br />
und Denken, über Sinn und Bedeutung, Intention und Richtigkeit, nämlich den<br />
Bezug auf geteilte Handlungs- und Praxisformen. Was eine Handlung ist, versteht<br />
man erst, wenn man das Handeln in der Gemeinschaft und seine Verobjek-<br />
93 Auch dies ein Kantscher Gedanke: Wir verfügen da über (apodiktisches) Wissen, wo wir „Gesetzgeber“<br />
sind. – Wir verstehen intentionales Geschehen, wo unsere Handlungs- und Praxisformen,<br />
unsere Kompetenzen und Festlegungen für dieses Geschehen in seiner normativen Formbestimmtheit<br />
konstitutiv sind.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 155<br />
tivierungen in gemeinsamen Praxisformen und Institutionen verstanden hat,<br />
wenn man die Gestalten des objektiven Geistes qua Gesamtheit der menschlichen<br />
Denk- und Handlungsmöglichkeiten als Bedingung der Möglichkeit individuellen<br />
Denkens, Beabsichtigens und Handelns begreift. Es bleibt dabei richtig,<br />
dass man Handlungen nur versteht, wenn man ihren geistigen Aspekt, ihre Intentionalität<br />
versteht, oder wie man mit Kambartel sagen könnte, wenn man sie als<br />
Aktualisierungen von Handlungstypen auffasst. 94 Aber das bedeutet gerade nicht,<br />
genauere Kenntnis der Zustände des individuellen Bewusstseins zu erlangen.<br />
Kurz: Das Privatsprachenargument läuft darauf hinaus, die Psychologisierung<br />
des Geistes zum individuellen Bewusstsein und damit auch den methodologischen<br />
Individualismus als allein gültige methodische Orientierung in den Geistes-<br />
und Sozialwissenschaften zurückzunehmen Denn die Psyche bleibt ohne den<br />
Hintergrund überindividueller Formen des Denkens und Handelns unverständlich.<br />
Sofern man über die Kritik irreführender Redeweisen und Problemstellungen,<br />
wie sie oben diskutiert worden sind, hinaus will, ist eine Art „Platonismus“ der<br />
kollektiven Praxisformen und Institutionen (bzw. der Sprachspiele) mit dem Privatsprachenargument<br />
nicht nur vereinbar, sondern dessen notwendige Ergänzung.<br />
Das Problem eines vernünftigen „Platonismus“ ist dabei nicht die Annahme<br />
von Praxisformen u.ä. „noumenaler“, bloß intelligibler Gegenstände – dieser<br />
und ähnliche Begriffe sind, wie das Privatsprachenargument zeigt, unvermeidlich.<br />
Das Problem ist vielmehr, wie man dem Begriff der Form eine Deutung geben<br />
kann, die sich nicht in den Fallstricken einer „Ideenlehre“ verfängt. M.a.W.:<br />
Es stellt sich die Frage nach der besonderen Existenzweise von Formen als reale<br />
Formen unserer Praxis. Nach dem Gesagten dürfte klar sein, dass diese Formen<br />
nicht in Kategorien des individuellen Handelns (gemäß dem hier kritisierten<br />
Standardmodell) expliziert werden können, sondern diesem begrifflich vorausgehen,<br />
oder Kantisch gesprochen: die Bedingung der Möglichkeit desselben darstellen.<br />
Als solche Bedingungen verweisen Praxisformen auf die normative Komponente<br />
unserer Praxen qua Systeme von miteinander verbundenen Handlungstypen,<br />
denn es geht gewöhnlich nicht nur darum, Handlungen auszuführen, sondern<br />
dies richtig, „nach den Regeln der Kunst“, zu tun. Die Trennung von „etwas<br />
tun“ und „etwas richtig tun“ ist aber nur analytisch möglich, denn als Vollzug einer<br />
Handlung zählt nur deren weitgehend richtige Ausführung – gewöhnlich sind<br />
Handlungsverben Erfolgsverben. Deutlich wird dies, wo es explizite Standards<br />
und Regeln für Handlungen eines bestimmten Typs gibt: Handauflegen zählt gewöhnlich<br />
nicht als medizinische Behandlung, selbst wenn es vom Akteur als solche<br />
intendiert ist und selbst wenn sich Heilungserfolge einstellen. Vor dem Startschuss<br />
oder in die falsche Richtung loszulaufen, zählt selbst bei Bestzeit nicht als<br />
Hundertmeterlauf. Die Identifikation einer Handlung als Aktualisierung eines<br />
94 Vgl. F. Kambartel: Autonomie, mit Kant betrachtet, S. 123ff.
156<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Handlungstyps erfolgt über deren Bewertung als (normativ und sachlich) richtiger<br />
Vollzug. Sie beinhaltet deshalb immer Momente der gemeinsamen Anerkennung,<br />
und sie lässt praktische (normative) Schlüsse zu. Nun gibt es, wie das Privatsprachenargument<br />
zeigt, Kriterien von richtig und falsch nur in einer kollektiven<br />
Urteilspraxis. Die genannten Formen sind deshalb nicht i.S. einer besonderen<br />
Realität hinter den Phänomenen, etwa als fixe „platonische Ideen“, zu deuten,<br />
sondern als gemeinsamer Rahmen der Bewertung und Anerkennung von<br />
Handlungen – und dieser kann sich ändern, etwa indem „neue“ Fälle als akzeptable<br />
Instanzen einer Praxis anerkannt werden oder indem ehemals anerkannten<br />
Fällen dieser Status entzogen wird, oder indem abweichende normative Folgen<br />
zum Normalfall erklärt werden etc. Zur Praxis gehört deshalb immer auch eine<br />
Urteilspraxis, ein Korpus der Anwendung und Anerkennung von Kriterien der<br />
Bewertung der Angemessenheit und Richtigkeit von Handlungen. Diese Kriterien<br />
müssen nicht notwendig als explizite Regeln vorliegen (wie beim Schachspiel),<br />
meist genügt eine Reihe von allgemein anerkannten Beispielen, Gegenbeispielen<br />
und Ausnahmen. Insofern existieren Praxisformen als generische in<br />
einer Vielzahl von Einzelhandlungen und in den entsprechenden Urteilen und<br />
Bewertungen. Diese Reflexionsebene muss wiederum nicht explizit sein, z.B. als<br />
Lob oder Tadel, sondern kann sich in passenden Anschlusshandlungen zeigen.<br />
(Im einfachsten Falle etwa in der Fortsetzung einer Kooperation oder im Ausbleiben<br />
von Widerspruch.)<br />
Aus dem Bezug auf gemeinsame Urteile und Praxisformen ergibt sich nun<br />
eine Besonderheit intentionaler Rede bzw. der Rede über geistige Phänomene:<br />
Diese ist immer auch normativ, sie verändert den Status der Personen, deren Äußerungen<br />
und Handlungen zur Debatte stehen, in ihren sozialen Beziehungen. In<br />
gewisser Weise verkehrt sich deshalb das Verhältnis von deskriptiver und präskriptiver<br />
Rede, wie es vom cartesianisch-lockeschen Programm unterstellt<br />
wird. 95 Denn das Urteil, eine Person habe etwas empfunden, gemeint, beabsichtigt<br />
oder verstanden, kann nicht als Konstatierung geistiger Zustände oder Akte<br />
des Akteurs behandelt werden, d.h. nicht als Behauptung, deren Wahrheitsbedingungen<br />
objektiv, d.h. unabhängig von jeder möglichen subjektiven Perspektive,<br />
Bewertung, Zuschreibung oder Anerkennung, festliegen. Das scheint dem Privatsprachenargument<br />
zu widersprechen. Ging es nicht gerade darum, dass subjektive<br />
Bewertungen gar nichts festlegen können? Nein. Denn das Privatsprachenargument<br />
besagt nur etwas über private und in diesem Sinne subjektive Urteile eines<br />
im relevanten Sinne isolierten Individuums. Hier ist aber die Rede von den<br />
gemeinsamen Kriterien, Bewertungen und Anerkennungen der Teilnehmer einer<br />
95 Man könnte auch sagen, dass die deskriptive oder konstative Redeweise eine besondere Praxis mit<br />
besonderen Normen bildet. Entsprechend ist der Begriff der Wahrheit normativ aufzufassen. Denn<br />
er ist an bestimmte, in einer Gemeinschaft allgemein anerkannte Begründungs- bzw. Rechtfertigungsverfahren<br />
für Behauptungen, also an eine besondere Praxis, etwa der Wissenschaften, gebunden,<br />
die auf Objektivität, d.h. auf Invarianz der Behauptungen gegenüber je spezifischen Perspektiven<br />
zielen. Ohne Bezug auf diese Verfahren ist es unsinnig, Wahrheitsansprüche zu stellen.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 157<br />
Praxis und deren kommunikativer Konvergenz und Veränderung, und diese sind<br />
notwendig an die Perspektive der Teilnehmer dieser Praxis gebunden.<br />
Die Alternative, dass jemand sich entweder im geistigen Zustand G befindet<br />
oder nicht befindet, die Intention I hat oder nicht hat, ist daher eine falsche Alternative.<br />
Denn bereits die Fragestellung präsupponiert, es gäbe hier fixe Kriterien<br />
der perspektiven- und wertungsunabhängigen Zuschreibung von geistigen Zuständen<br />
sowie dass Handlungen durch vorab fixierte Intentionen determiniert<br />
sind, mithin dass jeder Äußerung ein solcher geistiger Zustand logisch (und dann<br />
auch zeitlich) vorhergeht.<br />
Das Privatsprachenargument und seine Verallgemeinerung für Handlungen<br />
hat nun gezeigt, dass diese Annahme in Widersprüche führt. Heißt das, dass das<br />
Geistige deshalb prinzipiell unerkannt bleiben muss? Dass wir es im Falle des<br />
Seelischen mit einer Anwendung der Quineschen Unbestimmtheitsthese zu tun<br />
haben 96 , so dass Aussagen über die Absichten anderer, über das was sie glauben,<br />
lieben, fürchten etc. immer den Status von erklärenden Hypothesen aufgrund des<br />
sichtbaren Verhaltens haben, allerdings von Hypothesen, die nicht widerlegbar<br />
sind, weil uns der Blick in die Seele verwehrt ist? Hier wiederholt sich ein<br />
Grundmuster des Theoretisierens in den Bahnen naturwissenschaftlicher Erkenntnis:<br />
Beliebige Sätze werden als Konstatierungen gedeutet, Sätze, die intentionales<br />
Vokabular verwenden, entsprechend als Sätze über geistige Zustände,<br />
die, weil der Blick in die Seele nicht möglich ist, immer unsicher und unscharf<br />
sind.<br />
Damit wird der Status intentionaler Rede aber missverstanden. Denn bei der<br />
Selbst- und Fremdzuschreibung von Absichten und Überzeugungen handelt es<br />
sich nicht um sachhaltige Feststellungen, sondern um normativ gehaltvolle Festlegungen,<br />
d.h. um die Bewertung von (Sprech)Handlungen als Handlungen eines<br />
bestimmten Typs, die bestimmten Normen und Regeln unterliegen, die bestimmte<br />
praktische Folgen, etwa Statusänderungen der Person, nach sich ziehen und zu<br />
denen typische generische Absichten und Überzeugungen gehören. Die Unschärfe<br />
und Unbestimmtheit solcher Zuschreibungen ist nun kein epistemischer Mangel<br />
(das wäre sie, wenn es um Konstatierungen ginge), sondern eine notwendige<br />
Eigenschaft solcher Festlegungen. Sie hat ihren Grund darin, dass die Bewertungen<br />
und Zuschreibungen, damit sie gelten, gemeinsam anerkannt werden müssen.<br />
Denn es handelt sich dabei um praktisches Wissen mit praktischen Konsequenzen.<br />
Sie sind deshalb, wenigstens potentiell, immer auch „Verhandlungssache“,<br />
was die Möglichkeit von Revisionen ein- und letztgültige Feststellungen<br />
ausschließt. Anders als bei objektiv sachhaltigen Konstatierungen („Auf dem<br />
Hof steht eine Buche“) verändern sich die Kriterien in der gemeinsamen Urteilsund<br />
Zuschreibungspraxis, etwa indem sie an „neue“ Fälle angepasst werden bzw.<br />
diese als Beispiele des entsprechenden Handlungstyps gelten. Die Gültigkeit einer<br />
Konstatierung bemisst sich an ihrem Gegenstand, unabhängig von ihren Fol-<br />
96 So argumentiert etwa Kripke (Wittgenstein über Regeln und Privatsprache, S. 76f.).
158<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
gen und deren Bewertung; die Geltung einer Festlegung an der Akzeptanz der<br />
Kommunikationspartner (die freilich in bestimmte Praxen eingebunden sind),<br />
und zwar durchaus mit Blick auf die normativen Konsequenzen einer solchen<br />
Festlegung. Etwa wird eine Äußerung nicht dadurch zum Versprechen, dass sie<br />
mit der richtigen Absicht geäußert wird, sondern dadurch, dass sie im gegebenen<br />
Kontext die entsprechenden Konsequenzen hat und die beteiligten Personen auf<br />
bestimmte Handlungsweisen festlegt – die Rechte und Pflichten werden neu verteilt.<br />
Das ist zwar auch etwas, das konstatiert werden kann und in die Bewertung<br />
einer Äußerung als Versprechen und die Zuschreibung entsprechender seelischer<br />
Zustände eingeht – die Frage ihrer „privaten“ Existenz im Bewusstsein des Akteurs<br />
(oder als „Hirnzustand“) ist hierbei jedoch nebensächlich und für die Festlegung<br />
auf einen Handlungstyp irrelevant. 97 Das bedeutet nicht, dass Hirnzustände<br />
generell nicht von Interesse sind, möglicherweise kann einer aus hirnphysiologischen<br />
Ursachen z.B. nicht aufrichtig sein – an der kollektiven Bewertung ändert<br />
das zunächst nichts.<br />
Vor diesem Hintergrund sollte klar geworden sein, warum die als Basis der<br />
Naturalisierung des Geistes herausgestellte, gegenständlich gemeinte Frage, ob<br />
einer nun eine Überzeugung oder Absicht hat oder nicht hat, sich in einem seelischen<br />
Zustand befindet oder nicht befindet, schief gestellt ist. Sie unterstellt, dass<br />
die genaue Untersuchung des Individuums, etwa seiner neuronalen Aktivitäten,<br />
darüber Aufschluss geben könnte und setzt daher auf falsche Kriterien. 98 Auch<br />
die introspektive Untersuchung der Person durch sich selbst, die kraft der Autorität<br />
der ersten Person weiß, was sie will und glaubt, bringt nicht weiter. Denn Intentionen<br />
gibt es nur im Rahmen einer gemeinsamen, vom Individuum beherrschten<br />
Praxis der Festlegung auf Absichten und entsprechende Handlungen,<br />
der Selbst- und Fremdzuschreibung von Absichten und Ansichten und deren gemeinsamer<br />
Anerkennung. Nicht nur, dass wir Kriterien haben, ob andere heucheln<br />
oder nicht (der Begriff des Heuchelns wäre sonst leer) 99 , sondern es ist<br />
auch möglich, dass sich einer selbst missversteht und seine Absichten nicht<br />
kennt, etwa indem er glaubt, etwas unbedingt zu wollen, aber dann, wenn es gilt,<br />
einen Rückzieher macht, oder jemand meint, ein Versprechen zu geben, obwohl<br />
das, was er verspricht, dem Adressaten eine Drohung ist.<br />
Individuelle Intentionen und Überzeugungen bilden einen wichtigen Teil von<br />
Mustern absichtlicher (oder nicht unabsichtlicher), öffentlich nachvollziehbarer<br />
97 Wittgensteins Käferbeispiel (PU 293) ist hier instruktiv: Es läuft ja nicht darauf hinaus, dass niemand<br />
einen Käfer in der Schachtel hätte, sondern dass die „Käfer in den Schachteln“ jenseits gemeinsamer<br />
Vergleichs-, Bewertungs- und Kontrollmöglichkeiten irrelevant sind.<br />
98 Ryle spricht deshalb von einer Kategorienverwechslung; Putnam argumentiert mit Blick auf die I-<br />
dentifikation geistiger Zustände deshalb für einen externalistischen Standpunkt (Die Bedeutung<br />
von „‚Bedeutung“, S. 31ff.), allerdings deutet er die für die Bestimmung der intentionalen Gehalte<br />
relevanten externen Größen in erster Linie als ‚kausale‘ Größen, während hier von soziokulturellen<br />
die Rede ist.<br />
99 Vgl. auch Wittgenstein zum Lügen: „Das Lügen ist ein Sprachspiel, das gelernt sein will wie jedes<br />
andere.“ (PU 249)
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 159<br />
und kontrollierbarer Handlungen (qua Aktualisierung von Handlungstypen), und<br />
als solche lassen sie sich auch identifizieren, oder genauer: dem Akteur zuschreiben.<br />
Daher sind auch Überzeugungen und Absichten des Einzelnen prinzipiell<br />
öffentlich, denn sie gehören zum Verständnis typischer Handlungen im Rahmen<br />
geteilter Praxen. Ohne diesen Rahmen hätte die Rede von Absichten und Überzeugungen<br />
keine Funktion, sie wäre sinnlos, ein „funktionsloser Schalter“ (Wittgenstein).<br />
Nur in diesem Rahmen artikuliert sie einen Unterschied, und zwar erst<br />
in zweiter Linie einen epistemischen, der die Wahrheitsbewertung von Konstatierungen<br />
betrifft. Primär geht es um praktische Unterschiede des normativen Status,<br />
etwa welche Konsequenzen einer für sein Tun zu tragen hat, welche Verpflichtungen<br />
er übernimmt, wie sein Tun und dann er selbst moralisch, d.h. mit<br />
Blick auf mögliche Kooperationen, zu beurteilen ist, welche Anschlusshandlungen<br />
möglich sind etc. Und erst in diesem Rahmen gewinnen auch die Selbstzuschreibungen<br />
und die Festlegungen der Person auf Handlungspläne, also Absichten,<br />
die gewöhnlich als Selbstauskünfte daherkommen, Gewicht. Motive, Absichten<br />
und Überzeugungen müssen deshalb nicht notwendig vor der Handlung<br />
als deren Ursache festliegen, sondern werden oft erst im Nachhinein festgelegt,<br />
eben dann, wenn es um die Neuverteilung von Rechten, Pflichten und Folgelasten<br />
geht. Wie glaubwürdig solche Selbstauskünfte dann sind, hängt nicht zuletzt<br />
davon ab, wie der Akteur in der Vergangenheit gehandelt und welche Beschreibungen<br />
seines Tuns er gewählt hat, wie er gewohnheitsmäßig handelt, welche Interessen<br />
er aus der Sicht seines tatsächlichen Handelns vermutlich verfolgt hat<br />
und wie diese in das Gesamtbild seiner Person passen. Das Publikum, welches<br />
hier als Schiedsrichter fungiert, lässt sich nicht so leicht täuschen, jedenfalls<br />
nicht so leicht, wie man sich selbst täuschen kann. 100 Dass wir die Glaubwürdigkeit<br />
von Selbstauskünften mit Gründen in Frage stellen können, zeigt, dass die<br />
Autorität der ersten Person und damit die Selbstgewissheit und Unkorrigierbarkeit<br />
des unmittelbaren Selbstbewusstseins ein Mythos ist.<br />
Literatur<br />
Austin, J. L. 1972: Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). Stuttgart:<br />
Reclam<br />
Brandom, R. 1994: Making it explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment.<br />
Cambridge, Mass.: Harvard UP.<br />
Bratman, M. 1999: Shared cooperative activity. In: Bratman, M.: Faces of Intention. New<br />
York; Cambrigde: Cambridge UP, S. 93-108.<br />
100 Die Rede davon, dass einer im Spiegel seiner Taten sich selbst erkennt, ist nur vor dem Hintergrund<br />
der Möglichkeit einer Differenz der öffentlichen und der privaten Bewertung des eigenen<br />
Tuns sinnvoll, d.h. vor dem Hintergrund der doppelten Möglichkeit, nur zu glauben, einen Handlungstyp<br />
zu aktualisieren und dies dann auch einzusehen (ein tragisches Beispiel ist König Ödipus).<br />
Vor dem Hintergrund individualistischer Unfehlbarkeitsannahmen, insbesondere der Individuation<br />
von Handlungen durch individuelle Absichten, ist sie dagegen unsinnig.
160<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Canfield, J. V.: The community view. Philosophical Review 105 (1996), No. 4, S. 469-<br />
488.<br />
Carnap, R. 1998: Der logische Aufbau der Welt. Hamburg: Meiner.<br />
Chomsky, N. 1981: Regeln und Repräsentationen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp<br />
Davidson, D. 1963: Handlungen, Gründe und Ursachen. In: Handlung und Ereignis.<br />
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990, S. 19-42.<br />
Davidson, D. 1982: Konvention und Kommunikation. In: Handlung und Ereignis. Frankfurt<br />
a. M.: Suhrkamp,1990, S. 372-393.<br />
Davis, W. A.: Meaning, Expression and Thought. Cambridge: Cambridge UP 2003.<br />
Descartes, R. 1637: Abhandlung über die Methode (=Abhandlung). In: Ausgewählte<br />
Schriften. Leipzig: Reclam, 1980, S. 5-65.<br />
Descartes, R. 1641: Meditationen über die Erste Philosophie. (=Meditationen) (übersetzt<br />
von G. Schmidt). Stuttgart: Reclam, 1980.<br />
Descartes, R. 1644: Prinzipien der Philosophie.(=Prinzipien) (Zit. nach der Übersetzung<br />
v. J. H. von Kirchmann, 1870, Hamburg: Meiner, 1908, 3. Aufl.)<br />
Descartes, R.1649: Über die Leidenschaften der Seele. In: Ausgewählte Schriften. Leipzig:<br />
Reclam, 1980, S. 229-337.<br />
Descartes, R.: Regeln zur Leitung des Geistes (=Regeln). In: Ausgewählte Schriften.<br />
Leipzig: Reclam, 1980, S. 67-155.<br />
Frege, G. 1914: Logik in der Mathematik. In: Hermes, H.; F. Kambartel; F. Kaulbach; G.<br />
Gabriel; C. Thiel und A. Veraart (Hrsg.): Gottlob Frege: Nachgelassene Schriften und<br />
Wissenschaftlicher Briefwechsel. Bd. 1. Hamburg: Meiner, 1976, S. 219-270.<br />
Gehlen, A. 1986: Urmensch und Spätkultur. Wiesbaden: Aula-Verlag.<br />
Grice, H. P. 1993: Logik und Konversation. In: Meggle, G. (Hrsg.): Handlung, Kommunikation,<br />
Bedeutung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 243-265.<br />
Henning, C. 2004: Kausalität und Wahrheit, Diss. Leipzig.<br />
Kambartel, F. 1989: Autonomie, mit Kant betrachtet. Zu den Grundlagen von Handlungstheorie<br />
und Moralphilosophie. In: Philosophie der humanen Welt. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp, S. 117-131.<br />
<strong>Kannetzky</strong>, F. 2001: The Principle of Expressibility and Private Language. Acta philosophica<br />
fennica 69 (2001), S. 191-212.<br />
<strong>Kannetzky</strong>, F. 2003: Some Problems of a Conventionalist Approach to Communication,<br />
Meaning, and Understanding. In: G. Meggle & C. Plunze (eds.): Saying, Meaning,<br />
Implicating. Leipzig: Universitätsverlag, S. 30-62.<br />
<strong>Kannetzky</strong>, F. 2004: Levels of Collectivity. In: N. Psarros u.a. (eds.): Facettes of Sociality<br />
– Philosophical Approaches to Co-operative Action. Frankfurt a.M.: Ontos-Verlag<br />
(im Erscheinen).<br />
Kripke, S. A. 1987: Wittgenstein über Regeln und Privatsprache. Eine elementare Darstellung.<br />
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.<br />
Lewis, D. 1975: Konventionen. Berlin; New York: de Gruyter.<br />
Locke, J. 1690: Essay concerning human understanding. (=Versuch) (Zitiert nach der dt.<br />
Übers. von J. H. von Kirchmann: Versuch über den menschlichen Verstand. Berlin: L.<br />
Heimann 1872/73).<br />
Meggle, G. 1997: Grundbegriffe der Kommunikation (2. Auflage). Berlin; New York: de<br />
Gruyter.<br />
Putnam, H. 1990: Die Bedeutung von „Bedeutung“. Frankfurt a.M.: Klostermann.<br />
Quine, W. V. O. 1951: Zwei Dogmen des Empirismus. In: Von einem logischen Standpunkt.<br />
Frankfurt a. M.: Ullstein, 1979, 27-50.
<strong>Cartesianische</strong> <strong>Prämissen</strong> 161<br />
Quine, W. V. O. 1980: Wort und Gegenstand (Word and Object). Stuttgart: Reclam.<br />
Raatzsch, R. 2000: Philosophiephilosophie. Ditzingen: Reclam.<br />
Raatzsch, R. 2002: Eigentlich Seltsames. Paderborn: Schöningh.<br />
Rorty, R. 1970: Incorrigibility as the Mark of the Mental. Journal of Philosophy 67, S.<br />
406-424.<br />
Roth, G.; Singer, M.; Frederici, A. u.a.: Das Manifest. Elf führende Neurowissenschaftler<br />
über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Gehirn & Geist 6/2004, S. 30-37.<br />
Ryle, G. 1969: Der Begriff des Geistes. Stuttgart: Reclam<br />
Savigny, E. v. 1983: Zum Begriff der Sprache. Sprache, Konvention, Bedeutung.. Stuttgart:<br />
Reclam.<br />
Schroeder, S. 1998: Das Privatsprachen-Argument. Wittgenstein über Empfindung &<br />
Ausdruck. Paderborn: Schöningh.<br />
Searle, J. R. 1971: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.<br />
Searle, J. R. 1990: Collective Intentions and Actions. In: P. Cohen, J. Morgan & M. Pollack<br />
(eds.): Intentions in Communication. Cambridge/Mass.: MIT Press, S. 401-415.<br />
Searle, J. R. 1991: Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes. Frankfurt:<br />
Suhrkamp.<br />
Searle, J. R. 1997: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Reinbek b. Hamburg:<br />
Rowohlt.<br />
Schelling, F. W. J. 1856: Zur Geschichte der neueren Philosophie. In: Sämtliche Werke.<br />
Hrsg. v. K. F. A. Schelling. Stuttgart 1856ff. 1. Abt., Bd. X. (zitiert nach der Reclam-<br />
Ausgabe, Leipzig, 1984).<br />
Shannon, C. E.; Weaver, W. 1949: The Mathematical Theory of Communication. Urbana:<br />
Univ. of Illinois Press.<br />
Stekeler-Weithofer, P. 1995: Sinn-Kriterien. Paderborn: Schöningh.<br />
Stekeler-Weithofer, P. & G. Meggle 2002: Handlung und Bedeutung. Ein methodenkritischer<br />
Diskurs. In: M. Siebel (Hrsg.): Kommunikatives Verstehen. Leipzig: Universitätsverlag,<br />
2002, S. 21-46.<br />
Stekeler-Weithofer, P. 2005: Absicht und Begierde. In: P. Grönert & F. <strong>Kannetzky</strong><br />
(Hrsg.): Sprache und Handlungsform. Leipzig: Universitätsverlag.<br />
Tuomela, R. & K. Miller 1988: We-Intentions. Philosophical Studies 53 (1988), S. 115-<br />
137.<br />
Wellmer, A. 1999: Verstehen und Interpretieren. In: H. J. Schneider/M. Kroß (Hrsg.): Mit<br />
Sprache spielen. Die Ordnungen und das Offene nach Wittgenstein. Berlin: Akademie-Verlag,<br />
S. 51-76.<br />
Wellmer, A. 2004: Sprachphilosophie. Eine Vorlesung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.<br />
Wittgenstein, L. 1989: Philosophische Untersuchungen. In: Werke, Bd. 1. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp.<br />
Wright, G. H. v. 1991: Erklären und Verstehen. (3. Aufl.). Frankfurt a.M.: Hain.