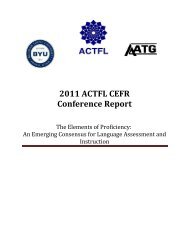Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
152<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
tradieren kollektive Problemlösungen und optimierte Verläufe des Umgangs mit<br />
der natürlichen und der sozialen Welt. 89 Und umgekehrt ist die Welt nichts anderes,<br />
als die Gesamtheit der Gegenstände möglicher Handlungen. Insofern ist der<br />
Geist a priori „welthaltig“ und unsere Welt nicht „geistlos“, die Unterscheidung<br />
von Geist und Welt ist keine absolute Unterscheidung, sondern eine innerhalb<br />
unserer Praxisformen.<br />
Im Tractatus schreibt Wittgenstein „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten<br />
die Grenzen meiner Welt“, und weiter, dass der Solipsismus das richtige meint<br />
(Tractatus 5.6). Ist Wittgenstein hier in die gleiche Falle getappt wie die von<br />
Descartes und Locke begründete philosophische Tradition? Im Lichte des Privatsprachenargumentes,<br />
d.h. der Unmöglichkeit einer Privatsprache, besagt dies<br />
nichts weiter, als dass individuelle Erfahrungen und Handlungen an gemeinschaftliche<br />
Praxisformen als deren Präsuppositionen gebunden sind. „Die Grenzen<br />
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ heißt dann: „Meine Welt<br />
ist durch die Handlungs- und Praxisformen der (Sprach-)Gemeinschaft festgelegt,<br />
der ich angehöre.“ 90 Für mein Empfinden, Denken, Wollen und deren Weltbezüge<br />
bedeutet dies, dass sie, obwohl es individuelle Vorgänge sind, durch öffentliche<br />
Vorgänge und Institutionen, insbesondere sprachliche Repräsentationen,<br />
in ihren Gehalten bestimmt sind, denn wofür es keine Artikulationsmöglichkeiten<br />
und damit auch keine öffentliche Kontrolle gibt, das macht keinen Unterschied,<br />
es existiert nicht für das Denken und Handeln.<br />
Das Privatsprachenargument gibt damit auch einen methodischen Hinweis,<br />
wie das notorische Problem des Verstehens angegangen werden kann. Es legt eine<br />
radikale Blickwendung nahe. Denn die Frage des Verstehens wird unter cartesianisch-lockeschen<br />
<strong>Prämissen</strong> falsch gestellt: Man verstehe sich und die eigenen<br />
(Sprech-)Handlungen unmittelbar, weil man seine eigenen Überzeugungen und<br />
Absichten kenne. Die Überzeugungen und Absichten anderer kenne man aber<br />
nicht, jedenfalls nicht unmittelbar, also verstehe man ihre Handlungen nicht, jedenfalls<br />
nicht unmittelbar, sondern nur vermittels immer fallibler Interpretationen<br />
und Zuschreibungen. Hier hakt das (verallgemeinerte) Privatsprachenargument<br />
an zwei eng miteinander verbundenen Stellen ein: Erstens wird bezweifelt,<br />
dass man eine Handlung versteht, wenn man die subjektive Absicht des Akteurs<br />
kennt. Genauer: Zwecke und damit auch Absichten sind nur im Rahmen geteilter<br />
89 Vgl. dazu A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur. Teil I: Institutionen, S. 202 und passim. Gehlen<br />
spricht statt von Handlungs- und Praxisformen von Institutionen; hier werden Institutionen eher als<br />
deren Vergegenständlichung bzw. Verobjektivierungen aufgefasst.<br />
90 In gewisser Weise wird damit Kants Einsicht wiederholt, dass es jenseits unserer Anschauungsformen<br />
und Begriffe keine Realität „an sich“ gibt. Kants ‚Fehler‘ (oder der seiner Interpreten) ist,<br />
dass diese Anschauungs- und Urteilsformen nicht als gemeinsame und generische konzipiert sind,<br />
sondern als universelle (im Sinne der logischen Universalität, dass eine Eigenschaft auf beliebige<br />
Individuen des universellen Gegenstandsbereiches zutrifft oder nicht zutrifft). Der Unterschied ist,<br />
dass gemeinsame Formen in Anerkennungsprozessen etabliert werden, sie sind normativ. Aus der<br />
Perspektive des urteilenden Individuums erscheinen sie aber als universelle, quasi objektive Formen,<br />
schon aus dem Grund, dass sie als vorgegebene Formen erlernt und eingeübt werden müssen.