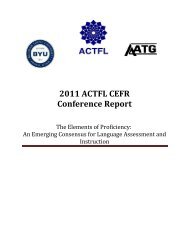Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
108<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
von Begriffen des Geistes, des Sinns und des Verstehens auf Handlungen nichts,<br />
solange man Handlungen (und damit auch Sprechhandlungen) wesentlich unter<br />
Bezug auf den subjektiven Handlungssinn, also auf individuelle Absichten erklärt.<br />
Die Beschäftigung mit Descartes und Locke zeigt, wie tief die Vorstellungen<br />
von Geist, Sprache und Bedeutung, die mit dem Privatsprachenargument zurückgewiesen<br />
werden, in der philosophischen Tradition verankert sind und wie<br />
weit entsprechende Beschreibungen die Reflektion auf unser Tun prägen. Es ist<br />
ein Irrtum zu glauben, nur weil wir heute eine andere Terminologie verwenden,<br />
hätten sich die Konzeptualisierungen wesentlich verändert. Dies nachzuweisen<br />
und den Typus der aufgrund des Privatsprachenargumentes problematischen<br />
Begriffsbildungen zu charakterisieren, dienen die beiden folgenden Abschnitte<br />
zum cartesianisch-lockeschen Bild des Geistes. Damit sollte die systematische<br />
Relevanz und die Reichweite des Privatsprachenargumentes über bedeutungstheoretische<br />
Fragen hinaus klar werden: Es betrifft die Philosophie überhaupt.<br />
Den Nachweis dafür will ich im vierten Abschnitt führen, indem ich das Privatsprachenargument<br />
skizziere und vorschlage, es nicht nur als i.e.S. sprachphilosophisches<br />
bzw. bedeutungstheoretisches, sondern v.a. als handlungstheoretisches<br />
Argument zu lesen und es entsprechend für Intentionen und Handlungen<br />
überhaupt zu verallgemeinern (Privathandlungsargument). Es zeigt, insbesondere<br />
in dieser Verallgemeinerung, ein grundlegendes Problem des Philosophierens im<br />
Rahmen cartesianisch-lockescher <strong>Prämissen</strong>. Bekanntlich verweigert sich Wittgenstein<br />
dem Aufbau einer „positiven“ Theorie, und dafür gibt es gute Gründe. 5<br />
Nun ist hier nicht der Ort, eine solche Theorie aufzubauen, selbst wenn sie möglich<br />
sein sollte. Ich beschränke mich daher auf die Darlegung einiger Konsequenzen<br />
und methodischer Anhaltspunkte, denen eine Theorie des Geistes und<br />
der Handlung gerecht werden muss, wenn sie dem, was das Privatsprachenargument<br />
ex negativo zeigt, gerecht werden will.<br />
2. Das cartesianische Bild des Geistes<br />
2.1 Das cartesianische Subjekt<br />
Descartes hält sich einiges darauf zugute, dass seine Auffassungen einfach sind<br />
und mit dem gesunden Menschenverstande übereinstimmen, 6 dass sie jeder, der<br />
dardmodell der Handlung als intentionales Verhalten und folgerichtig in allen Theorien, die auf diesem<br />
Handlungsbegriff ruhen, insbesondere in Theorien kollektiven Handelns und der neueren Sozialphilosophie.<br />
Beispiele dafür sind, trotz großer Unterschiede im Detail, die Theorien des gemeinsamen<br />
Handelns und des „Wir“, wie sie von R. Tuomela, M. Gilbert, M. Bratman und J. Searle<br />
vorgelegt worden sind. (s. dazu auch <strong>Kannetzky</strong> 2004).<br />
5 Vgl. Raatzsch, R.: Eigentlich Seltsames. Paderborn: Schöningh, 2002, ders.: Philosophiephilosophie.<br />
Ditzingen: Reclam, 2000.<br />
6 Vgl. R. Descartes: Abhandlung über die Methode (im folgenden: Abhandlung), VI/17, S. 64 und<br />
passim. Zum cartesianischen Bild des Geistes im allgemeinen vgl. auch Ryles Der Begriff des Geis-