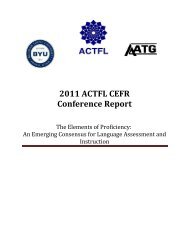Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
150<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
von Absichten und Überzeugungen nicht als Konstatierung geistiger Zustände<br />
oder Vorgänge aufgefasst werden. Denn sie ist nicht monologisch, sondern „dialogisch“<br />
verfasst, 86 hängt also von der Möglichkeit kommunikativen Verstehens<br />
und damit von entsprechenden öffentlichen, v.a. sprachlichen Artikulationsmöglichkeiten<br />
ab. (Ob eine Handlung geglückt ist, hängt nicht davon ab, dass der Akteur<br />
glaubt, sie sei geglückt, sondern von der potentiell öffentlichen Bewertung<br />
als Aktualisierung einer bestimmten Handlungsform, der entsprechend dann auch<br />
Absichten und Überzeugungen zugeschrieben, und als Kompetenz ihrer Aktualisierung,<br />
auch „gehabt“ werden.) Die Frage nach dem subjektiven Handlungssinn,<br />
danach ob und welche Überzeugungen oder Absichten einer hat oder nicht<br />
hat, taugt folglich nicht zur Basisfrage einer Handlungstheorie – das Privatsprachenargument<br />
zeigt, dass der Bezug auf ein (impersonales) Wir, auf gemeinschaftliche<br />
Praxisformen und Institutionen für das Haben von Absichten konstitutiv<br />
ist. Der wesentliche Bezugsrahmen der Rede von Handlungen, Absichten<br />
und Überzeugungen ist deshalb nicht das monadische Individuum und sein Bewusstsein,<br />
sondern das sozialisierte und akkulturierte Individuum und damit die<br />
Praxisformen der Gemeinschaft. Diese Verallgemeinerung des Privatsprachenargumentes<br />
nenne ich das Privathandlungsargument, es bezieht sich auf beliebige<br />
intentionale Gehalte, auf beliebige Denk- und Handlungsmöglichkeiten des<br />
Menschen, also das, was im Unterschied zu naturgesetzlichen Verläufen gewöhnlich<br />
der Sphäre des Geistes zugeordnet wird, und es zeigt, dass diese nicht primär<br />
als personale Kompetenzen oder dem Individuum „natürlich“ gegebene, wenngleich<br />
„kulturell überformte“ Vermögen, etwa des Wahrnehmens, des (vernünftigen)<br />
Urteilens, Sprechens und Wollens, zu konzipieren sind. 87<br />
86 Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass das Individuum Entschlüsse fassen, sich auf Handlungen<br />
festlegen etc. kann. Aber: Es kann dies nur als kompetenter Teilnehmer gemeinsamer Praxen,<br />
d.h. als Person, die sich gemeinsame Handlungsformen (einschließlich ihrer Normen) angeeignet<br />
hat, welche den Gehalt möglicher Absichten bilden. Entsprechend ist auch der innere Monolog<br />
dialogisch verfasst, z.B. als Abwägung (potentiell) gemeinsam anerkannter Handlungsgründe<br />
(Soll ich dieses oder jenes tun? Was bin ich für ein Mensch, wenn ich das begehre?) oder als Wahl<br />
der im Lichte kollektiver Bewertungen richtigen Beschreibungen der eigenen Handlungen. (Wird<br />
das als Notwehr durchgehen? Werde ich als Gimpel dastehen? Verhindert mein Tun künftige Kooperationen,<br />
weil ich dann als Trittbrettfahrer gelte?) Der innere Monolog ist seinem Gehalt nach<br />
kein Monolog, sondern Selbstvergewisserung im Lichte allgemein geltender Normen, er ist Darstellung<br />
und Rechtfertigung möglichen Handelns vor einer im Laufe des Erwerbs von Handlungskompetenzen<br />
internalisierten Öffentlichkeit bzw. vor einem imaginären, potentiellen Publikum.<br />
87 Dies gilt analog auch für die Überlegung, normative Praxen wie die Sprachpraxis (und dann auch<br />
Begriffe wie Sprachgebrauch, Sprache, Bedeutung, propositionaler und intentionaler Gehalt etc.)<br />
auf das empirisch erfassbare Sanktionsverhalten der in einer Gruppe organisierten Individuen zurückzuführen<br />
(etwa in E. von Savignys Zum Begriff der Sprache oder auch in R. Brandoms Making<br />
it explicit). Dabei muss man, um zirkuläre Erklärungen zu vermeiden, von „privat“, d.h. unabhängig<br />
von den fraglichen Praxen, sanktionierenden Individuen ausgehen. Damit ergibt sich a-<br />
ber sofort das Problem, dass diese, weil sie nach Voraussetzung nicht normgebunden entscheiden<br />
(individuelle Normen sind nach dem Privatsprachenargument nicht möglich), rein dezisionistisch,<br />
nach kontingenten individuellen Präferenzen sanktionieren. Eine normative Praxis setzt aber geteilte<br />
normative Erwartungen voraus, und erst in diesem Rahmen ist es sinnvoll, überhaupt von<br />
Sanktionen, also von Reaktionen auf Regelverstöße im Unterschied zu bspw. intrinsisch aggressi-