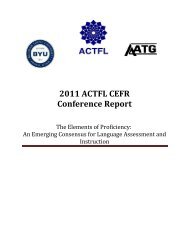Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
140<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
Denn mit dem Naturalisierungsprogramm wird die cartesianisch-lockesche<br />
Konzeption in ihrem wichtigsten Stück beibehalten: Grundphänomen ist das individuelle<br />
Seelenleben, das als solches scheinbar keiner weiteren Erläuterung<br />
bedarf. Dass ich etwas wahrnehme, glaube oder will, wird als selbstverständlich<br />
bekanntes Phänomen vorausgesetzt – jeder weiß, worum es geht. Als erklärungsbedürftig<br />
zählt deshalb nicht, was es im gewöhnlichen Sinne bedeutet, etwas<br />
wahrzunehmen etc., sondern nur, wie dies in einer Welt von physikalischen Teilchen<br />
möglich sein kann. Genau diese Selbstverständlichkeit wird im Privatsprachenargument<br />
befragt: Etwas wahrzunehmen, zu empfinden, glauben oder wollen<br />
bedeutet, etwas Bestimmtes wahrzunehmen etc. Bevor man sich an die (kausale)<br />
Erklärung der fraglichen Phänomene machen kann, muss erläutert werden,<br />
was die Bestimmtheit geistiger Phänomene bedeutet (d.h. auch: was sie impliziert).<br />
M.a.W.: Es ist zunächst nicht erläuterungsbedürftig, dass ich etwas wahrnehme,<br />
glaube oder will, sondern dass ich etwas Bestimmtes wahrnehme, glaube<br />
oder will. 72 An der Bestimmtheit hängt alles! Denn ohne die Bestimmtheit der intentionalen<br />
Zustände, ohne Kriterien ihrer Identifikation und Individuation laufen<br />
naturalistische Erklärungen ins Leere, schlicht weil der Erklärungsgegenstand<br />
unterbestimmt wäre. Das heißt, die Individuations- und Identifikationskriterien<br />
für Intentionen müssen aus logischen Gründen unabhängig von naturalistischen<br />
Beschreibungen und Erklärungen geistiger Zustände festliegen, andernfalls<br />
wären letztere von vornherein unmöglich – schlicht mangels Gegenstand.<br />
Die Frage ist nun, welche Kriterien hier möglich sind. Die cartesianischlockesche<br />
Antwort ist nach dem Vorangegangenem klar: Die Selbstauskunft des<br />
Individuums, weil es hinsichtlich seines Bewusstseins die letzte Autorität darstellt.<br />
Das Modell setzt voraus, dass das Subjekt (sei es als Sprecher, sei es als<br />
Akteur), für sich schon weiß, was es meint oder will, und zwar unabhängig von<br />
der Interaktion und Kommunikation mit anderen. Folglich wird eine Art Privatsprache<br />
vorausgesetzt, andernfalls gäbe es im Modell keine Bestimmtheit von Intentionen.<br />
73 Das Privatsprachenargument zeigt nun, dass ein im cartesianischlockeschen<br />
Sinne isoliertes, d.h. ein monadisches Subjekt nicht über Identifikati-<br />
72 Es wird unterstellt, dass „etwas“ und „etwas Bestimmtes“ die gleiche Extension haben – was zweifellos<br />
richtig ist, aber eben erklärungsbedürftig. Reden wir von „etwas“, dann ist gewöhnlich der<br />
(Rede-)Bereich, auf den sich „etwas“ als eine Art unbestimmter Quantor bezieht, mehr oder minder<br />
klar bestimmt, jedenfalls so weit, wie es möglich und nötig ist. „Etwas“ steht dann für einen<br />
Gegenstand einer dieser Sorte oder dieses Typs von Gegenständen. Mithin sind, je nach Redekontext,<br />
nicht beliebige Einsetzungen möglich. Wellmer spricht hier von der Notwendigkeit „kategorialer<br />
Erläuterungen“ (Sprachphilosophie, S. 99). Das Problem der Bestimmtheit haben schon Herder,<br />
Fichte, Hegel und Humboldt als Zentralproblem jeder Beschreibung und Erklärung der Phänomene<br />
des individuellen Bewusstseins erkannt. Da Wittgensteins Argumente genau diesen Punkt<br />
thematisieren, ist es sinnvoll, die Philosophischen Untersuchungen trotz aller Unterschiede, etwa<br />
mit Blick auf die Möglichkeit einer „Systemphilosophie“, in deren Tradition zu stellen.<br />
73 Vgl. dazu auch Searles Prinzip der Ausdrückbarkeit in Sprechakte, nämlich „daß man alles, was<br />
man meinen, auch sagen kann.“ (Sprechakte, S. 34). Searle selbst meint, dass dies die Möglichkeit<br />
einer Privatsprache nicht ausschließt (Sprechakte, S. 35). Ich glaube aber, dass allein schon dieses<br />
Prinzip mit der Möglichkeit einer Privatsprache nicht kompatibel ist (vgl. dazu <strong>Kannetzky</strong> 2001).