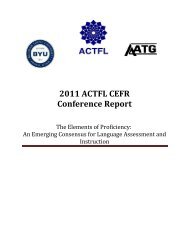Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Kannetzky Cartesianische Prämissen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
138<br />
Frank <strong>Kannetzky</strong><br />
delns, d.h. Praxisformen, die Funktion der ersten Substanz übernehmen, erscheinen<br />
angesichts ihrer vermeintlichen ontologischen Verpflichtungen obskur und<br />
unwissenschaftlich. Denn die modernen Wissenschaften scheinen uns zum einen<br />
auf einen materialistischen Monismus, zum anderen auf den Verzicht auf „Kollektivbegriffe“<br />
auf der „Basisebene“ der Ontologie festzulegen.<br />
4. Das Privatsprachenargument und seine Folgen<br />
4.1 Zur Reichweite des Privatsprachenarguments<br />
Ich möchte kurz zusammenfassen: Das Grundphänomen, das letztlich dem naturalistischen<br />
Forschungsprogramm und damit auch der neuerdings wieder in<br />
Mode gekommenen Idee einer wissenschaftlichen Philosophie (oder Weltanschauung<br />
samt ihrem Versprechen einer Entlastung von normativen Fragen) die<br />
Problemsstellung vorgibt, ist die Selbstgewissheit des cartesianischen Subjektes<br />
samt seiner Korollare, dem Intentionalismus (bzw. Mentalismus) und Interpretationismus<br />
in der Bedeutungs- und Kommunikationstheorie sowie in der Handlungstheorie<br />
und dem Atomismus in der Sozialphilosophie. Von Locke bis hin<br />
zum gegenwärtigen Empirismus in Handlungstheorie, Kognitionswissenschaft<br />
etc. wird in cartesianischer Tradition das folgende Bild intentionalen Geschehens<br />
gezeichnet: Meinen, Wollen, Verstehen und andere intentionale Begriffe bezeichnen<br />
psychische Zustände, Akte oder Tätigkeiten des Individuums. Intentionen<br />
sind demnach innere Zustände oder Vorgänge mit einer bestimmten Erlebnisqualität.<br />
69 Plausibel wird dieses Bild durch die Berufung auf allseits bekannte<br />
Phänomene, z.B. die Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit willentlich zu steuern<br />
und Erinnerungen und Vorstellungsbilder bewusst herbeizurufen oder durch charakteristische<br />
Erlebnisse wie das „Aha-Erlebnis“ beim Verstehen. Ich hatte diese<br />
Auffassung als Psychologisierung des Geistes charakterisiert, welche zu einer<br />
Reifizierung geistiger Vorgänge als deskriptiv erfassbare empirische Entitäten<br />
führt. Deren Identifikations- und Individuationskriterien sind bewusstseinsimmanent<br />
und liegen daher letztlich in der Autorität der ersten Person. Sie sind denen<br />
des naturalistischen Programms (etwa der Definition bestimmter Hirnzustände)<br />
vorausgesetzt, indem sie die Gegenstände der naturalistischen Erklärungen<br />
konstituieren. Das Naturalisierungsprogramm ist daher an die cartesianische<br />
Prämisse gebunden, dass Geist individuelles Bewusstsein ist – das ist seine<br />
Sinnbedingung. Denn andernfalls könnten uns weder Psychologie noch die Neurowissenschaften<br />
als empirische Disziplinen irgend etwas über den Geist sagen.<br />
Voraussetzung dafür war die Annahme einer Privatsprache bzw. einer Sprache<br />
69 „Und wir tun hier, was wir in tausend ähnlichen Fällen tun: Weil wir nicht eine körperliche Handlung<br />
angeben können, die wir das Zeigen auf die Form (im Gegensatz z.B. zur Farbe) nennen, so<br />
sagen wir, es entspreche diesen Worten eine geistige Tätigkeit. Wo uns unsere Sprache einen Körper<br />
vermuten läßt, und kein Körper ist, dort, möchten wir sagen, sei ein Geist.“ (PU 36)