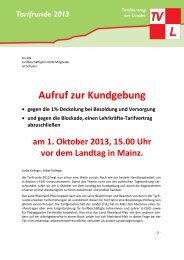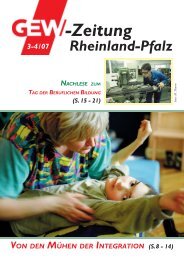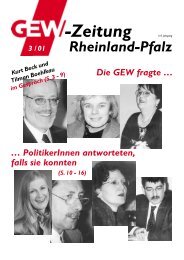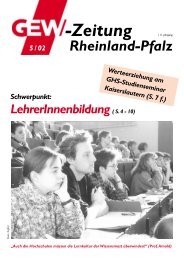Seite 1 von 1 Schulen Entwicklung der Klassengrössen und die Lehrerwochenstunden je SchülerIn in den allgemein- und berufsbildenden Schulen - von Dieter Ross - Entwicklung der Klassengrößen und die Lehrerwochenstunden je SchülerIn in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen Schuljahr Schulen Klassen/ Gruppen SchülerInnen SchülerInnen je Klasse/ Gruppe Lehrer- + PFwochenstunden Lehrer- + PF-wochenstunden je SchülerIn 2001/02 111 115 1.364 11,9 2.968,80 2,2 2002/03 108 111 1.268 11,4 2.655,49 2,1 2003/04 106 109 1.272 11,7 2.532,74 2,0 Schulkindergärten 2004/05 104 108 1.211 11,2 2.173,55 1,8 und 2005/06 97 99 1.023 10,3 2.141,99 2,1 Förderschulkindergärten 2006/07 93 97 1.030 10,6 2.521,39 2,4 2007/08 88 92 917 10,0 2.067,98 2,3 2008/09 77 84 989 11,8 2.199,85 2,2 2009/10 59 61 712 11,7 1.487,44 2,1 2010/11 50 52 544 10,5 1.133,50 2,1 Die Anzahl der Einrichtungen ist deutlich zurückgegangen und wird unter dem Aspekt der Integration bzw. Inklusion weiter zurückgehen. Grundschulen Hauptschulen 2001/02 989 7.967 176.825 22,2 204.185,25 1,2 2002/03 991 7.850 172.433 22,0 224.604,64 1,3 2003/04 990 7.834 171.942 21,9 225.589,72 1,3 2004/05 988 7.790 170.691 21,9 227.371,74 1,3 2005/06 989 7.738 169.106 21,9 230.529,72 1,4 2006/07 990 7.692 166.563 21,7 231.436,85 1,4 2007/08 989 7.467 160.189 21,5 226.328,26 1,4 2008/09 988 7.347 156.294 21,3 224.721,39 1,4 2009/10 983 7.193 150.969 21,0 222.126,58 1,5 2010/11 976 7.078 145.693 20,6 220.909,20 1,5 Die Zahl der Lehrer- + Pädagogische Fachkraft-Wochenstunden je SchülerIn hat sich leicht verbessert. Dieser Wert muss dringend erhöht werden, damit die Lehrkräfte und Pädagogischen Fachkräfte den gestiegenen Anforderungen insbesondere durch die notwendige individuelle Förderung und die Integration beeinträchtigter Kinder gerecht werden können. 2001/02 259 2.711 61.186 22,6 98.265,50 1,6 2002/03 236 2.527 57.073 22,6 93.788,39 1,6 2003/04 224 2.355 52.565 22,3 87.164,86 1,7 2004/05 198 2.199 48.127 21,9 82.294,81 1,7 2005/06 190 2.040 43.798 21,5 76.921,46 1,8 2006/07 182 1.913 39.918 20,9 73.499,86 1,8 2007/08 176 1.805 36.455 20,2 70.433,05 1,9 2008/09 171 1.691 33.351 19,7 65.653,12 2,0 2009/10 125 1.186 23.272 19,6 48.100,85 2,1 2010/11 61 498 9.403 18,9 20.019,20 2,1 Die L+PF-Wochenstunden je SchülerIn haben sich leicht verbessert. Die Hauptschule läuft mit dem Schuljahr 2012/13 aus. Gymnasien Lehrer- + PF-wochenstunden je SchülerIn Schuljahr Schulen Klassen/ Gruppen SchülerInnen SchülerInnen je Klasse/ Gruppe Lehrer- + PFwochenstunden 2001/02 139 3.116 115.014 Eine Berech-nung 164.592,80 1,4 2002/03 139 3.176 117.312 kann nicht 166.709,80 1,4 2003/04 140 3.231 120.144 erfolgen, da in der 169.925,20 1,4 2004/05 140 3.279 123.846 Sekundar-stufe II 174.563,78 1,4 2005/06 141 3.322 127.024 keine Klassen gebildet werden. 179.375,31 1,4 2006/07 141 3.372 130.525 182.900,35 1,4 2007/08 141 3.418 134.445 186.616,83 1,4 2008/09 143 3.472 137.110 189.801,94 1,4 2009/10 146 3.532 138.652 197.039,60 1,4 2010/11 146 3.532 138.882 199.456,72 1,4 Die Anzahl der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn ist nicht hinreichend, wenn die Lehrkräfte den gestiegenen Anforderungen beispielsweise durch die Verstärkung der individuellen Förderung gerecht werden wollen. Die Anzahl der Integrierten Gesamtschulen entspricht - trotz der Einrichtung von weiteren IGSen - in keiner Weise der Nachfrage, wie dies sich in allen Anmelderunden gezeigt hat. Schulträger und Bildungsverwaltung sind gut beraten, sehr zügig weitere Integrierten Gesamtschulen einzurichten, denn nur so können alle SchülerInnen länger gemeinsam lernen und wohnortnahe ein umfassendes und förderndes Bildungsangebot erhalten. 2001/02 17 449 14.258 Eine Berech-nung 23.044,95 1,6 2002/03 18 465 14.856 kann nicht 24.056,25 1,6 2003/04 19 476 15.247 erfolgen, da in der 24.668,83 1,6 2004/05 19 485 15.825 Sekundar-stufe II 25.771,10 1,6 Integrierte 2005/06 19 491 16.165 keine Klassen 26.685,00 1,7 Gesamtschulen 2006/07 19 497 16.454 gebildet werden. 27.086,44 1,6 2007/08 19 501 16.764 27.657,91 1,6 2008/09 25 529 17.692 29.696,88 1,7 2009/10 35 793 24.526 41.883,00 1,7 2010/11 52 1.160 34.336 57.505,05 1,7 Der geringe Anstieg der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn reicht nicht aus, um den gestiegenen Anforderungen beispielsweise durch die Integration von beeinträchtigten SchülerInnen, eine systematische Arbeitsweltorientierung, die notwendige ökonomische und informationstechnische Grundbildung und die Verstärkung der individuellen Förderung gerecht werden zu können. Förderschulen 2001/02 144 1.694 16.951 10,0 85.549,82 5,0 2002/03 143 1.733 17.416 10,0 88.445,58 5,1 2003/04 141 1.746 17.668 10,1 91.788,43 5,2 2004/05 141 1.762 17.513 9,9 91.810,01 5,2 2005/06 141 1.755 17.272 9,8 95.161,66 5,5 2006/07 141 1.723 16.819 9,8 93.433,94 5,6 2007/08 141 1.685 16.413 9,7 93.158,16 5,7 2008/09 141 1.638 15.868 9,7 92.303,19 5,8 2009/10 139 1.611 15.545 9,6 92.046,90 5,9 2010/11 138 1.576 15.099 9,6 91.363,69 6,1 Die Anzahl der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn konnte erhöht werden im wesentlichen durch eine Vergrößerung der Anzahl der Pädagogischen Fachkräfte. Sie ist aber nicht hinreichend, wenn die Lehrkräfte der Forderung, möglichst viele SchülerInnen zur Ausbildungsreife zu führen, gerecht werden wollen. Regionale Schulen Lehrer- + PFwochenstunden Lehrer- + PF-wochenstunden je SchülerIn Schuljahr Schulen Klassen/ Gruppen SchülerInnen je SchülerInnen Seite 1 von 1Klasse/ Gruppe 2001/02 79 1.111 27.068 24,4 39.331,50 1,5 2002/03 83 1.304 31.569 24,2 46.741,50 1,5 2003/04 84 1.431 34.249 23,9 50.848,10 1,5 2004/05 84 1.498 35.036 23,4 54.100,85 1,5 2005/06 84 1.496 34.672 23,2 53.994,22 1,6 2006/07 84 1.487 33.674 22,6 54.143,81 1,6 2007/08 83 1.438 32.346 22,5 53.077,57 1,6 2008/09 85 1.402 31.330 22,3 52.744,60 1,7 Die Regionalen Schulen sind mit Beginn des Schuljahres 2009/10 grundsätzlich in Realschulen plus überführt worden. 2001/02 12 218 5.149 23,6 7.865,50 1,5 2002/03 13 253 5.951 23,5 9.321,00 1,6 Duale 2003/04 13 280 6.532 23,3 10.471,00 1,6 Oberschulen 2004/05 14 298 6.889 23,1 11.385,00 1,7 als Form der 2005/06 14 304 6.938 22,8 11.628,00 1,7 Regionale Schule 2006/07 14 306 6.778 22,2 11.838,10 1,7 2007/08 14 305 6.582 21,6 11.636,50 1,8 2008/09 14 295 6.364 21,6 11.488,00 1,8 Die Dualen Oberschulen als eine Form der Regionalen Schule sind mit Beginn des Schuljahres 2009/10 grundsätzlich in Realschulen plus überführt worden. 2001/02 116 2.632 69.141 26,3 86.702,00 1,3 2002/03 116 2.656 70.181 26,4 86.930,53 1,2 2003/04 117 2.680 70.523 26,3 87.558,80 1,2 2004/05 117 2.672 69.947 26,2 87.746,00 1,3 Realschulen 2005/06 117 2.644 68.953 26,1 87.973,15 1,3 2006/07 117 2.617 68.145 26,0 86.290,50 1,3 2007/08 117 2.608 67.934 26,0 85.640,25 1,3 2008/09 117 2.581 67.133 26,0 86.249,65 1,3 2009/10 83 1.772 46.143 26,0 61.387,14 1,3 2010/11 33 599 15.679 26,2 20.589,75 1,3 Die Anzahl der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn konnte erhalten werden. Sie ist aber nicht hinreichend, wenn die Lehrkräfte den gestiegenen Anforderungen beispielsweise durch die Verstärkung der individuellen Förderung gerecht werden wollen. Realschulen 2009/10 129 2556 57.110 22,3 99.431,75 1,7 plus 2010/11 179 3899 88.181 22,6 147.185,80 1,7 Die Anzahl der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn hat sich nicht verbessert. Dies ist aber notwendig, wenn die Lehrkräfte die gestiegenen Anforderung durch individuelle Förderung, Integration von beeinträchtigten SchülerInnen und das Erreichen eines guten Schulabschlusses für alle SchülerInnen erfolgreich bewältigen sollen. Seite 1 von 1 Lehrer- + PF- Lehrer- + PF-wochenstunden Klassen/ SchülerInnen je wochen- je Schuljahr Schulen Gruppen SchülerInnen Klasse/ Gruppe stunden SchülerIn 2001/02 1669 20.088 489.642 Eine Berech-nung 717.060,61 1,5 2002/03 1662 20.150 490.881 kann nicht 747.891,55 1,5 2003/04 1654 20.217 493.055 erfolgen, da in der 755.479,38 1,5 Allgemeinbildende 2005/06 1620 19.966 487.990 keine Klassen 769.354,82 1,6 2004/05 1632 20.167 492.026 Sekundar-stufe II 762.266,54 1,5 Schulen 2006/07 1614 19.782 482.946 gebildet werden. 768.471,49 1,6 insgesamt 2007/08 1612 19.402 475.150 761.399,76 1,6 2008/09 1618 19.128 469.174 760.518,57 1,6 2009/10 1590 18.793 460.014 766.269,66 1,7 2010/11 1557 18.486 451.008 764.081,52 1,7 Die Anzahl der L+PF-Wochenstunden je SchülerIn stieg nicht im erforderlichen Maße, um den gestiegenen Erwartungen und Anforderungen, die von der Gesellschaft und der Bildungsverwaltung an die Schulen herangetragen werden, gerecht werden zu können. Hier ist die Landesregierung und der Landtag gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um zu deutlich verbesserten Ergebnissen zu kommen. Dem Bildungsministeriums ist es nur in geringem Maße gelungen, die weiter zurück gehenden Schülerzahlen zu nutzen, um mehr L+PF-Wochenstunden je SchülerIn zur Verfügung zu stellen, um so die Arbeits- und Lernbedingungen deutlich zu verbessern. Dies muss in der neuen Legislaturperiode gelingen. Stellenstreichungen sind dazu nicht geeignet. Berufsbildende Schulen 2002/03 109 6.215 124.522 20,0 106.252,25 0,9 2003/04 109 6.298 125.750 20,0 109.732,68 0,9 2004/05 105 6.306 127.776 20,3 112.171,44 0,9 2005/06 105 6.312 126.833 20,1 114.267,08 0,9 2006/07 103 6.419 127.776 19,9 115.837,65 0,9 2007/08 103 6.546 130.892 20,0 116.631,41 0,9 2008/09 103 6.625 132.833 20,1 116.414,87 0,9 2009/10 103 6.317 124.848 19,8 104.292,88 0,8 2010/11 103 6.221 120.651 19,4 103.223,45 0,9 Seit dem Schuljahr 2009/10 sind die SchülerInnen der Beruflichen Gymnasien nicht einbezogen. Es ist dem Bildungsministerium nicht gelungen, die Lehrerwochenstunden je SchülerIn zu steigern trotz des Ausbaus von Vollzeitbildungsgängen und der gestiegenen Erwartungen an die Qualität der beruflichen Bildung. Die Landesregierung und der Landtag sind gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Ziel der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung endlich erreicht wird. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass den Schulen eine Anzahl von neuen Anforderungen zugewiesen wurden wie Qualitätsentwicklung, Gewalt- und Drogenprävention, Streitschlichtung, individuelle Förderung, Integration beeinträchtigter Kinder, Aufbau von Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit etc., ohne dass die personellen und materiellen Ressourcen so bereit gestellt wurden und werden, dass die beabsichtigten Ziele auch tatsächlich erreicht werden können. Landesregierung und Landtag müssen hier zügig nacharbeiten. (Die Daten sind den Statistischen Berichten des Statistischen Landesamts <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> entnommen bzw. sind eigene Berechnungen.) 18 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 / 2011
Schulen Schweizer Langzeitstudie: Sonderschule für Lernbehinderte fehlt die Legitimation Wird die spätere berufliche und soziale Situation von Kindern mit einer „Lernbehinderung“ durch schulische Integration oder durch eine separate Unterrichtung besser gefördert? Zu dieser Fragestellung geben die vorliegenden Ergebnisse einer Nationalfonds-Studie unter der Leitung von Urs Haeberlin, emeritierter Professor und ehemaliger Direktor des Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg (Schweiz), eindeutige Antworten. Auch in der Schweiz ist es noch weitgehend üblich, Kinder und Jugendliche mit Lernschwächen zu separieren und in Sonderklassen, oft auch „Kleinklassen“ genannt, zu unterrichten. Da diese Schülerinnen und Schüler wie in Deutschland aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus kommen und häufig auch einen Migrationshintergrund haben, ist die Frage nach der gesellschaftlichen Perspektive im Anschluss an die Schullaufbahn von besonderer Bedeutung. „Die Langzeitstudie war möglich“, so die Forschergruppe, „weil wir auf Daten aus Nationalfondsprojekten zurückgreifen konnten, welche wir in den vergangenen zwölf Jahren an Personen erhoben hatten, die wir nun im frühen Erwachsenenalter erneut untersucht haben.“ den jungen Erwachsenen aus, die in Sonderklassen unterrichtet wurden. Die Abschaffung der Sonderklassen ist unumgänglich Das ist die bildungspolitische Schlussfolgerung, die die Forscher aus ihrer Studie ziehen. Mit der Einweisung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Sonderklassen für Lernbehinderte wird Chancengerechtigkeit verhindert. Die Etikettierung der von Chancenungerechtigkeit betroffenen Kinder und Jugendlichen als Lernbehinderte verschleiert den Aspekt der sozialen Benachteiligung. Sie hat über jahrzehntelang hinweg als scheinwissenschaftliche Rechtfertigung der Sonderklassen und der beruflichen Selektion gedient. Die Studie ist nachzulesen unter: Michael Eckhart, Urs Haeberlin et al.: Langzeitwirkungen der schulischen Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation. Bern 2011 Dr. Brigitte Schumann ifenici@aol.com Sonderklassen haben negative berufliche Auswirkungen Wer in einer Sonderklasse gelernt hat, hat als junger Erwachsener keinen Zugang zu anspruchsvolleren Berufen. Ausbildungsabbrüche und Langzeitarbeitslosigkeit sind charakteristisch für diese Gruppe. Vergleichbare junge Erwachsene, die in Regelklassen lernen konnten, finden leichter Anschluss an eine berufliche Ausbildung. Während drei Jahre nach der Schulzeit 25 % der ehemaligen Abgänger aus Sonderklassen keinen beruflichen Zugang gefunden haben, sind es bei der Vergleichsgruppe lediglich 6 %. Integrierte Schulabgänger haben sogar gewisse Chancen auf eine Ausbildung im mittleren oder höheren Segment der beruflichen Ausbildung. Sonderklassen beeinträchtigen nachhaltig das Selbstwertgefühl Im Vergleich zu ehemaligen integrierten Schülerinnen und Schülern aus Regelklassen sind ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Sonderklassen schlechter sozial integriert. Ihr Selbstwertgefühl ist wesentlich geringer. Sie verfügen über ein bedeutend kleineres Beziehungsnetz. Sonderklassen machen anfällig für Ausländerfeindlichkeit Schulische Integrationserfahrungen tragen dazu bei, dass die jungen Erwachsenen eine deutlich positivere Einstellung gegenüber Ausländern entwickelt haben. Ausländerfeindliche Tendenzen macht die Studie bei Kurzkommentar Die deutsche Bildungspolitik muss ihre Position ändern (bs) Die bundesdeutschen Länder haben bislang mehrheitlich bekundet, dass sie neben der Ermöglichung von inklusiver Bildung im allgemeinen Schulsystem für alle Förderschwerpunkte auch an dem Sonderschulsystem festhalten wollen. Dementsprechend gehen auch die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zu inklusiver Bildung von einer Pluralität der Förderorte aus. Eltern von Kindern mit Lernproblemen soll ermöglicht werden, zwischen einem gemeinsamen Unterricht in der allgemeinen Schule und der Sonderschule für Lernbehinderte, jetzt Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen genannt, zu wählen. Die KMK missachtet damit die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Diese verlangt eindeutig strukturelle und konzeptionelle Maßnahmen zur Abschaffung des Sonderschulsystems und die verbindliche Anerkennung des subjektiven Rechts der Kinder mit Behinderungen auf gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule. Die KMK weigert sich immer noch, die erdrückenden wissenschaftlichen Beweise über die schädlichen Effekte des Sonderschulsystems aus vierzigjähriger Forschung im In- und Ausland zur Kenntnis zu nehmen. Angesichts dieser aktuellen Forschungsstudie ist die Position der Bildungspolitik unhaltbar, wenn sie tatsächlich Bildungsgerechtigkeit herstellen und nicht nur ein Lippenbekenntnis dazu abgeben will. <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 / 2011 19