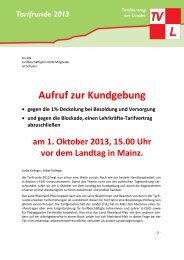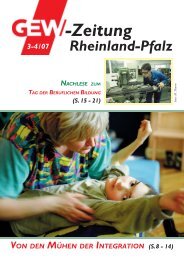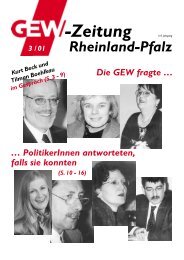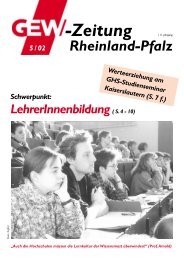GEW-ZEitUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEitUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEitUNG Rheinland-Pfalz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hochschulen<br />
Evidenz oder Emergenz? -<br />
Zum erkenntnistheoretischen Rückfall einer evidenzbasierten Bildungsforschung<br />
- Rolf Arnold -<br />
Auch die Bildungsforschung ist nicht frei von erkenntnistheoretischen<br />
Wiederholungen und allzu menschlichen Grenzziehungen,<br />
Ausgrenzungen und Selbstüberhöhungen. So konnte man in der<br />
FAZ vom 27. Oktober 2011 ein Plädoyer für mehr Empirie und<br />
Kompetenz lesen, die mit einer solchen Wende der Bildungsforschung<br />
nicht nur alle erdenklichen Positivwirkungen für die Profilschärfung<br />
und Professionalität der Bildungswissenschaft in Verbindung<br />
brachten, sondern auch die Autoren selbst positiv vom dem<br />
inkriminierten Rest eines - wie sie sagen - „Forschungsbereich(es)<br />
von noch unscharfem Profil und fragilem Status“ - von den Autoren<br />
polemisch als „Konfession“ geschmäht - abzuheben trachten.<br />
Dieser Gestus nimmt dem Vorstoß viel von seiner Glaubwürdigkeit,<br />
zumal die Autoren gleichzeitig erkenntnistheoretisch weit zurückfallen<br />
in die Welt einer - impliziten - Korrespondenztheorie der<br />
Wahrheit: Keine erkenntnistheoretische Skepsis kann ihre Forderung<br />
an die Bildungsforschung, auch „steuerungsrelevantes Wissen“<br />
bereitzustellen, „um die gestiegenen Anforderungen im Übergang<br />
von Industrie- zu Wissensgesellschaften besser erfüllen zu können“<br />
(Schrader u.a. 2011, S.8) trüben. Kann Wissenschaft in dieser Weise<br />
Gesellschaften tatsächlich verändern? Handelt Bildungspolitik<br />
tatsächlich auf der Grundlage einer nüchternen Tatsachenprüfung,<br />
oder sind es nicht vielmehr eigene Traditionen, Sachzwänge und<br />
Interessenlagen, die ihr Tun bestimmen? Und: Erkennt Forschung<br />
tatsächlich das, was der Fall ist, oder rückt sie nur das in den Blick,<br />
was Forscherinnen und Forscher - vor dem Hintergrund ihrer<br />
biographischen Einspurungen, ihrer akademischen Sozialisation<br />
und ihres überlieferten Begriffsbestecks (als ehemalige Schüler) - zu<br />
fokussieren vermögen?<br />
Solche Fragen werden von den Protagonisten einer empirischen<br />
Wende zu Profession nicht einmal gestreift. Stattdessen folgen sie<br />
einer doch recht vordergründigen Auslegung einer „Evidenzbasierung“<br />
- einem Begriff, mit dem - wie sie sagen - „die Erwartungen<br />
von Politik und Praxis ... zum Ausdruck gebracht (werden)“ (ebd.).<br />
Diesen - so die Autoren - geht es um Wirksamkeit und den „Transfer<br />
evidenter Befunde“ (ebd.) - eine instrumentalistische Beschränkung<br />
des eigenen Erkenntnisinteressen, verquastet mit einer Wirkungsillusion,<br />
welche die systemische Veränderungsforschung schon lange<br />
hinter sich gelassen hat. Konzepte einer wirksamen Veränderung<br />
folgen keiner Transferlogik, sondern dem von Kurt Lewin überlieferten<br />
Satz: „You can not understand a system unless you change it“,<br />
wobei es zunächst und vorrangig die überlieferten Vorstellungen,<br />
Denkformen und Handlungsgewohnheiten von Führungskräften,<br />
Forschern und Politikern sind, die auf den Prüfstand der Reflexion<br />
rücken. Ihre Veränderung lässt bereits anderes in Erscheinung<br />
treten, und es sind die Potenziale von Individuen, Organisationen<br />
und Gesellschaften, die sich entwickeln können, wenn man sie<br />
denn lässt. Es ist diese Kraft der Autonomie, Selbstwirksamkeit und<br />
Selbstbildung, welche die wirklich substanziellen Prozesse jeglicher<br />
Schul- und Unterrichtsentwicklung gestalten, keine internationalen<br />
Vergleichsdaten oder eine vormundschaftliche Allianz von Bildungsforschern<br />
und Politikern.<br />
Prof. Dr. Rolf Arnold<br />
lehrt an der TU Kaiserslautern Pädagogik<br />
(insbesondere Berufs- und Erwachsenenpädagogik)<br />
und ist Wissenschaftlicher<br />
Direktor des „Distance and Independent<br />
Studies Center“ (DISC) dieser Universität<br />
sowie Sprecher des Virtuellen Campus<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.<br />
Diese Perspektive einer fortgeschrittenen Veränderungsforschung<br />
lässt die überlieferte Trennung zwischen Subjekt und Objekt sowie<br />
zwischen Handeln und Erkennen hinter sich und öffnet den Blick<br />
für eine „selbsteinschließende Reflexion“ (Francisco Varela), der die<br />
eigenen Annahmen und Gewissheiten ebenso zur Frage werden, wie<br />
die der von den Autoren als interessenlose Entität in die Debatte<br />
eingeführte „Politik“. Ist es verwunderlich, dass dort, wo Schulen<br />
und Lehrer ihre Wirklichkeit nachhaltig verändert haben, sie dies<br />
von innen heraus und ohne Bezug auf die Häufigkeiten und Korrelationen<br />
internationaler Vergleichstudien bewerkstelligt haben?<br />
Zwar muss man den Trendwendeautoren zustimmen, dass es die<br />
Nützlichkeit der Forschung ist, die sie legitimiert, doch machen sich<br />
Zweifel breit, ob es wirklich die zitierten Pisa- und TIMMS-Studien<br />
sind, die eine die Schulwirklichkeit verändernde Nützlichkeit zu<br />
stiften vermögen. Es waren vielmehr auch Negativetikettierungen,<br />
neuverkleidete Schulaufsichtsbemühungen und Evaluationsadministration,<br />
welche Lehrerinnen und Lehrer bisweilen auch demotivierten<br />
und nicht selten auch von einer Innovation der schulischen<br />
Unterrichts- und Erziehungsformen abhielten.<br />
Vor diesem Hintergrund wirken die Anmerkungen von Heinz-<br />
Elmar Tenorth ernüchternd und klären, obgleich dieser nicht<br />
veränderungswissenschaftlich, sondern geisteswissenschaftlich<br />
argumentiert. Mit klaren Worten weist Tenorth der empirischen<br />
Bildungsforschung den Status zu, der ihr gebührt: als Bemühung,<br />
für Politik wie Praxis „eine nüchterne Außensicht auf das System zu<br />
gewinnen“. Doch damit erschöpft sich auch bereits der mögliche<br />
Wirkungsradius einer empirischen Bildungsforschung, so ist Tenorths<br />
Zwischenruf zu interpretieren. Und er lenkt auch den Blick<br />
auf deren erkenntnistheoretische Selbstbeschränkung, da nicht alles,<br />
was evident ist, auch wirksam und auch nicht alles, was wirksam ist,<br />
evident ist. Es bleibt ein Rest, durch den sich eigene Gewissheit in<br />
die Konstruktionen der Wirklichkeit einmischt. Auch für die Evidenz<br />
gilt deshalb, was Heinz von Foerster über die „Wahrheit“ zu sagen<br />
wusste: Sie ist „die Erfindung eines Lügners“ - Hinterfragungen,<br />
die den Propagandisten des vermeintlich neuen Konzeptes der<br />
Evidenzbasierung fremd zu sein scheinen: Ihr Evidenz-Konzept ist<br />
Ausdruck eines erkenntnistheoretisch naiven Realismus, gekoppelt<br />
mit instrumentalistischen Wirkungsillusionen. Die Klärungen der<br />
empirischen Bildungsforschung verbleiben deshalb auch meist im<br />
Kontext dessen, was ihr kategorialer Begriffsrahmen - aber auch die<br />
inneren Bilder der Akteure - zu (er)fassen oder auszuhalten vermögen.<br />
Sie haben deshalb auch kaum einen Zugang zu der Emergenz<br />
des Sozialen, kommen erstaunlicherweise ohne eine selbstreflexive<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 / 2011<br />
29