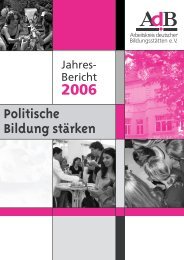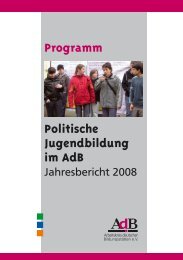AdB-Jahresbericht 2012
AdB-Jahresbericht 2012
AdB-Jahresbericht 2012
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
28 Politische Bildung für alle ermöglichen<br />
denen die Nutzung von Social Media in unterschiedlichem Maß<br />
entwickelt ist. Es reicht von der Homepage über Jahresprogramm,<br />
Newsletter, Zeitschriften und Broschüren bis hin zur Präsenz in<br />
sozialen Netzwerken, der direkten Ansprache und zum Imagefilm.<br />
Auch Jahrestage und andere Anlässe werden für Marketing<br />
genutzt. Die Offenheit für den Einsatz digitaler Medien ist allerdings<br />
unterschiedlich ausgeprägt und im Einzelfall noch ausbaufähig.<br />
Hier stellt sich die notwendige Anpassung an zeitgemäße<br />
Marketingformen als Problem dar, dem mit Fortbildung und Qualifizierung<br />
zu begegnen ist.<br />
Die Marketingziele sollen in allen Bereichen der Arbeit verfolgt<br />
werden, jedoch gibt es in den größeren Einrichtungen auch eine<br />
Arbeitsteilung, die Marketingaufgaben an dafür verantwortliche<br />
hauptamtliche Mitarbeiter/-innen delegiert, denen ein besonderes<br />
Budget zur Verfügung steht.<br />
Im bildungspolitischen Austausch auf beiden Sitzungen ging es um<br />
die in unterschiedlichem Ausmaß erfolgten Kürzungen der Mittel<br />
für Erwachsenen-/Weiterbildung in verschiedenen Bundesländern,<br />
die auf Bundesebene durch ebenfalls reduzierte Mittel bei der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung nicht kompensiert werden können.<br />
Die Bedeutung der Landeszentralen für politische Bildung für<br />
diesen Bildungsbereich und für die Arbeit der Träger stellt sich in<br />
den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich dar. Die Kommission<br />
informierte sich in einem Gespräch mit der <strong>AdB</strong>-Geschäftsführerin<br />
Ina Bielenberg über den Stand der Richtlinien der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung, die zum Zeitpunkt der Herbstsitzung bereits<br />
in Kraft getreten waren. Die Kommission sah bei den neuen Richtlinien<br />
einige Vorteile gegenüber der bisherigen Version, wie die<br />
Möglichkeit zu mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Veranstaltungen<br />
und die Erhöhung der Tagessätze. Sie äußerte jedoch die<br />
Befürchtung, dass der Verwaltungsaufwand bei der Anwendung<br />
der Richtlinien hoch sein werde.<br />
Bei beiden Sitzungen hat sich bewährt, aktivierende Methoden einzusetzen,<br />
um der Kommission „mehr Bewegung“ zu ermöglichen<br />
und die Sitzung abwechslungsreicher zu gestalten. Die Kommission<br />
wird gleichberechtigt von den beiden auf der konstituierenden<br />
Sitzung gewählten Vorsitzenden Prof. Dr. Christoph Meyer<br />
und Gila Zirfas-Krauel geleitet.<br />
Kommission Mädchen- und<br />
Frauenbildung<br />
Die Kommission Mädchen- und Frauenbildung traf sich zu ihrer<br />
konstituierenden Sitzung am 20. März <strong>2012</strong> in Hannover. Sie<br />
wählte erneut Birgit Weidemann zu ihrer Vorsitzenden. Nach einer<br />
ausführlichen Vorstellungsrunde und der Verständigung über die<br />
Erwartungen an die kommende Sitzungsperiode einigten sich die<br />
Frauen auf die Themenschwerpunkte für die nächsten vier Jahre.<br />
Einig waren sich die Kommissionsmitglieder, dass „Medien“ eine<br />
zentrale Rolle spielen sollen. Dabei soll es um die Darstellung von<br />
Geschlechterbildern z. B. im Fernsehen gehen, um die Selbstinszenierung<br />
von Mädchen und Frauen in den Medien und um die<br />
Sexualisierung und zunehmende pornographische Darstellung von<br />
Frauen. Aber auch das Mediennutzungsverhalten von Mädchen,<br />
das Agieren von Mädchen und Frauen in den sozialen Netzwerken<br />
und die vorhandene Medienkompetenz sollen bearbeitet werden.<br />
Als weiterer Themenschwerpunkt wurde der Komplex „Frauen und<br />
Mädchen am Arbeitsmarkt“ festgelegt. Die Öffentlichkeit diskutiert<br />
dabei vor allem die Abwesenheit von Frauen in Aufsichtsräten<br />
und ähnlichen leitenden Gremien, die Kommission nahm sich vor,<br />
ihren Blick aber auch auf die Ebenen darunter zu richten. In diesen<br />
Zusammenhang gehört, so beschloss die Kommission, auch die<br />
Frage der Gestaltung von Übergängen für Mädchen und junge<br />
Frauen. Diese Frage knüpft an die Schwerpunktthemen der Eigenständigen<br />
Jugendpolitik an.<br />
Bereits im letzten Jahr wurde das Thema „Lebensrealität und<br />
Lebensbedingungen für Frauen in Europa“ zur Bearbeitung vorgeschlagen.<br />
Hierbei soll es um die unterschiedlichen Lebensbedingungen<br />
in West- und Osteuropa sowie um Ausgrenzung und<br />
Rassismus gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen gehen.<br />
Neben Informationen aus der Geschäftsstelle, dem Vorstand und<br />
anderen Vereinsgremien wurden auf der Sitzung auch aktuelle<br />
Informationen aus der BAG Mädchenpolitik an die Kommissionsmitglieder<br />
weitergegeben.<br />
Die Herbstsitzung der Kommission Mädchen-und Frauenbildung<br />
fand vom 12. bis 13. November <strong>2012</strong> im Bremer LidiceHaus statt.<br />
Auf der Tagesordnung stand der Themenschwerpunkt „Mädchen<br />
und Medien“. Als Expertin war Ruth König von der Anlauf-und<br />
Beratungsstelle des Mädchenhauses in Bremen eingeladen. Ruth<br />
König gab der Kommission einige grundlegende Informationen<br />
zum Thema. Sie stützte sich auf die JIM-Studie 2011, Jugend, Information,<br />
(Multi-) Media vom Medienpädagogischen Forschungsverbund<br />
Südwest. Auffallend, so die Referentin, ist das rasant hohe<br />
Tempo, mit dem sich die Medien selbst und damit einhergehend<br />
das Nutzungsverhalten der Jugendlichen insgesamt verändert<br />
haben. Die Zahl derjenigen Mädchen und Jungen, die einen eigenen<br />
Rechner und einen eigenen Internetzugang haben, ist nach<br />
oben geschnellt. Der überwiegende Teil der Mädchen ist laut JIM-<br />
Studie täglich oder mehrmals in der Woche online. Mädchen sind<br />
dabei genau wie Jungen im Netz unterwegs. Online zu sein, im<br />
Internet zu navigieren und zu kommunizieren, ist Teil der alltäglichen<br />
Lebenswelt von Jugendlichen geworden, ist Bestandteil ihres<br />
Alltagswissens. Mit den großen Chancen und Möglichkeiten sind<br />
Gefahren und Risiken verknüpft, so erläuterte Ruth König weiter.<br />
Der Umgang mit Privatsphäre und den eigenen Daten muss neu<br />
erlernt werden. Cybermobbing ist ein Thema, bei dem es nach den<br />
vorliegenden Erfahrungen keinen Unterschied zwischen dem Verhalten<br />
von Mädchen und Jungen gibt. Vorwiegend von Mädchen<br />
aufgesucht werden sogenannte „pro ana“-Seiten, das sind Seiten,<br />
die die Krankheit Anorexia (Magersucht) verherrlichen. Auch<br />
zahlreiche Seiten, die die Selbstverletzung verherrlichen, sind für