Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2: Selektive Aufmerksamkeit für relevante Inhalte 17<br />
2.1.3 Exkurs: Strategisch und automatisch bedingte Set-Effekte<br />
Gegen die bisherigen Ausführungen mag vielleicht eingewendet werden, daß die aufgabenbezogene<br />
Verarbeitung von Reizen einfach in einem bewußten Befolgen und Abarbeiten der (instruierten)<br />
Handlungsregeln für die jeweilige Tätigkeit besteht und also nicht als automatisch<br />
ablaufender kognitiver Mechanismus beschrieben werden sollte. Die skizzierten Befunde zeigen<br />
jedoch, daß eine solche Einordnung dem Phänomen der Set-Effekte nicht gerecht wird. Wie<br />
bereits die frühen Untersuchungen aus der Würzburger Schule zeigen, geht die kognitive Konfigurierung<br />
bezüglich einer bestimmten Aufgabe mit sehr grundlegenden Veränderungen der<br />
Wahrnehmung und Informationsverarbeitung einher, die nicht Gegenstand der intentionalen<br />
Kontrolle sind. Die Ebene, auf der diese Set-Effekte angesiedelt sind, schließt eine direkte<br />
bewußte Steuerung aus, beispielsweise ist es nicht möglich, sich zu entscheiden, die Farbe eines<br />
betrachteten Gegenstandes nicht wahrzunehmen (genausowenig kann man sich vornehmen, zu<br />
vergessen, daß ein gerade gesehener Gegenstand blau ist).<br />
Natürlich kann man sich entschließen, bestimmte Inhalte oder Aspekte nicht besonders zu<br />
beachten oder sich nicht zu merken (vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Thema des<br />
„gerichteten Vergessens“ unter 5.1). Die Prozesse, mit deren Hilfe diese Vornahmen<br />
umgesetzt werden, entziehen sich allerdings im Normalfall der Kenntnis und direkten<br />
Einflußnahme der Person (besonders deutlich wird dies, wenn unerwünschte Nebeneffekte<br />
dieser Prozesse betrachtet werden).<br />
Auch die mit dem Paradigma des negativen Primings erzielten Befunde lassen sich auf der Basis<br />
eines rein intentionalen Steuerungsmodells nicht rekonstruieren. Der zentrale Befund dieser<br />
Studien besteht ja gerade in dem Nachweis, daß die während des Prime-Durchgangs vorgenommene<br />
Ausblendung der Distraktorstimuli auch noch im Probe-Durchgang wirksam ist, obwohl sie<br />
zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr erforderlich ist, und daher gerade zu einer verzögerten<br />
Aufgabenbearbeitung beiträgt. Dieser Befund steht in offensichtlichem Widerspruch zu der<br />
Auffassung, die Ausblendung der Distraktoren sei rein intentional gesteuert.<br />
Einen weiteren Hinweis auf die automatische Basis aufgabenbezogener kognitiver Einstellungen<br />
liefern Untersuchungen mit dem Paradigma des Aufgabenwechsels (A. Allport, Styles &<br />
Hsieh, 1994; Jersild, 1927; Meiran, 1996; Rogers & Monsell, 1995; Spector & Biederman,<br />
1976). Bei diesem Paradigma sind zwei Aufgabentypen, die auf demselben Stimulusmaterial<br />
operieren (beispielsweise Farb- vs. Wortbenennung bei farbig dargebotenen Wörtern), in heterogener<br />
Folge auszuführen. Es zeigt sich, daß in Durchgängen unmittelbar nach einem Wechsel des<br />
Aufgabentyps eine Bearbeitungsverzögerung auftritt (sog. „shift-Kosten“). A. Allport et al.<br />
(1994) führen diesen Effekt auf eine Trägheit etablierter aufgabenbezogener kognitiver Einstellungen<br />
zurück („task-set inertia“). Interessanterweise bleibt die Verzögerung nach einem Aufgabenwechsel<br />
auch dann bestehen, wenn der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Durchgängen<br />
der Aufgabenbearbeitung (RSI, Response Stimulus Interval) weit über die beobachteten<br />
shift-Kosten hinaus ausgedehnt wird. Hsieh und A. Allport (1994) konnten darüber hinaus<br />
anhand einer visuellen Suchaufgabe mit schneller sequentieller Präsentation der Stimuli (RSVP-<br />
Technik, Rapid Serial Visual Presentation) zeigen, daß unmittelbar nach einem Wechsel des<br />
Suchkriteriums ein Einbruch der Detektionsleistung erfolgte. Den entscheidenden Parameter für<br />
dieses Defizit in der Detektionsleistung stellt auch in diesem Falle nicht der zeitliche Abstand zu<br />
dem Wechsel des Suchkriteriums dar - wie bei einer bewußten und rein endogenen Steuerung der<br />
kognitiven Rekonfigurierung zu erwarten wäre -, sondern die Anzahl der im Anschluß an diesen


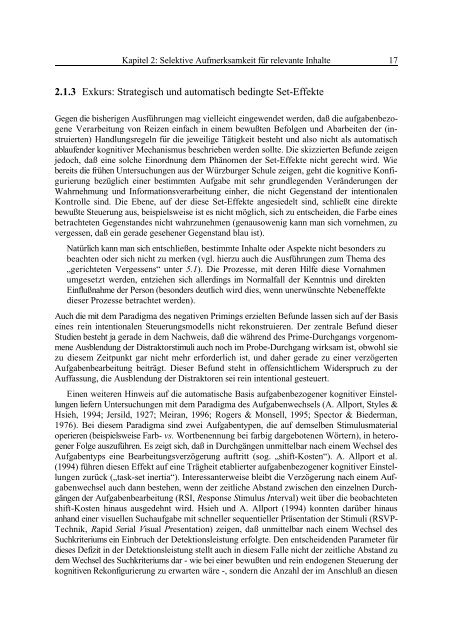










![Seite 00 [Titelbild].psd - ub-dok - Universität Trier](https://img.yumpu.com/18052556/1/184x260/seite-00-titelbildpsd-ub-dok-universitat-trier.jpg?quality=85)


