Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2: Selektive Aufmerksamkeit für relevante Inhalte 19<br />
2.2 Vermittelnde Mechanismen des kognitiven Relevanzprinzips<br />
Im folgenden werden mögliche vermittelnde Mechanismen für die berichteten Fokussierungseffekte<br />
diskutiert. Zunächst werden Modelle dargestellt, durch die eine bevorzugte Verarbeitung<br />
relevanter Inhalte erklärt wird. Anschließend werden mögliche Mechanismen diskutiert, die einer<br />
kognitiven Ausblendung irrelevanter Inhalte zugrundeliegen.<br />
2.2.1 Bevorzugte Verarbeitung relevanter Inhalte<br />
Ein naheliegender Mechanismus, durch den eine erhöhte Sensitivität für relevante Inhalte erzielt<br />
werden kann, besteht in einer erhöhten Aktivierung der kognitiven Repräsentation dieser Inhalte.<br />
Ein erhöhtes Aktivationsniveau für Elemente der kognitiven Repräsentation zielbezogener<br />
Inhalte geht mit einer erhöhten Zugänglichkeit („accessibility“) und schnelleren Verarbeitung<br />
entsprechender Stimuli einher und kann für viele der bisher berichteten Befunde als mögliche<br />
Erklärung angeführt werden.<br />
Eine Aktivierung relevanter Inhalte kann direkt oder indirekt erfolgen. Eine direkte Aktivationserhöhung<br />
zielbezogener Inhalte findet sich etwa im ACT*-Modell von J. R. Anderson<br />
(1983). Ziele werden hier durch sogenannte Quellknoten repräsentiert, die zielthematische<br />
kognitive Inhalte permanent aktivieren. Die Bindung an ein Ziel oder eine Aufgabe wirkt sich<br />
quasi wie ein Prime aktivationserhöhend auf die interne Repräsentation assoziierter Inhalte aus<br />
und führt so zu einer erhöhten Resonanz des kognitiven Systems für diese Inhalte. Einen vergleichbaren<br />
Ansatz im Bereich der Aufmerksamkeitsforschung stellt das Modell von Norman<br />
(1968) dar. Hier wird angenommen, daß Inhalte oder Merkmale, die für die aktuellen Ziele und<br />
Aufgaben relevant sind, eine direkte Voraktivierung erfahren, die entsprechenden Wahrnehmungselementen<br />
einen Selektionsvorteil verschafft.<br />
Bei der indirekten Aktivationserhöhung werden zielbezogene Inhalte nicht durch Addition<br />
eines bestimmten Energiebetrags direkt aktiviert, sondern es erfolgt eine (quasi multiplikative)<br />
Verstärkung oder Hemmung bereits vorhandener Aktivation in Abhängigkeit von der Handlungsrelevanz<br />
der Inhalte. Houghton und Tipper (1994) beschreiben ein Computersimulationsmodell<br />
für solche indirekten Effekte der Aktivationsmodulation. Die Logik dieses Modells besteht darin,


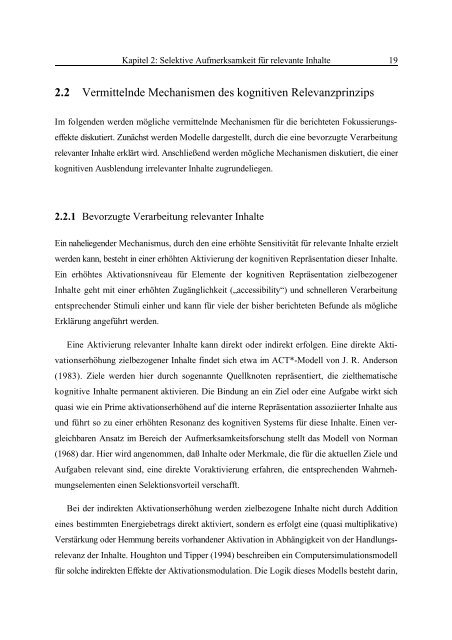










![Seite 00 [Titelbild].psd - ub-dok - Universität Trier](https://img.yumpu.com/18052556/1/184x260/seite-00-titelbildpsd-ub-dok-universitat-trier.jpg?quality=85)


