Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Volltext - ub-dok - Universität Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2: Selektive Aufmerksamkeit für relevante Inhalte 27<br />
Inhalte zu kognitiven Verarbeitungsprozessen und analoge Mechanismen einer kognitiven<br />
Ausblendung irrelevanter Inhalte dargestellt. Diese Erklärungsansätze schließen sich gegenseitig<br />
nicht aus. Möglicherweise existieren verschiedene vermittelnde Mechanismen, die auf unterschiedliche<br />
Art und Weise zu einer bevorzugten Beachtung und Verarbeitung relevanter Inhalte<br />
und einer Ausblendung irrelevanter Inhalte beitragen.<br />
Eine eindeutige Entscheidung über die im Einzelfall jeweils wirksamen Mechanismen kann auf<br />
der Basis der berichteten Befunde zumeist nicht getroffen werden. Beispielsweise benutzen<br />
einige der zitierten Untersuchungen zum Nachweis der bevorzugten Verarbeitung relevanter<br />
Informationen einen direkten Vergleich der Reaktionen auf relevante und irrelevante Inhalte. Ein<br />
solcher Befund belegt zwar eine relativ erhöhte Sensitivität für relevante gegenüber irrelevanten<br />
Stimuli; es bleibt aber offen, ob der Effekt auf eine absolut erhöhte Sensitivität für relevante<br />
Stimuli, auf eine Senkung der Resonanz bezüglich der jeweils irrelevanten Inhalte oder möglicherweise<br />
auf ein Zusammenspiel beider Faktoren zurückzuführen ist.<br />
2.2.4 Exkurs: Messung von Resonanzeffekten<br />
Im vorliegenden Zusammenhang muß die Frage nach der Art der effektvermittelnden Mechanismen<br />
nicht entschieden werden, zumal die diskutierten kognitiven Vermittlungsmechanismen<br />
keine sich ausschließenden Alternativen darstellen. Aus der Übersicht möglicher vermittelnder<br />
Mechanismen ergeben sich aber Konsequenzen für die Messung entsprechender Resonanzeffekte.<br />
Insofern es nämlich um den Nachweis einer - auf bislang eben noch nicht eindeutig<br />
bestimmbare Weise zustandegekommenen - selektiven Fokussierung relevanter Stimuli geht,<br />
empfiehlt sich der Einsatz eines Paradigmas, das für Effekte unterschiedlicher Vermittlungsmechanismen<br />
gleichermaßen sensibel ist. Zu diesem Zweck sind Interferenzparadigmen nahezu<br />
universell geeignet. Die Logik dieses Ansatzes besteht darin, verschiedene Stimuli als irrelevante<br />
Störreize zu präsentieren; die Darbietung der Störreize erfolgt entweder zusätzlich zu den<br />
eigentlichen Zielreizen der Aufgabe - in diesem Falle werden die Distraktoren oft auch als<br />
„Flankierreize“ bezeichnet (vgl. B. A. Eriksen & C. W. Eriksen, 1974; Shaffer & LaBerge, 1979)<br />
- oder der Störreiz stellt einen irrelevanten Aspekt des Zielreizes selbst dar; das bekannteste<br />
Paradigma dieser Art ist die Stroop-Aufgabe, bei der der Inhalt eines Wortes, dessen Farbe zu<br />
benennen ist, den Störreiz darstellt (Stroop, 1935; vgl. auch MacLeod, 1991). Die stimulusbezogene<br />
Resonanz wird immer über eine Reaktionsverzögerung in der eigentlich zu bearbeitenden<br />
Aufgabe gemessen.<br />
Gegenüber einer Effektmessung mittels direkter Maße der Verarbeitungsgeschwindigkeit<br />
(Benennen, Rekognitionszeit, lexikalische Entscheidung, etc.), in der die kritischen Stimuli als<br />
Zielreize dargeboten werden, auf die reagiert werden muß, bietet die Bestimmung von Interferenzeffekten<br />
zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ist die indirekte Messung von stimulusbe-


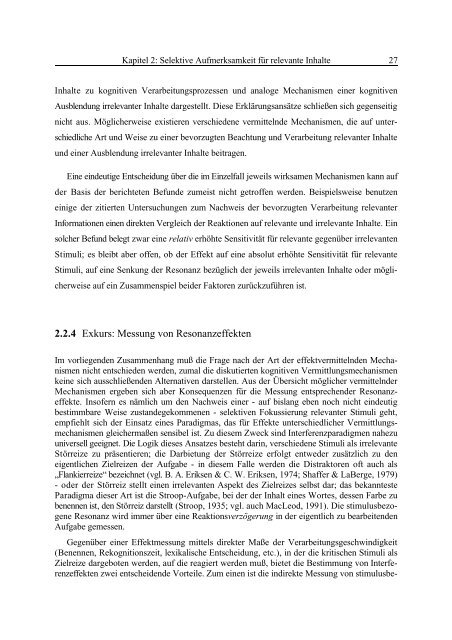










![Seite 00 [Titelbild].psd - ub-dok - Universität Trier](https://img.yumpu.com/18052556/1/184x260/seite-00-titelbildpsd-ub-dok-universitat-trier.jpg?quality=85)


