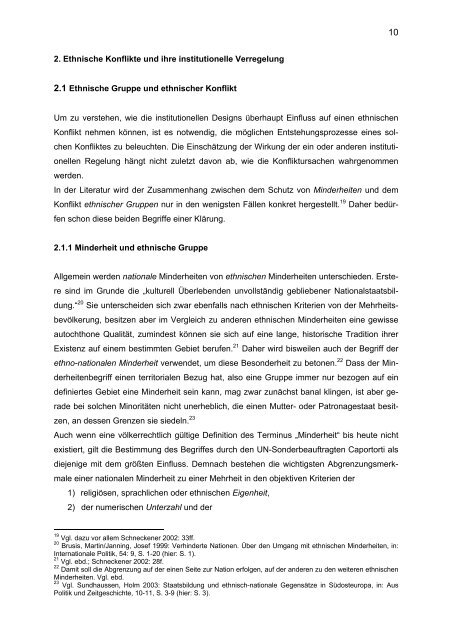Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10<br />
2. Ethnische Konflikte und ihre institutionelle Verregelung<br />
2.1 Ethnische Gruppe und ethnischer Konflikt<br />
Um zu verstehen, wie die institutionellen Designs überhaupt Einfluss auf einen ethnischen<br />
Konflikt nehmen können, ist es notwendig, die möglichen Entstehungsprozesse eines solchen<br />
Konfliktes zu beleuchten. Die Einschätzung der Wirkung der ein oder anderen institutionellen<br />
Regelung hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Konfliktursachen wahrgenommen<br />
werden.<br />
In der Literatur wird der Zusammenhang zwischen dem Schutz von Minderheiten und dem<br />
Konflikt ethnischer Gruppen nur in den wenigsten Fällen konkret hergestellt. 19 Daher bedürfen<br />
schon diese beiden Begriffe einer Klärung.<br />
2.1.1 Minderheit und ethnische Gruppe<br />
Allgemein werden nationale Minderheiten von ethnischen Minderheiten unterschieden. Erstere<br />
sind im Grunde die „kulturell Überlebenden unvollständig gebliebener Nationalstaatsbildung.“<br />
20 Sie unterscheiden sich zwar ebenfalls nach ethnischen Kriterien von der Mehrheitsbevölkerung,<br />
besitzen aber im Vergleich zu anderen ethnischen Minderheiten eine gewisse<br />
autochthone Qualität, zumindest können sie sich auf eine lange, historische Tradition ihrer<br />
Existenz auf einem bestimmten Gebiet berufen. 21 Daher wird bisweilen auch der Begriff der<br />
ethno-nationalen Minderheit verwendet, um diese Besonderheit zu betonen. 22 Dass der Minderheitenbegriff<br />
einen territorialen Bezug hat, also eine Gruppe immer nur bezogen auf ein<br />
definiertes Gebiet eine Minderheit sein kann, mag zwar zunächst banal klingen, ist aber gerade<br />
bei solchen Minoritäten nicht unerheblich, die einen Mutter- oder Patronagestaat besitzen,<br />
an dessen Grenzen sie siedeln. 23<br />
Auch wenn eine völkerrechtlich gültige Definition des Terminus „Minderheit“ bis heute nicht<br />
existiert, gilt die Bestimmung des Begriffes durch den UN-Sonderbeauftragten Caportorti als<br />
diejenige mit dem größten Einfluss. Demnach bestehen die wichtigsten Abgrenzungsmerkmale<br />
einer nationalen Minderheit zu einer Mehrheit in den objektiven Kriterien der<br />
1) religiösen, sprachlichen oder ethnischen Eigenheit,<br />
2) der numerischen Unterzahl und der<br />
19 Vgl. dazu vor allem Schneckener 2002: 33ff.<br />
20 Brusis, Martin/Janning, Josef 1999: Verhinderte Nationen. Über den Umgang mit ethnischen Minderheiten, in:<br />
Internationale Politik, 54: 9, S. 1-20 (hier: S. 1).<br />
21 Vgl. ebd.; Schneckener 2002: 28f.<br />
22 Damit soll die Abgrenzung auf der einen Seite zur Nation erfolgen, auf der anderen zu den weiteren ethnischen<br />
Minderheiten. Vgl. ebd.<br />
23 Vgl. Sundhaussen, Holm 2003: Staatsbildung und ethnisch-nationale Gegensätze in Südosteuropa, in: Aus<br />
Politik und Zeitgeschichte, 10-11, S. 3-9 (hier: S. 3).