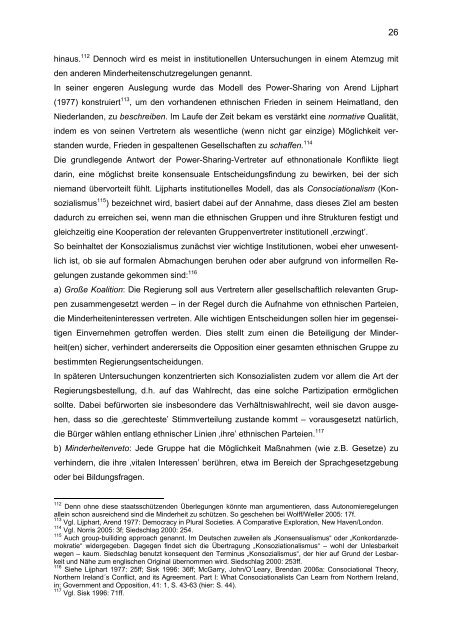Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Makedonien (Nr. 50) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
26<br />
hinaus. 112 Dennoch wird es meist in institutionellen Untersuchungen in einem Atemzug mit<br />
den anderen Minderheitenschutzregelungen genannt.<br />
In seiner engeren Auslegung wurde das Modell des Power-Sharing von Arend Lijphart<br />
(1977) konstruiert 113 , um den vorhandenen ethnischen Frieden in seinem Heimatland, den<br />
Niederlanden, zu beschreiben. Im Laufe der Zeit bekam es verstärkt eine normative Qualität,<br />
indem es von seinen Vertretern als wesentliche (wenn nicht gar einzige) Möglichkeit verstanden<br />
wurde, Frieden in gespaltenen Gesellschaften zu schaffen. 114<br />
Die grundlegende Antwort der Power-Sharing-Vertreter auf ethnonationale Konflikte liegt<br />
darin, eine möglichst breite konsensuale Entscheidungsfindung zu bewirken, bei der sich<br />
niemand übervorteilt fühlt. Lijpharts institutionelles Modell, das als Consociationalism (Konsozialismus<br />
115 ) bezeichnet wird, basiert dabei auf der Annahme, dass dieses Ziel am besten<br />
dadurch zu erreichen sei, wenn man die ethnischen Gruppen und ihre Strukturen festigt und<br />
gleichzeitig eine Kooperation der relevanten Gruppenvertreter institutionell ‚erzwingt’.<br />
So beinhaltet der Konsozialismus zunächst vier wichtige <strong>Institut</strong>ionen, wobei eher unwesentlich<br />
ist, ob sie auf formalen Abmachungen beruhen oder aber aufgrund von informellen Regelungen<br />
zustande gekommen sind: 116<br />
a) Große Koalition: Die Regierung soll aus Vertretern aller gesellschaftlich relevanten Gruppen<br />
zusammengesetzt werden – in der Regel durch die Aufnahme von ethnischen Parteien,<br />
die Minderheiteninteressen vertreten. Alle wichtigen Entscheidungen sollen hier im gegenseitigen<br />
Einvernehmen getroffen werden. Dies stellt zum einen die Beteiligung der Minderheit(en)<br />
sicher, verhindert andererseits die Opposition einer gesamten ethnischen Gruppe zu<br />
bestimmten Regierungsentscheidungen.<br />
In späteren Untersuchungen konzentrierten sich Konsozialisten zudem vor allem die Art der<br />
Regierungsbestellung, d.h. auf das Wahlrecht, das eine solche Partizipation ermöglichen<br />
sollte. Dabei be<strong>für</strong>worten sie insbesondere das Verhältniswahlrecht, weil sie davon ausgehen,<br />
dass so die ‚gerechteste’ Stimmverteilung zustande kommt – vorausgesetzt natürlich,<br />
die Bürger wählen entlang ethnischer Linien ‚ihre’ ethnischen Parteien. 117<br />
b) Minderheitenveto: Jede Gruppe hat die Möglichkeit Maßnahmen (wie z.B. Gesetze) zu<br />
verhindern, die ihre ‚vitalen Interessen’ berühren, etwa im Bereich der Sprachgesetzgebung<br />
oder bei Bildungsfragen.<br />
112 Denn ohne diese staatsschützenden Überlegungen könnte man argumentieren, dass Autonomieregelungen<br />
allein schon ausreichend sind die Minderheit zu schützen. So geschehen bei Wolff/Weller 2005: 17f.<br />
113 Vgl. Lijphart, Arend 1977: Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven/London.<br />
114 Vgl. Norris 2005: 3f; Siedschlag 2000: 254.<br />
115 Auch group-builiding approach genannt. Im Deutschen zuweilen als „Konsensualismus“ oder „Konkordanzdemokratie“<br />
widergegeben. Dagegen findet sich die Übertragung „Konsoziationalismus“ – wohl der Unlesbarkeit<br />
wegen – kaum. Siedschlag benutzt konsequent den Terminus „Konsozialismus“, der hier auf Grund der Lesbarkeit<br />
und Nähe zum englischen Original übernommen wird. Siedschlag 2000: 253ff.<br />
116 Siehe Lijphart 1977: 25ff; Sisk 1996: 36ff; McGarry, John/O´Leary, Brendan 2006a: Consociational Theory,<br />
Northern Ireland´s Conflict, and its Agreement. Part I: What Consociationalists Can Learn from Northern Ireland,<br />
in: Government and Opposition, 41: 1, S. 43-63 (hier: S. 44).<br />
117 Vgl. Sisk 1996: 71ff.