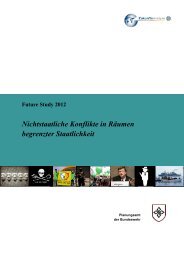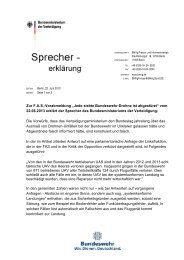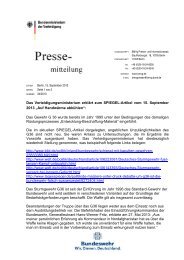Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Forschung</strong>saktivitäten <strong>2012</strong><br />
18 19<br />
Dr. Michael Caris<br />
Fraunhofer-Institut für Hoch frequenz -<br />
physik und Radartechnik, Wachtberg<br />
michael.caris@fhr.fraunhofer.de<br />
Helmut Wotzke<br />
Fraunhofer-Institut für Hoch frequenz -<br />
physik und Radartechnik, Wachtberg<br />
helmut.wotzke@fhr.fraunhofer.de<br />
Dr. Stephan Stanko<br />
Fraunhofer-Institut für Hoch frequenz -<br />
physik und Radartechnik, Wachtberg<br />
stephan.stanko@fhr.fraunhofer.de<br />
DUSIM – Dual Use Sensorik im Mittleren Entfernungsbereich<br />
Das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und In den aktuellen Einsatzszenarien ergibt sich eine große<br />
Radartechnik (FHR) befasst sich mit grundlegender und Bedrohung durch Panzerabwehrhandwaffen, die auf dem<br />
anwendungsorientierter <strong>Forschung</strong> auf dem Gebiet der Weltmarkt in großer Zahl verfügbar sind. Die hohe Durchschlagskraft<br />
dieser Waffen in Verbindung mit einer nahezu<br />
elektromagnetischen Sensorik. Es werden Konzepte,<br />
Verfahren und Systeme, insbesondere im Radarbereich, hemisphärischen Bedrohung führen dazu, dass ein angemessener<br />
Schutz, insbesondere für leichte luftverlastbare Fahr-<br />
entwickelt. Der Zweck des vorgestellten DUSIM-Sensors<br />
ist die Einbindung in ein aktives Schutzsystem gegen zeuge, mit herkömmlichen ballistischen Schutztechnologien<br />
Bedrohungen durch Panzerabwehrhandwaffen.<br />
kaum realisierbar ist. Ein vielversprechender Ansatz dieser<br />
Bedrohung zu begegnen, besteht in der Entwicklung und Realisierung<br />
aktiver Schutzsysteme. Sie erkennen ein anfliegendes<br />
Geschoss und bekämpfen dieses aktiv vor dem Eintreten der<br />
regulären Wirkung des Gefechtskopfes. Die Leistungsfähigkeit<br />
eines solchen Systems hängt im Wesentlichen von drei Komponenten<br />
ab: Detektion, Feuerleitung und Gegenmaßnahme.<br />
Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Sensor zu, der die<br />
anfliegende Bedrohung detektiert, Rückschlüsse auf deren<br />
Beschaffenheit zulässt und Daten liefert, die eine hochgenaue<br />
Bestimmung der Flugparameter (Abstand, Flugrichtung,<br />
Geschwindigkeit) erlauben. Aufgrund seiner Allwettertauglichkeit<br />
und der Möglichkeit Staub- und Sandwolken zu durchdringen,<br />
hebt sich die Radartechnologie dabei von möglichen<br />
anderen Sensoren ab.<br />
Im Rahmen des <strong>Forschung</strong>svorhabens DUSIM wurde am<br />
Fraunhofer FHR ein vierkanaliges Radarsystem entwickelt,<br />
das bei einer Frequenz von 94 GHz arbeitet. Bei einer Sendeleistung<br />
von 100 mW sind damit Reichenweiten von mehreren<br />
hundert Metern möglich, wobei die eingesetzte Leistung weit<br />
unterhalb der eines Mobiltelefons liegt und keine Gefahr für<br />
umstehende Personen birgt. Das frequenzmodulierte Dauerstrich<br />
Signal (FMCW) mit einer Bandbreite von 1 GHz sorgt<br />
für eine hohe Abstandsauflösung von 15 cm. Kombiniert mit<br />
der Mehrkanaligkeit ist das System in der Lage, eine sehr präzise<br />
Ortsablage des herannahenden Geschosses zu liefern sowie<br />
durch Ausnutzung des Dopplereffektes dessen Geschwindigkeit<br />
und Richtung zu ermitteln. Eine genaue Kenntnis dieser<br />
Parameter ist die Grundlage für eine gezielte und zeitlich<br />
exakte Gegenmaßnahme sowie eine möglichst geringe Falschalarmrate.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> wurden mit dem DUSIM zwei Messkampagnen<br />
auf der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition<br />
(WTD 91) in Meppen durchgeführt. Im Oktober gelang es<br />
erfolgreich kleinkalibrige Geschosse zu detektieren, die mit<br />
ihrem sehr kleinen Radar-Rückstreu-Querschnitt (RCS) eine<br />
besondere Herausforderung im Bereich der Radartechnik<br />
darstellen. Dennoch war eine genaue Analyse von Flugbahn<br />
und Geschwindigkeit des Projektils möglich. Bei der STANAG-<br />
Kampagne im Dezember ging es um die Erfassung anfliegender<br />
RPG, die aufgrund des größeren RCS mit dem System sehr gut<br />
messbar sind. Mit der hohen Auflösung des Sensors ist sogar<br />
eine deutliche Unterscheidung zwischen Raketenbug und<br />
-heck (Finne) möglich. Das liefert zusätzliche Hinweise auf<br />
die Beschaffenheit des Geschosses.<br />
Mit dem vorliegenden DUSIM-Radarsensor ist die gestellte<br />
Aufgabe, Detektion einer anfliegenden Bedrohung und Vorhersage<br />
ihrer Flugbahn zur weiteren Analyse und Einleitung<br />
einer Gegenmaßnahem, hervorragend gelöst. In seiner derzeitigen<br />
Entwicklungsstufe wird mit einer vierkanaligen<br />
Sensoreinheit ein Raumwinkel von etwa 35° überwacht, so<br />
dass für eine Rundumsicht etwa zwölf Systeme benötigt<br />
würden. Eine Reduzierung durch Abdeckung eines größeren<br />
Raumbereichs je Einheit sollte jedoch durch konsequente<br />
Weiterentwicklung zeitnah realisierbar sein.<br />
Abb. 1: DUSIM – Vierkanaliges Radar-Frontend mit einer<br />
Ausgangsleistung von 100 mW bei 94 GHz<br />
Abb. 2: Kontrolleinheit und Spannungsversorgung für das<br />
DUSIM Radar-Frontend<br />
Abb. 3: Geschossbahn eines kleinkalibrigen Projektils<br />
(MG3 7,62 x 51 mm)<br />
Abb. 4: Ausschnitt der Geschossbahn einer RPG – Raketenbug<br />
und -heck (Finne) sind unterscheidbar