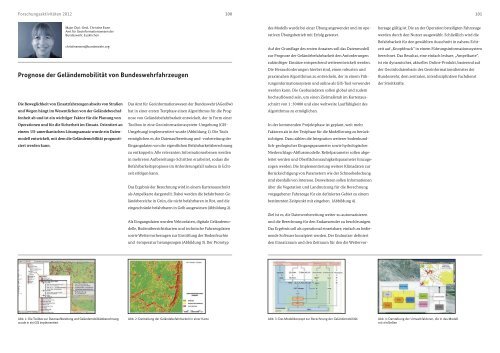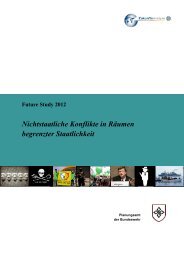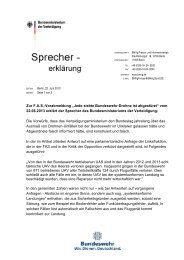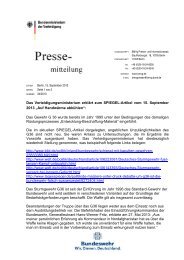Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Forschung</strong>saktivitäten <strong>2012</strong> 100 101<br />
Major Dipl.-Geol. Christine Ewen<br />
Amt für Geoinformationswesen der<br />
Bundeswehr, Euskirchen<br />
christineewen@bundeswehr.org<br />
Prognose der Geländemobilität von Bundeswehrfahrzeugen<br />
Die Beweglichkeit von Einsatzfahrzeugen abseits von Straßen<br />
und Wegen hängt im Wesentlichen von der Geländebeschaffenheit<br />
ab und ist ein wichtiger Faktor für die Planung von<br />
Operationen und für die Sicherheit im Einsatz. Orientiert an<br />
einem US-amerikanischen Lösungsansatz wurde ein Datenmodell<br />
entwickelt, mit dem die Geländemobilität prognostiziert<br />
werden kann.<br />
Das Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr (AGeoBw)<br />
hat in einer ersten Testphase einen Algorithmus für die Prognose<br />
von Geländebefahrbarkeit entwickelt, der in Form einer<br />
Toolbox in eine Geoinformationssystem-Umgebung (GIS-<br />
Umgebung) implementiert wurde (Abbildung 1). Die Tools<br />
ermöglichen es, die Datenaufbereitung und -vorbereitung der<br />
Eingangsdaten von der eigentlichen Befahrbarkeitsberechnung<br />
zu entkoppeln. Alle relevanten Informationsebenen werden<br />
in mehreren Aufbereitungs-Schritten erarbeitet, sodass die<br />
Befahrbarkeitsprognose im Anforderungsfall nahezu in Echtzeit<br />
erfolgen kann.<br />
Das Ergebnis der Berechnung wird in einem Kartenausschnitt<br />
als Ampelkarte dargestellt. Dabei werden die befahrbaren Geländebereiche<br />
in Grün, die nicht befahrbaren in Rot, und die<br />
eingeschränkt befahrbaren in Gelb ausgewiesen (Abbildung 2).<br />
Als Eingangsdaten wurden Vektordaten, digitale Geländemodelle,<br />
Bodenübersichtskarten und technische Fahrzeugdaten<br />
sowie Wettervorhersagen zur Ermittlung der Bodenfeuchte<br />
und -temperatur herangezogen (Abbildung 3). Der Prototyp<br />
des Modells wurde bei einer Übung angewendet und im operativen<br />
Übungsbetrieb mit Erfolg getestet.<br />
Auf der Grundlage des ersten Ansatzes soll das Datenmodell<br />
zur Prognose der Geländebefahrbarkeit den Anforderungen<br />
zukünftiger Einsätze entsprechend weiterentwickelt werden.<br />
Die Herausforderungen hierbei sind, einen robusten und<br />
praxisnahen Algorithmus zu entwickeln, der in einem Führungsinformationssystem<br />
und online als GIS-Tool verwendet<br />
werden kann. Die Geobasisdaten sollen global und zudem<br />
hochauflösend sein, um einen Zielmaßstab im Kartenausschnitt<br />
von 1 : 50 000 und eine weltweite Lauffähigkeit des<br />
Algorithmus zu ermöglichen.<br />
In der kommenden Projektphase ist geplant, weit mehr<br />
Faktoren als in der Testphase für die Modellierung zu berücksichtigen.<br />
Dazu zählen die Integration weiterer bodenkundlich-geologischer<br />
Eingangsparameter sowie hydrologischer<br />
Niederschlags-Abflussmodelle. Reliefparameter sollen abgeleitet<br />
werden und Oberflächenrauhigkeitsparameter hinzugezogen<br />
werden. Die Implementierung weitere Klimadaten zur<br />
Berücksichtigung von Parametern wie der Schneebedeckung<br />
sind ebenfalls von Interesse. Desweiteren sollen Informationen<br />
über die Vegetation und Landnutzung für die Berechnung<br />
vorgegebener Fahrzeuge für ein definiertes Gebiet zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt mit eingehen. (Abbildung 4).<br />
Ziel ist es, die Datenvorbereitung weiter zu automatisieren<br />
und die Berechnung für den Endanwender zu beschleunigen.<br />
Das Ergebnis soll als operational einsetzbare, einfach zu bedienende<br />
Software konzipiert werden. Der Endnutzer definiert<br />
den Einsatzraum und den Zeitraum für den die Wettervorhersage<br />
gültig ist. Die an der Operation beteiligten Fahrzeuge<br />
werden durch den Nutzer ausgewählt. Schließlich wird die<br />
Befahrbarkeit für den gewählten Ausschnitt in nahezu Echtzeit<br />
auf „Knopfdruck“ in einem Führungsinformationssystem<br />
berechnet. Das Resultat, eine einfach lesbare, „Ampelkarte“,<br />
ist ein dynamisches, aktuelles Online-Produkt, basierend auf<br />
der Geoinfodatenbasis des Geoinformationsdienstes der<br />
Bundeswehr, dem zentralen, interdisziplinären Fachdienst<br />
der Streitkräfte.<br />
Abb. 1: Die Toolbox zur Datenaufbereitung und Geländemobilitätsberechnung<br />
wurde in ein GIS implementiert<br />
Abb. 2: Darstellung der Geländebefahrbarkeit in einer Karte Abb. 3: Das Modellkonzept zur Berechnung der Geländemobilität Abb. 4: Darstellung der Umweltfaktoren, die in das Modell<br />
mit einfließen