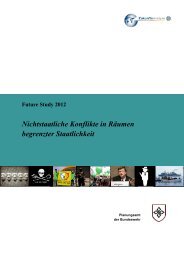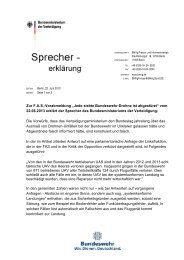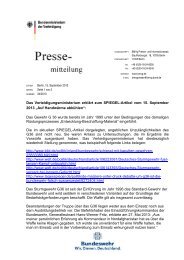Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Wehrwissenschaftliche Forschung Jahresbericht 2012
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Forschung</strong>saktivitäten <strong>2012</strong> 90 91<br />
Dr. Markus Pöhlmann<br />
Militärgeschichtliches <strong>Forschung</strong>samt,<br />
Potsdam<br />
markuspoehlmann@bundeswehr.org<br />
* Seit dem 1. 1. 2013 sind das Militärgeschichtliche <strong>Forschung</strong>samt und das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr<br />
zum Zentrum der Bundeswehr für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften mit Sitz in Potsdam zusammengefasst.<br />
Panzerwaffe und Mechanisierung des Krieges in Deutschland 1890 – 1945<br />
2016 wird das Waffensystem Panzer einhundert Jahre alt.<br />
Das Militärgeschichtliche <strong>Forschung</strong>samt (MGFA) untersucht<br />
deshalb seine Geschichte in Deutschland. Im Vordergrund<br />
stehen militärische Operationen, Strategie und<br />
Kriegsbild im Zeitalter der Weltkriege. Ebenso wird nach<br />
den sozialen Kontexten und dem Stellenwert des Panzers<br />
in der kollektiven Kriegserinnerung gefragt. Ein entsprechendes<br />
<strong>Forschung</strong>sprojekt konnte das MGFA <strong>2012</strong><br />
in wesentlichen Teilen abschließen.<br />
Die Darstellung folgt zunächst der Chronologie. Die Vorgeschichte<br />
der Panzerentwicklung geht bis 1890 zurück, als sich<br />
ein spezifischer militärtechnischer Entwicklungscluster auszuformen<br />
begann. Die klassischen Parameter des Waffensystems<br />
– Beweglichkeit, Feuerkraft und Panzerung – nahmen von nun<br />
an maßgeblich auf die Rüstung und Organisation des Heeres<br />
Einfluss. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 hätte<br />
der militärtechnische Entwicklungsstand die Erfindung und<br />
Einführung des Panzers bereits möglich gemacht. Warum dies<br />
nicht geschah und das preußisch-deutsche Heer ohne das<br />
Waffensystem in den Krieg eintrat, bildet eine der zentralen<br />
Fragen.<br />
Während des Ersten Weltkriegs entwickelten zunächst die<br />
britischen Streitkräfte den Panzer (Tank) und setzten ihn ein.<br />
Hier gilt es zu analysieren, wie die deutsche Seite militärisch<br />
und rüstungsmäßig auf diese Herausforderung reagierte.<br />
Unabhängig von der teils erheblichen psychologischen Wirkung,<br />
die britische Tanks an der Westfront entfalteten, stellt<br />
sich die Frage, welche militärische Bedeutung dem Panzer<br />
tatsächlich für den Kriegsverlauf zukam.<br />
Zwischen 1919 und 1935 verbot der Versailler Vertrag der<br />
Reichswehr den Ausbau einer Panzerwaffe. Dies hatte eminente<br />
Folgen für die Entwicklung und die Doktrinbildung.<br />
Beides gewann erst zu Beginn der 1930er Jahre und dann in<br />
der Folge der nationalsozialistischen Machtergreifung von<br />
1933 erneut an Fahrt. Bis 1939 baute die deutsche Militärführung<br />
die Panzerwaffe systematisch aus und verfügte beim<br />
Überfall auf Polen 1939 über ein schlagkräftiges Instrument,<br />
das die mechanisierte Kriegführung in bislang unbekannter<br />
Reichweite und Intensität ermöglichte. Während des Zweiten<br />
Weltkrieges wurde die Panzerwaffe insbesondere im Frankreichfeldzug<br />
und während des als „Blitzkrieg“ geplanten Einmarsches<br />
in die UdSSR zur Trägerin deutscher Angriffskriege<br />
schlechthin. Dies wird anhand der Operationsgeschichte und<br />
der Kriegsrüstung der Jahre 1939 bis 1945 nachvollzogen.<br />
Für den angesprochenen Zeitraum analysiert das Projekt das<br />
jeweilige Kriegsbild, um zunächst die militärischen Erwartungen<br />
an die Panzerwaffe aufzuzeigen. Damit eng verknüpft<br />
wird die Doktrinbildung als diskursiver Prozess untersucht.<br />
Dass dieser Diskurs beispielsweise in der Reichswehr unter<br />
dem Eindruck der Niederlage im Ersten Weltkrieg und unter<br />
den Bedingungen des Versailler Vertrages stattfand, hatte<br />
zur Folge, dass er mit besonderer Zielstrebigkeit und unter<br />
Antizipierung möglicher internationaler Reaktionen ablief.<br />
Der Komplex <strong>Forschung</strong>, Entwicklung und Rüstung bildet<br />
einen weiteren Erkenntnisgegenstand. So stellt sich etwa die<br />
Frage, ob für eine militärische Innovation von der Dimension<br />
des Panzers ab 1916 bereits eine etablierte Organisation<br />
für <strong>Forschung</strong> und Entwicklung bzw. Rüstung bereit stand.<br />
Die entsprechenden institutionellen Rahmenbedingungen<br />
veränderten sich vor allem durch die seit 1940 initiierte<br />
Neuorganisation der Heeresrüstung seitens der NS-Führung<br />
entscheidend und hatten den Erfordernissen des laufenden<br />
Krieges zu dienen.<br />
Schließlich nimmt der Panzer auch in der kollektiven Kriegserinnerung<br />
erheblichen Raum ein. Dem Waffensystem kommt<br />
eine herausragende Bedeutung in militärkultureller Hinsicht,<br />
etwa im Zusammenhang mit der Frage des militärischen Ethos<br />
(Kampf Mensch vs. Maschine, Wille vs. Material) zu. Hierzu<br />
zählen auch Aspekte der Traditionsbildung (Traditionslinie<br />
aus der Kavallerie) bis hin zum Eindringen des Panzers in<br />
die populäre Kultur.<br />
Im Ergebnis entsteht eine Geschichte des Panzers als Waffe<br />
und Symbol. Erstmals wird hier der Versuch unternommen,<br />
das Zeitalter der Weltkriege in seinen militärgeschichtlichen<br />
Grundzügen über die Entwicklung, Anwendung und kulturelle<br />
Widerspiegelung eines einzelnen militärischen Artefakts darzustellen.<br />
Den Angehörigen der Bundeswehr und nicht zuletzt<br />
den Soldaten der immer kleiner werdenden Panzertruppe<br />
vermittelt die Studie damit Hilfestellung bei der kritischen<br />
historischen Standortbestimmung.<br />
Abb. 1: Ein deutscher Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg findet<br />
bei der Ausstellungskonzeption des Militärhistorischen Museums<br />
in Dresden Verwendung<br />
Abb. 2: Modelle von Kampfpanzern der Bundeswehr in der<br />
Dresdener Dauerausstellung<br />
Abb. 3: Aufarbeitung von Operationsgeschichte am MGFA