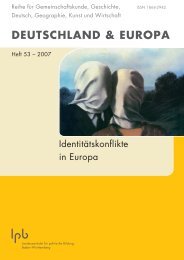deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
in den letzten Jahrzehnten wurden in 100<br />
Deutschland und anderen Demokratien vermehrt<br />
Möglichkeiten geschaffen, durch<br />
Volksbegehren und -entscheide politischen<br />
Einfluss auszuüben. Zu guter Letzt nutzt eine<br />
80<br />
wachsende, wenn auch immer noch relativ<br />
kleine, Gruppe von Bürgern das Internet als<br />
Mittel der politischen Beteiligung (vgl. ausführlich<br />
dazu: Gabriel/Völkl 2005; Gabriel/<br />
Völkl 2008; van Deth 2009).<br />
60<br />
Auch wenn die Beteiligung an der Wahl der<br />
politischen Führung für die meisten Bürger<br />
die wichtigste Form politischer Einflussnahme<br />
geblieben ist, zeigt die empirische 40<br />
Forschung mit großer Deutlichkeit, dass die<br />
vielfältigen Möglichkeiten zum politischen<br />
Engagement von einer wachsenden Zahl von<br />
Bürgern genutzt werden. Zwar ist die Wahlbeteiligung<br />
in den letzten zwanzig Jahren in<br />
20<br />
Deutschland stärker gesunken als es die Daten<br />
in Abbildung 2 erkennen lassen, jedoch<br />
handelt es sich dabei eher um eine Ausnahme 0<br />
als um die Regel im politischen Engagement:<br />
Entweder ist das politische Engagement gestiegen<br />
– wie im Fall der legalen Protestaktionen<br />
– oder es ist zumindest stabil geblieben.<br />
Außer der Wahlbeteiligung hat sich in<br />
Deutschland keine andere Form der politischen<br />
Partizipation rückläufig entwickelt.<br />
Insgesamt ist somit die Inklusivität des politischen Systems gewachsen.<br />
Dies bestätigen auch weitere empirische Studien (Hinweise<br />
bei: Gabriel 2011: 24–29).<br />
Welche Gruppen betätigen sich politisch und<br />
welche bleiben inaktiv?<br />
Ungeachtet des relativ breiten bürgerschaftlichen Engagements<br />
beteiligt sich jeder zweite Deutsche nicht aktiv am gesellschaftlichen<br />
bzw. politischen Leben, jedenfalls soweit das Engagement<br />
über die Stimmabgabe bei Wahlen hinausgeht. Solange man<br />
nicht die unrealistische Erwartung hegt, dass alle Bürger jederzeit<br />
ihre Partizipationsrechte wahrnehmen, ist dieser Sachverhalt<br />
für sich genommen nicht problematisch. Er kann aber dann zu<br />
einer Herausforderung für die Demokratie werden, wenn sich die<br />
aktiven und die inaktiven Bevölkerungsgruppen systematisch in<br />
ihrer sozialen Herkunft und in ihren politischen Wünschen und<br />
Ideen voneinander unterscheiden. Wie die empirische Forschung<br />
vielfach belegte, sind ressourcenstarke, sozial gut integrierte<br />
Menschen politisch aktiver als Personen, denen diese Merkmale<br />
fehlen (Burstein 1972; Marsh/Kaase1979; Nie/Powell/Prewitt 1969;<br />
Verba 2003; Verba/Nie/Kim 1978; Verba/Schlozman/Brady 1995).<br />
Dies stellt eine Herausforderung an ein demokratisches Regime<br />
dar, weil die politisch aktiven Teile der Öffentlichkeit die politische<br />
Führung möglicherweise mit Forderungen konfrontieren,<br />
die sich von denen der inaktiven Bevölkerung unterscheiden. Unter<br />
diesen Bedingungen kann die ungleiche Wahrnehmung von<br />
Partizipationsrechten in Konflikt mit den Forderungen nach politischer<br />
Gleichheit und nach einem gegenüber allen Gruppen verantwortlichen<br />
Handeln der politischen Führung geraten.<br />
Bevor man dieser Frage im Einzelnen nachgeht, ist es sinnvoll, die<br />
für das politische Engagement maßgeblichen sozialen Merkmale<br />
zu bestimmen, die dazu führen können, dass die politische Führung<br />
durch die Beschäftigung mit den von den Aktivisten artikulierten<br />
Forderungen einseitige oder verzerrte Informationen über<br />
die in einer Gesellschaft vorherrschenden Bedürfnisse und Probleme<br />
erhält.<br />
1988 1998 2008<br />
Wählen<br />
Petition/<br />
Unterschrift<br />
An Diskussion<br />
teilnehmen<br />
Angemeldete<br />
Demonstration<br />
In Bürgerinitiative<br />
mitarbeiten<br />
In einer Partei<br />
mitarbeiten<br />
Nicht angemeldete<br />
Demonstration<br />
Abb. 2 Die Entwicklung ausgewählter Formen politischer Beteiligung in Deutschland, 1988–2008<br />
(Angaben: Prozentanteile).<br />
© Oscar W. Gabriel, Quelle: Allbus, eigene Auswertung. 1988 wurden nur in<br />
West<strong>deutschland</strong> Daten erhoben, für 1998 und 2008 sind die Daten für Ost- und<br />
West<strong>deutschland</strong> entsprechend Bevölkerungsverteilung repräsentativ gewichtet.<br />
Sozioökonomischer Status und Partizipation<br />
An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die sozioökonomische<br />
Stellung von Individuen zu nennen, die sich aus ihrem Bildungsniveau,<br />
ihrem Einkommen, der Art ihrer Berufstätigkeit und ihrer<br />
subjektiven Schichteinstufung ergibt. Die empirische Politikwissenschaft<br />
interessiert sich seit ihren Anfängen für die politische<br />
Bedeutung der soziökonomischen Schichtung und konnte zeigen,<br />
dass die gesellschaftliche Stellung von Individuen ihr politisches<br />
Verhalten und damit das politische Leben in modernen Gesellschaften<br />
in vielfältiger Weise prägt. In der Sozialstruktur angelegte<br />
Interessen und Wertvorstellungen führten in der Mitte des<br />
19. Jahrhunderts zur Bildung politischer Parteien, die sich der Vertretung<br />
der politischen Interessen bestimmter sozioökonomischer<br />
Gruppen widmeten und bei diesen bis zum heutigen Tage<br />
überdurchschnittlich starke Unterstützung finden (Lipset/Rokkan<br />
1967; neuere empirische Daten hierzu bei Elff/Roßteutscher<br />
2009). Auch das aktive politische Engagement der Menschen<br />
hängt stark von ihrer sozio-ökonomischen Position ab. Wie<br />
Schattschneider schon vor einem halben Jahrhundert anmerkte,<br />
singt der Chor im Himmel der pluralistischen Demokratien mit<br />
einem starken Oberschichtakzent (Schattschneider 1960).<br />
Unter den sozioökonomischen Charakteristika wird dem Bildungsniveau<br />
traditionell eine besonders wichtige Rolle als Antriebskraft<br />
politischen Engagements zugeschrieben. Im Laufe<br />
ihrer Bildungskarriere erwerben die Menschen diejenigen Wissensbestände,<br />
Kompetenzen, Wertorientierungen und Einstellungen,<br />
die sie zu einem sozialen und politischen Engagement<br />
befähigen oder motivieren. Zugleich öffnet eine qualifizierte Bildung<br />
den Zugang zu sozialen Netzwerken, was ebenfalls das politische<br />
Engagement erleichtert. Aus diesen Gründen erwies sich<br />
das Bildungsniveau in zahlreichen Studien als der wichtigste Bestimmungsfaktor<br />
der politischen Beteiligung. Je höher ihr formales<br />
Bildungsniveau ist, desto stärker engagieren sich Bürger in<br />
der Politik.<br />
Diese Annahme bestätigt sich auch für Deutschland. Wie | Abb. 3 |<br />
zeigt, steigt die Beteiligung an sämtlichen hier untersuchten politischen<br />
Aktivitäten mit dem formalen Bildungsabschluss. Allerdings<br />
stellt sich dieser Zusammenhang bei einzelnen Arten der<br />
Beteiligung unterschiedlich dar. Am schwächsten beeinflusst das<br />
21<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Bürgerbeteiligung und soziale Gleichheit