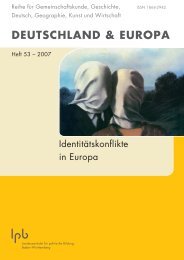deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 4 Streikende Arbeiter der Renault-Werke in Boulogne-Billancourt schauen vom Dach aus auf die<br />
Studenten, die am 17. Mai 1968 mit einem Marsch zum Werk des Automobilherstellers ihre Solidarität<br />
mit den streikenden Arbeitern bekunden wollen. Die Regierung de Gaulle unterschätzte die soziale<br />
Unzufriedenheit breiter Schichten der französischen Bevölkerung. 1968 führten die Maiunruhen zu<br />
bürgerkriegs ähnlichen Zuständen, in Paris lieferten sich die Studenten Straßenschlachten mit der Polizei.<br />
Die Gewerkschaften riefen am 13. Mai zum Generalstreik auf. Am 30. Mai löste Staatspräsident de Gaulle<br />
die Nationalversammlung auf und rief Neuwahlen aus. Diese wurden von den Gaullisten gewonnen, die<br />
Ära de Gaulle fand trotzdem ihr Ende: Am 28. April 1969 trat Charles de Gaulle nach einem verlorenen<br />
Referendum zurück. © upi, picture alliance, 13.5.1968<br />
schrumpfte und damit zur Bedeutungslosigkeit<br />
verurteilte parlamentarische Opposition<br />
sowie die von der Großen Koalition geplanten<br />
Notstandsgesetze. Ganz im Sinne Haydens<br />
forderte auch der deutsche SDS eine<br />
partizipativ erweiterte »soziale Demokratie«,<br />
so Hans-Jürgen Krahl in seiner Römerbergrede<br />
am 27.5.1968, auf der Grundlage einer<br />
»aufgeklärten Selbsttätigkeit der mündigen<br />
Massen« (| M 9 |).<br />
Auch in anderen westeuropäischen Ländern<br />
begannen zeitgleich Studentenproteste, insbesondere<br />
in Frankreich und Italien, wo der<br />
Studentenbewegung – anders als in der Bundesrepublik<br />
– Aktionsbündnisse mit der organisierten<br />
Industriearbeiterschaft z. B. bei<br />
Renault und Fiat gelangen. In Frankreich<br />
musste Präsident de Gaulle sogar das Land<br />
verlassen, weil im »Mai 1968« die Zeichen auf<br />
Revolution zu stehen schienen. Allerdings<br />
gingen nach seiner Rückkehr die Konservativen<br />
aus den Juni-Wahlen durch einen klaren<br />
Wahlsieg gestärkt hervor, der die revolutionären<br />
Träume der Mai-Bewegung wie Seifenblasen<br />
platzen ließ.<br />
In der Bundesrepublik hingegen folgte auf<br />
das rebellische Jahr 1968 ein Wahlsieg der sozialliberalen<br />
Koalition, die CDU wurde erstmals<br />
seit Bestehen der Bundesrepublik auf die Oppositionsbank<br />
verdrängt. In Reaktion auf die Partizipationsforderungen der 68er<br />
kündigte der neu gewählte Bundeskanzler Willy Brandt in seiner<br />
Regierungserklärung im Oktober 1969 programmatisch an, die<br />
sozialliberale Koalition wolle »mehr Demokratie wagen«: »Die Regierung<br />
kann in der Demo kratie nur erfolgreich wirken, wenn sie<br />
getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger[…]<br />
wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden<br />
und mitverantworten.« (| M 11 |)<br />
Es folgte in den Jahren danach ein breit ausgefächertes Reformprogramm<br />
in der Innen-, Außen- und Deutschlandpolitik, das die<br />
Bundesrepublik nicht zuletzt durch eine verstärkte Bürgerbeteiligung<br />
liberalisierte und modernisierte. Bezeichnenderweise erreichte<br />
die Wahlbeteiligung nach Ablauf der ersten sozialliberalen<br />
Legislaturperiode im Jahr 1972 mit 91,1 % den bislang höchsten<br />
Wert in der Geschichte der Bundesrepublik – ein Rekordwert, von<br />
dem wir heute nur noch träumen können. SPD-Wahlkampfparolen<br />
wie »Wir schaffen das moderne Deutschland« und »Modell<br />
Deutschland« brachten den innovativen Zeitgeist einer »partizipativen<br />
Demokratie«, die Tom Hayden 1962 und der SDS 1968 gefordert<br />
hatten, auf den Begriff.<br />
1968 wurde aber nicht nur in West<strong>europa</strong> zum »Wendejahr«, auch<br />
im Ostblock hofften Menschen angesichts des Aufbruchs im Westen<br />
auf die Chance einer Demokratisierung innerhalb der poststalinistischen<br />
Strukturen. Ein »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«,<br />
der – wie im Westen – auf einer breiteren Beteiligung der<br />
Menschen beruhen sollte (| M 12 |), wurde im Jahr 1968 in der CSSR<br />
von Alexander Dubcek, dem Ersten Sekretär der KPC, ausgerufen.<br />
Der folgende Reformprozess ist unter dem Namen »Prager Frühling«<br />
in die Geschichte der europäischen Demokratiebewegungen<br />
eingegangen und wurde, wie die Juni-Revolution 1953 in der<br />
DDR und der Budapester Aufstand 1956, von Panzern der Sowjetunion<br />
und anderer Staaten des Warschauer Pakts gewaltsam beendet.<br />
Während mit dem Jahr 1968 in der Bundesrepublik eine<br />
»Fundamentalliberalisierung« (Jürgen Habermas) begonnen<br />
hatte, endete 1968 für die Menschen des Ostblocks mit einer weiteren<br />
bitteren Enttäuschung ihrer Hoffnungen auf Liberalisierung<br />
und Demokratisierung. In der DDR zählten zu den Enttäuschten<br />
so prominente Oppositionelle wie der Physiker Robert Havemann<br />
und der Song-Schreiber Wolf Biermann, über die ein Lehr- bzw.<br />
Auftrittsverbot verhängt wurde. SED-Chef Walter Ulbricht forderte<br />
angesichts der liberalisierten Lebensformen im Westen<br />
eine »saubere Leinwand«, um die DDR als »sauberen Staat« von<br />
der Bundesrepublik abzugrenzen, und in der jugendlichen »Unkultur«<br />
von »Gammlern« und »Langhaarigen« sah er »Erscheinungen<br />
der amerikanischen Unmoral und Dekadenz«. Erweiterte Partizipationsmöglichkeiten<br />
waren in dieser Stimmung von Intoleranz<br />
und Engstirnigkeit auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.<br />
Anders in der Bundesrepublik: Die breite Politisierung, die sich<br />
seit 1968 vollzogen hatte, mobilisierte nach den Studenten und<br />
Schülern immer neue Gruppen, die sich innerhalb der politischen<br />
Öffentlichkeit nicht vertreten fühlten und deshalb ihre Teilhaberechte<br />
lautstark einklagten. Schon 1968 artikulierten SDS-Studentinnen<br />
ihren Protest gegen die männliche Hegemonie in den<br />
Führungsgremien der antiautoritären Organisationen und bildeten<br />
zunächst in Berlin einen »Aktionsrat zur Befreiung der Frau«<br />
(| M 15 |), später »Weiberräte« in mehreren Städten. Ihre Isolierung<br />
innerhalb des akademischen Sozialmilieus durchbrach die<br />
»neue Frauenbewegung« allerdings erst mit der 1971 begonnenen<br />
Kampagne gegen den § 218 des Strafgesetzbuchs, der Abtreibung<br />
mit einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bedrohte. Selbstbezichtigungen<br />
(»Ich habe abgetrieben!«) von 374 Frauen, darunter<br />
viele Prominente, in der Illustrierten »Stern« lösten 1971 eine Lawine<br />
von Fraueninitiativen, Unterschriftensammlungen und Demonstrationen<br />
unter der provokativen Parole »Mein Bauch gehört<br />
mir!« aus. Sie führten 1974 zu der von der sozialliberalen<br />
Koalition verabschiedeten »Fristenlösung« für Abtreibungen, die<br />
allerdings ein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht für nichtig<br />
erklärt und deshalb 1976 durch eine Indikationslösung mit verpflichtenden<br />
Beratungen vor einem Schwangerschaftsabbruch<br />
ersetzt wurde.<br />
Seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre dominierten weniger spektakuläre,<br />
aber umso wirkungsvollere Frauenförderungs- und<br />
Selbsthilfeprojekte (»Frauen helfen Frauen«, »pro familia« usw.),<br />
die die Einrichtung von Frauenhäusern, die Einführung von Frauenquoten<br />
(z. B. in Parteien) und Gleichstellungsbeauftragten (im<br />
öffentlichen Dienst), die Schaffung von universitären Projekten<br />
und Lehrstühlen zur Frauen- und Geschlechterforschung sowie<br />
eine Teilreform des koedukativen Schulunterrichts zur Folge hatten.<br />
Die »pragmatische Wende« der Frauenpolitik spiegelte einen<br />
allgemeinen Stimmungswandel wider, der schon seit der ersten<br />
Hälfte der 70er Jahre begonnen hatte und sich seit Willy Brandts<br />
37<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
Zivilgesellschaft liche Bewegungen in Deutschland und Europa