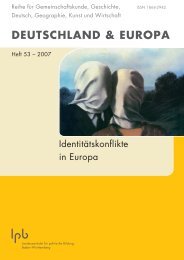deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kontrolliert werden, um ihren Einfluss besser<br />
untersuchen zu können als in einer natürlichen<br />
Situation, bei der immer sehr viele Störfaktoren<br />
vorhanden sind. Wenn sich Menschen<br />
z. B. zu Hause eine politische Talk-Show<br />
anschauen, dann sind sie vielleicht abgelenkt,<br />
weil nebenher jemand redet. Wenn<br />
man ihnen dann Verständnisfragen zur Talkshow<br />
stellen würde, dann würden sie vermutlich<br />
ziemlich schlecht abschneiden. Das muss<br />
aber nicht daran gelegen haben, dass sie die<br />
Politiker wirklich nicht verstehen konnten,<br />
sondern vielleicht einfach nur daran, dass sie<br />
abgelenkt wurden. Deshalb kontrolliert man<br />
die Versuchsbedingungen in einem Experiment<br />
und sorgt zum Beispiel dafür, dass solche<br />
Ablenkungsfaktoren nicht vorhanden<br />
sind. Wenn dann immer noch Verständnisprobleme<br />
auftreten, dann ist es sehr wahrscheinlich,<br />
dass diese wirklich dadurch zu<br />
erklären sind, dass sich die Politiker nicht<br />
verständlich genug ausdrücken. Oder dadurch,<br />
dass die Zuschauer zu wenig Vorwissen<br />
haben, das kommt auf den Standpunkt<br />
an. Das ist im Übrigen ein grundlegendes<br />
14,7<br />
67,2<br />
16,9<br />
Problem beim Thema Politik und Verständlichkeit: Wem gibt man<br />
die Schuld, wenn man auf Verständnisprobleme trifft? Den Bürgern,<br />
die zu wenig Vorwissen haben oder den Politikern, die sich<br />
nicht verständlich genug ausdrücken? Die Bürger selbst neigen<br />
natürlich dazu, den Politikern die Schuld zu geben, während diese<br />
häufig das Gefühl haben, sich gar nicht anders ausdrücken zu<br />
können, ohne das Thema zu stark zu vereinfachen. Das nennt<br />
man übrigens den »Fluch des Wissens«. Wenn man sehr viel über<br />
ein Thema gelernt hat und dieses Wissen auch schon eine ganze<br />
Weile besitzt, dann wird es immer schwieriger, sich noch in andere<br />
Leute hinein zu versetzen, die nicht dasselbe Vorwissen haben.<br />
In der Sprache führt das dann dazu, dass schwierige Wörter<br />
nicht mehr als solche wahrgenommen<br />
werden. Das ist aber ein ganz<br />
natürlicher Prozess und passiert<br />
nicht nur Politikern, sondern zum<br />
Beispiel auch Wissenschaftlern<br />
oder sonstigen Experten. Besonders<br />
problematisch ist das dann,<br />
wenn man nicht direkt mit den eigentlichen<br />
Adressaten der eigenen<br />
Botschaften konfrontiert ist, wie<br />
eben in einer Talkshow. Da richten sich die Teilnehmer ja eigentlich<br />
an die Fernsehzuschauer, nicht an die anderen Gäste. Aber<br />
von den Fernsehzuschauern kann ja niemand nachfragen, wenn<br />
er oder sie etwas nicht versteht. Allerdings: Das trauen sich viele<br />
auch dann nicht, wenn der Politiker oder die Politikerin direkt vor<br />
einem steht. Man will dann eben lieber nicht zugeben, dass einem<br />
viele Begriffe nicht geläufig sind und ärgert sich doch gleichzeitig<br />
über den abgehobenen Sprachstil des Politikers.<br />
D&E: Wie sah Ihre Untersuchung denn genau aus und zu welchen Ergebnissen<br />
sind Sie darin gekommen?<br />
Jan Kercher: Wir haben 134 junge Stuttgarterinnen und Stuttgarter<br />
im Alter von 16 bis 21 Jahren befragt und sie mit kurzen Politiker-Reden<br />
konfrontiert. Das waren etwa fünfminütige Video-Podcasts<br />
von Angela Merkel, Kurt Beck, Guido Westerwelle und<br />
Oskar Lafontaine. Vor dem Anschauen der Videos haben wir das<br />
politische Interesse und Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
erfasst. Und nach dem Anschauen jedes Videos haben wir sie<br />
dann gefragt, wie verständlich sie die Podcasts subjektiv fanden<br />
und ihnen auch noch Verständnisfragen zu den Inhalten der Videos<br />
gestellt. Dabei haben wir auch erfasst, wie sicher sich die<br />
Befragten bei ihren Antworten waren. Entscheidend war, dass wir<br />
10,7<br />
62,1<br />
26,1<br />
8,4<br />
47,7<br />
42,9<br />
2,7<br />
35,5<br />
61,5<br />
14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre<br />
bis 25%<br />
25%–50%<br />
50%–75%<br />
über 75%<br />
1.714 Befragte<br />
Abb. 2 Politisches Wissen von Jugendlichen, Rheinland-Pfalz 2005<br />
© Jens Tenscher/Philipp Scherer (2012): Jugend, Politik und Medien.<br />
Politische Orientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen<br />
in Rheinland-Pfalz. Münster, S. 86<br />
»Einer Wahlaltersenkung<br />
sollte man eine Änderung der<br />
Bildungspläne voranstellen.«<br />
17,7<br />
77,8<br />
bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt unterschiedliche<br />
Bildungsgrade und Altersstufen abgedeckt haben.<br />
Zum einen haben wir 16- und 17-jährige Neuntklässler auf der<br />
Hauptschule und im Gymnasium befragt. Und zum anderen 18-<br />
bis 21-jährige Berufsschüler und Studienanfänger.<br />
Betrachtet man unsere Ergebnisse, so stellt sich heraus, dass das<br />
Alter tatsächlich einen deutlichen Einfluss auf das Abschneiden<br />
der Befragten bei den Wissens- und Verständnisfragen hatte. Und<br />
zwar unabhängig vom Bildungsgrad. Sowohl die volljährigen Berufsschüler<br />
als auch die Studienanfänger schnitten sehr viel besser<br />
ab als die Neuntklässler in der Hauptschule und auf dem Gymnasium.<br />
Das ist unserer Interpretation nach eine Folge der<br />
bisherigen Bildungspläne in Baden-<br />
Württemberg, die den Großteil der<br />
politischen Bildung erst in den höheren<br />
Schulstufen vorsehen und<br />
nicht schon vor Erreichen des 16.<br />
Lebensjahres. Mit anderen Worten:<br />
Sie sind offensichtlich ausgerichtet<br />
auf ein Wahlrecht ab 18, das ja bislang<br />
in Baden-Württemberg auch<br />
so gilt. Interessant war für uns aber<br />
auch, dass es beim politischen Interesse zwischen den älteren<br />
und den jüngeren Befragten kaum Unterschiede gab. Die Jüngeren<br />
interessierten sich also fast genauso stark für Politik wie die<br />
Älteren. Das bedeutet, dass sich die 16- und 17-Jährigen durchaus<br />
für Politik interessieren, aber bislang offensichtlich deutlich weniger<br />
von Politik verstehen als volljährige Schüler und Studienanfänger.<br />
D&E: Können Sie aus den Ergebnissen Ihrer Studie auch Konsequenzen<br />
für die politische Bildung junger Menschen sowie für die Bildungspläne<br />
der Schulen ableiten?<br />
Jan Kercher: Ja. An unseren Ergebnissen lässt sich ja recht deutlich<br />
der Effekt der bisherigen Bildungspläne in Baden-Württemberg<br />
ablesen. Da liegt die Vermutung sehr nahe, dass ein Vorziehen<br />
der politischen Bildung in den Schulen – und zwar in allen<br />
weiterführenden Schulen – dazu führen würde, dass sich die Altersunterschiede,<br />
die wir in unserer Studie feststellen konnten,<br />
deutlich verringern würden. Auf diese Weise könnte man eine<br />
Überforderung vieler Jugendlicher, wie man sie in Österreich beobachten<br />
konnte, vermutlich vermeiden. Ich finde, dass man das<br />
Ganze recht gut mit der Diskussion über die Einführung des Euro<br />
vergleichen kann. Damals gab es zwei Lager, die Anhänger der so-<br />
2,9<br />
59<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013<br />
»Wahlalter 16« – eine Chance zur Überwindung der Politikverdrossenheit?