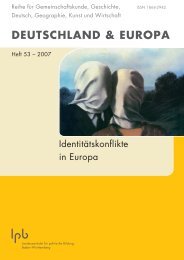deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
deutschland & europa - lehrerfortbildung-gemeinschaftskunde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
70<br />
JEANNETTE BEHRINGER<br />
MATERIALIEN<br />
M 1<br />
Thomas Olk: »Topographie des freiwilligen Engagements<br />
in Deutschland«<br />
Freiwilliges beziehungsweise bürgerschaftliches Engagement hat<br />
in Deutschland eine lange Tradition. So haben etwa im Verlaufe<br />
des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Formen des bürgerschaftlichen<br />
Engagements (bürgerliche Sozialreform, Frauenbewegung,<br />
christliche Bewegungen sowie die Stein-Hardenberg’sche Kommunalreform)<br />
zur Entstehung des deutschen Sozialstaates beigetragen.<br />
Dennoch führten Formen des freiwilligen beziehungsweise<br />
bürgerschaftlichen Engagements in der Folgezeit ein<br />
Schattendasein, was nicht zuletzt mit der Expansion des deutschen<br />
Sozialstaates zusammenhängt. Erst in der zweiten Hälfte<br />
der 1970er Jahre stieg angesichts der Grenzen des Wachstums des<br />
Wohlfahrtsstaates die Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen<br />
Formen des freiwilligen Engagements wieder an. Mit dem Internationalen<br />
Jahr der Freiwilligen (IJF) im Jahre 2001 und der Enquete-Kommission<br />
des Deutschen Bundestages »Zukunft des<br />
bürgerschaftlichen Engagements« (1999 bis 2002) erhielt das freiwillige<br />
Engagement sogar eine prominente öffentliche Sichtbarkeit,<br />
die mit der Initiative Zivil-Engagement (IZE) des Bundesministeriums<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und<br />
dem Nationalen Forum für Engagement und Demokratie einen<br />
vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.<br />
In Deutschland gibt es bis heute keinen Konsens hinsichtlich der<br />
Begrifflichkeit. Traditionell werden unentgeltliche und freiwillige<br />
Tätigkeiten im öffentlichen Raum mit dem Begriff des »Ehrenamtes«<br />
belegt. Inzwischen werden neben dem klassischen Begriff<br />
des Ehrenamtes insbesondere die Termini »freiwilliges Engagement«<br />
und »bürgerschaftliches Engagement« gebraucht. So verständigte<br />
sich die Enquete-Kommission im Jahr 1999 auf den Begriff<br />
des »bürgerschaftlichen Engagements«, um im Anschluss an<br />
republikanische Denktraditionen die gesellschaftspolitische Dimension<br />
freiwilligen Handelns zu betonen. Der erstmalig im Jahre<br />
1999 in Auftrag gegebene Freiwilligensurvey spricht relativ neutral<br />
von »freiwilligem Engagement«. Hinsichtlich der operativen<br />
Dimension gibt es allerdings Konsens dahingehend, dass es sich<br />
bei (freiwilligem beziehungsweise bürgerschaftlichem) Engagement<br />
um freiwillige, nicht auf materiellen Gewinn gerichtete, gemeinwohlorientierte<br />
und im öffentlichen Raum statt findende<br />
Tätigkeiten handelt, die in der Regel gemeinschaftlich beziehungsweise<br />
kooperativ ausgeübt werden. (…) International vergleichende<br />
Angaben lassen sich (…) aus dem ESS (»European Social<br />
Survey«) ableiten. Danach liegt der prozentuale Anteil<br />
ehrenamtlich Aktiver mit 24,6 Prozent in Deutschland deutlich<br />
über dem internationalen Durchschnitt (der bei 17,6 Prozent<br />
liegt). Die höchsten Beteiligungsquoten weisen Norwegen (36,6<br />
Prozent), Schweden (34,7 Prozent) und die Niederlande (30,6 Prozent)<br />
auf, die niedrigsten dagegen Italien (4,6 Prozent), Polen (5,6<br />
Prozent) und Portugal (6,1 Prozent). (…) Was die Tätigkeitsbereiche<br />
anbelangt, so bleibt der Bereich »Sport und Bewegung« nach<br />
wie vor der mit Abstand größte Bereich, gefolgt von »Schule/ Kindergarten«,<br />
»Kirche und Religion« sowie »Kultur und Musik« sowie<br />
dem »sozialen Bereich«. In dem Zeitraum zwischen 1999 und<br />
2004 sind insbesondere die Bereiche »Kindergarten/Schule«, »außerschulische<br />
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung« sowie<br />
der »soziale Bereich« gewachsen. Dabei geht diese Zunahme in<br />
den beiden erstgenannten Bereichen auf das Konto der jungen<br />
Leute (14 bis 30 Jahre), während das Wachstum des »sozialen Bereichs«<br />
vor allem durch Menschen ab 40 Jahre getragen wird. (…)<br />
Das quantitative Ausmaß des freiwilligen Engagements ist in<br />
Deutschland mit 36 Prozent durchaus (für manche überraschend)<br />
hoch; mit dieser Engagementquote befindet sich Deutschland im<br />
internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld. Allerdings gibt es<br />
eine hohe soziale Selektivität nach Bildungsstand, sozialer Vernetzung,<br />
ethnischer Zugehörigkeit, beruflicher Tätigkeit, etc.;<br />
M 2<br />
(…) Viele Organisationen klagen dennoch über einen Rückgang<br />
ehrenamtlicher Beteiligung und schwindender Bereitschaft zur<br />
Ausübung langfristig bindender Engagements etwa im Führungsund<br />
Leitungsbereich; hier erweist sich ein weiteres Mal, dass freiwilliges<br />
Engagement eine schwer zu bindende Ressource ist, die<br />
entsprechender Rahmenbedingungen bedarf<br />
© Thomas Olk: »Topographie des freiwilligen Engagements in Deutschland«, in: Grenzen-<br />
Los!, a. a. O., S. 22ff., www.lpb-bw.de/6014.html<br />
M 3<br />
Organisatorinnen, Organisatoren, Referentinnen und Referenten des Kongresses<br />
»Grenzen-Los!« in Konstanz 2009: (von links): Dr. Jeannette<br />
Behringer, Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Professor Dr. Thomas Olk, Eva<br />
More-Hollerweger, Lothar Frick, Direktor der LpB Baden-Württemberg<br />
© Andreas Kaier, Esslingen<br />
Isabelle Stadelmann-Steffen: »Topographie des<br />
freiwilligen Engagements in der Schweiz«<br />
Rund ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung ist innerhalb<br />
von Vereinsstrukturen freiwillig engagiert. Hierbei können die bereits<br />
in früheren Untersuchungen festgestellten Unterschiede<br />
zwischen der Romandie beziehungsweise dem Tessin und der<br />
Deutschschweiz bestätigt werden. In der Deutschschweiz sind<br />
substantiell mehr Personen freiwillig tätig, als dies in der lateinischen<br />
Schweiz der Fall ist. Dies gilt nicht nur für freiwillige Tätigkeiten<br />
im Allgemeinen, sondern ebenso für die Übernahme von<br />
Ehrenämtern im Besonderen. Mit einem Bevölkerungsanteil von<br />
gut zehn Prozent sind die meisten der formell Freiwilligen in<br />
Sport- und Freizeitvereinen tätig. Umgekehrt engagieren sich weniger<br />
als zwei Prozent in politischen Parteien oder in Menschenrechts-<br />
und Umweltverbänden.<br />
Darüber hinaus ist ein hoher sozialer Status, das heißt eine hohe<br />
Bildung, ein hohes Haushaltseinkommen und eine gute beru iche<br />
Stellung dem freiwilligen Engagement grundsätzlich förderlich.<br />
Demgegenüber ist die verfügbare Zeit nicht das wesentliche<br />
Merkmal formell Freiwilliger (…). Gerade Bevölkerungsgruppen,<br />
die im Prinzip über zeitliche Ressourcen verfügen, um sich in Vereinen<br />
und Organisationen freiwillig zu betätigen, wie etwa Rentner,<br />
Arbeitslose oder Teilzeiterwerbstätige, engagieren sich nicht<br />
so stark wie erwartet. Vielmehr ist die soziale Integration – sei es<br />
über den Beruf oder über familiäre Beziehungen und Freunde –<br />
von zentraler Bedeutung für ein freiwilliges oder ehrenamtliches<br />
Engagement. (…)<br />
In der Schweiz sind insgesamt über 37 Prozent der Bevölkerung<br />
informell, also außerhalb von Vereinen und Organisationen, freiwillig<br />
tätig. Ähnlich wie beim formell freiwilligen Engagement ergeben<br />
sich dabei erhebliche regionale Unterschiede. Vor allem in<br />
den Kantonen der Ost- und Zentralschweiz ist das informelle En-<br />
»Projekt Grenzen-Los!« Trinationale Zusammenarbeit für eine Engagement kultur<br />
D&E<br />
Heft 65 · 2013